Hauptmenü
Sie sind hier
Der Mann im Glassarge
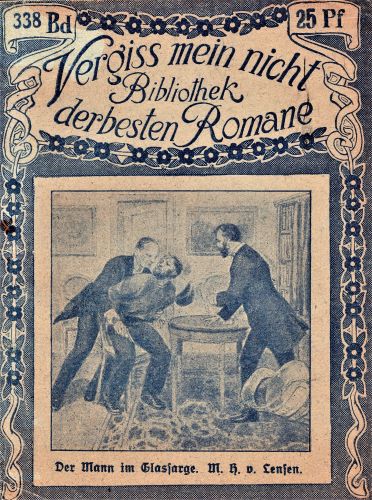
Vergißmeinnicht
Bibliothek der besten Romane
Band 338
Der Mann im Glassarge.
Amerikanischer Roman
von
M. H. von Lensen.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin 14,
Dresdenerstraße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten. Copyright by Verlag mod. Lektüre G. m. b. H., Berlin.
1. Kapitel.
Ein merkwürdiges Liebespaar.
Über San Franzisko, der berühmten Handelsmetropole der amerikanischen Westküste, spannte sich ein wolkenloser, tiefblauer Himmel aus. Trotzdem waren an diesem wunderbar schönen Sommernachmittag die zahlreichen Tennisplätze des Marinekasinos, von denen man einen so herrlichen Ausblick auf „Golden Gate[1]“, die breite, natürliche Hafeneinfahrt hat, nur wenig besucht.
Auf einem dieser Plätze, wo eine junge Dame und ein Herr mit kirschbraun gebranntem Gesicht, ohne sich um die sengenden Strahlen der Sonne zu kümmern, bisher eifrig die Bälle hin und her getrieben hatten, kam es jetzt plötzlich zu einer Unterbrechung des Spiels. Das Paar war miteinander über die Gültigkeit des letzten Balles in Streit geraten.
„Ich aber sage Ihnen, der Ball war innen, Harry!“ rief Alice Weather zornsprühend und schlug erregt mit ihrem Tennisschläger auf das straffgespannte Netz, hinter dem der schlanke Marineleutnant mit seinem überlegenen Lächeln in dem glatten Gesicht stand und seine Partnerin halb belustigt, halb vorwurfsvoll anschaute.
„Gut, brechen wir das Spiel also ab, da ja doch keine Einigung zu erzielen ist“, meinte Harry Sanders darauf mit leichter Verbeugung, drehte sich um und schritt dem kleinen Pavillon zu, der unter den breitästigen Linden zwischen den Tennisplätzen lag und die Garderobenräume für die Spieler enthielt.
Vor dem weißgestrichenen, zierlichen Häuschen saß in einem bequemen Korbstuhl eine ältere hagere Dame, die zuerst dem Wortwechsel der beiden jungen Leute mit sorgenvollem Gesicht gelauscht hatte, sich jetzt aber, lächelnde Unbefangenheit heuchelnd, an den Marineoffizier mit der Frage wendete: „Selbst an diesem herrlichen Sommernachmittag Zank und Streit, lieber Sanders? Und einer solchen Kleinigkeit wegen!“ – Leicht aufseufzend und in komischer Verzweiflung die Hände faltend, setzte sie leiser hinzu: „Wie soll das nur enden, wenn jeder Tag eine neue Meinungsverschiedenheit bringt!“
In demselben Augenblick ging Alice Weather vorüber, und ohne die beiden auch nur eines Blickes zu würdigen, sagte sie mit gemachter Gleichgültigkeit: „Es endet so, teuerste Hopkins, daß ich morgen früh mit der „Ariadne“ Frisko verlasse und nach Kalkutta zum Besuch meines Onkels Richard abdampfe und dadurch Harry endlich den Anblick meiner Person entziehe.“ Dann verschwand sie mit ärgerlich zurückgeworfenem Kopf in der Tür des Pavillons.
Wieder seufzte die spindeldürre Miß Hopkins auf. Dieses Mal schien ihre gedrückte Stimmung jedoch völlig echt zu sein.
„Wenn Sie nur wüßten, was ich für ein Kreuz mit dem Mädchen habe!“ klagte sie weinerlich. „Wirklich, am liebsten würde ich diese Stellung aufgeben und mich zur Ruhe setzen. Meine Mittel erlauben mir’s ja. So behaglich ich mich auch im Hause ihres Vaters fühle, so lebe ich doch in beständiger Aufregung und Angst, habe nur dafür zu sorgen, daß Alice sich nicht durch ihre Streiche in der New Yorker Gesellschaft ganz unmöglich macht. Für eine Frau in meinen Jahren ist das eine fürchterliche Aufgabe. Nerven kostet’s, glauben Sie mir’s! Ich bin noch ganz krank von der letzten endlosen Seereise.“
Mit bittendem Blick schaute sie jetzt Sanders an, der sich neben sie in einen zweiten Korbstuhl gesetzt hatte und nachdenklich die Finger seiner Rechten über die Darmsaiten des Tennisschlägers wie über eine Mandoline gleiten ließ.
„Helfen Sie mir doch!“ fuhr sie eindringlich fort und legte ihre Hand wie beschwörend auf seinen Arm. „Mich täuschen Sie ja nicht. Ich weiß, Sie lieben Alice ebenso heiß, wie Sie von ihr wiedergeliebt werden.“ – Und nach einer kurzen Pause stieß sie hastig und halb verlegen hervor: „Geben Sie doch endlich Ihren sogenannten Plan auf! Der alte Weather wird schon einwilligen, wenn er Sie auch das erstemal abgewiesen hat.“
Harrys von Seeluft und Sonne tiefgebräuntes Gesicht hatte plötzlich einen fast abweisenden Ausdruck angenommen.
„Ich bedaure unendlich, Ihnen diese Bitte abschlagen zu müssen, Miß Hopkins, trotzdem ich sehr wohl weiß, wie gütig und selbstlos es von Ihnen ist, daß Sie so den Freiwerber für Ihren Schützling bei mir spielen. Denn eine vielfache Millionärin in dem verheißungsvollen Alter von zwanzig Jahren und ein simpler Marineleutnant – welch ein Unterschied! Da könnte Alice Weather doch ganz andere Partien machen, besonders da ich nur über einen schlicht bürgerlichen Namen, also nicht einmal über das kleinste ausländische Grafenkrönlein verfüge und die Ehre der Bekanntschaft mit Ihrer ebenso launenhaften wie exzentrischen Herrin nur dem Umstande verdanke, daß der alte Weather und mein verstorbener Vater Freunde waren. Wenn ich nun dem fabelhaften Glücke dieser glänzenden Heirat trotzdem aus dem Wege gehe, so hat das seine bestimmten, sehr schwerwiegenden Gründe. Ich habe von der Ehe vielleicht noch etwas veraltete Anschauungen, jedenfalls ganz andere, als sie jetzt in den Kreisen der oberen Zehntausend von New York und leider auch bei Ihrem Schützling zu finden sind. Ich könnte mich nie an den Gedanken gewöhnen, zu den Kosten eines Haushalts im Stile Alices nur eine Leutnantsgage von monatlich fünfzig Dollars beizusteuern, das heißt also von dem Gelde meiner Frau zu leben, – besonders wo der Vater meiner Angebeteten mir bei meiner ersten Werbung rund heraus erklärte, ich solle ihm erst beweisen, daß ich auch „Geld zu machen“ verstehe. Dann solle ich wiederkommen! Ich habe auch meinen Stolz, glauben Sie mir! Daher werde ich demnächst den Dienst quittieren und mir wieder eine Stelle als Ingenieur suchen, was ich ja auch ursprünglich war. Vielleicht habe ich Glück und besitze in kurzem so viel, daß ich dem alten Weather als Schwiegersohn willkommen bin. Mit einem Wort: Ich werde des alten Herrn Einwilligung nie erzwingen, nie, selbst wenn Alice mir eine Liebeserklärung machen und gegen ihres Vaters ausdrücklichen Wunsch sich mit mir verloben würde.“
„Danach hätten Sie also das Gefühl, daß – daß Alice sich Ihnen aufdrängt?“ meinte Miß Hopkins etwas spitzen Tones. „Ich denke, aus dem Benehmen des Mädchens Ihnen gegenüber spricht das gerade Gegenteil.“
„Ansichtssache, Miß Hopkins!“ lächelte Sanders ironisch. „Es gibt zum Beispiel eine ganze Menge von meinen Kameraden von der „Niagara“, die steif und fest behaupten, daß Alicens Vergnügungsjacht „Ariadne“ die amerikanische Flotte auf ihrer großen Kreuzfahrt um Kap Horn nur deswegen mit so rührender Ausdauer von Hafen zu Hafen begleitet hat, weil sich eben auf der „Niagara“ unter einer Zahl von 12 Leutnants gerade der eine befand, der sich während des verflossenen Winters in New York ebenfalls an den Siegeswagen der schönen Besitzerin der „Ariadne“ spannen ließ, dann aber von dem Papa ziemlich … groben Tones „kaltgestellt“ wurde. Offen gestanden bin ich auch jetzt, was die Person Alicens anbetrifft, ziemlich ernüchtert. Sie ist für meinen Geschmack ein zu launenhaftes, eben zu verwöhntes Geschöpf. Trotzdem werde ich an ihr festhalten, – in der Hoffnung, daß sie sich noch ändert. Zum Glück war ich ja vorsichtig genug, erst bei dem alten Weather anzufragen, bevor ich mich ihr erklärte. Ich bin also noch völlig frei, völlig …“
Harry Sanders führte mit seinem Rakett bei den letzten Worten einen so kräftigen Schlag gegen einen nicht vorhandenen Ball, daß die nervöse Dame neben ihm ängstlich zusammenzuckte.
„Außerdem glaube ich, verehrteste Freundin“, fuhr er ingrimmig fort, „daß Alice in dem neuen Kapitän der „Ariadne“ jetzt einen ergebeneren Sklaven für ihre Launen gefunden hat, als ich es ihr je gewesen bin. Für diesen William Harper muß die Zutraulichkeit und Liebenswürdigkeit seiner Gebieterin allerdings sehr schmeichelhaft und sehr berückend sein. Ich fürchte nur, Ihr Schützling wird mit diesem Manne noch schlechte Erfahrungen machen.“ Er schwieg eine Weile.
„Der Mensch hat etwas in seinem Blick, das mich stört, mich geradezu abstößt. Seine aalglatte Geschmeidigkeit und Untertänigkeit läßt ebenfalls auf keinen besonders gefestigten Charakter schließen.“
Diese letzten Sätze klangen so erregt, daß Miß Hopkins ihren Nachbar erst ganz erstaunt ansah, dann aber in ein lautes Lachen ausbrach.
„Also eifersüchtig ist man, – sieh da!“ meinte sie dann. „Ihr Herz ist demnach doch nicht ganz so unberührt geblieben, wie Sie es mir vormachen wollen. Diese Entdeckung läßt mich jetzt wieder hoffen – worauf, wissen Sie ja. Aber dem guten Kapitän tun Sie trotz alledem unrecht. Gewiß, ein unparteiisches Urteil kann man unter diesen Umständen von Ihnen kaum verlangen, wenn ich mich auch wundere, daß ein so kühl abwägender Geist wie der Ihre sich durch derartige rein persönliche Empfindungen beeinflussen läßt.“
„Sie irren, Miß Hopkins“, sagte Sanders schon wieder in seiner gewohnten, ruhigen Art. „Meine Abneigung gegen Harper hat einen sehr triftigen Grund, den ich allerdings bisher verschwiegen habe, um nicht in den Verdacht zu kommen, irgendwie voreingenommen zu sein. Ich halte mich aber jetzt sogar verpflichtet, Ihnen meine Beobachtungen mitzuteilen, da ich annehme, daß Alice tatsächlich morgen mit der „Ariadne“ San Franzisko verlassen wird, und ich sie nicht ungewarnt lassen möchte. Sie können ihr in meinem Namen das nötige berichten, falls Sie es für notwendig halten sollten. Harper erinnert mich nämlich nur zu sehr an einen Menschen, den ich einmal – es war vor zwei Jahren – unter ganz besonderen Umständen zu Gesicht bekam. Ich gehörte damals zum Stabe des Kreuzers „Ohio“, der für einige Monate im Hafen von Sitka in Alaska stationiert war. Eines Tages wurden uns mehrere Häftlinge an Bord gebracht, die lange Zeit den Hafen von San Franzisko unsicher gemacht hatten und deren gefährlichste Mitglieder nach den Goldminen von Klondyke entkommen waren. Unsere Polizei hatte sie schließlich aber doch aufgestöbert, und der „Ohio“ fiel die Aufgabe zu, die Gefangenen zurückzubringen. Unter diesen Leuten befand sich nun auch ein Mensch, mit dem Harper eine recht verfängliche Ähnlichkeit hat, trotzdem der jetzige Kapitän der „Ariadne“ einen selbst für einen Seemann recht stattlichen Bart trägt und jener Bursche ebenso glatt rasiert war wie ich.“
„Und das ist alles, was Sie vorzubringen haben!“ meinte Miß Hopkins enttäuscht. „Nichts als eine unbestimmte Ähnlichkeit mit einem Menschen, der jetzt wahrscheinlich für Jahre der Welt entzogen ist! – Nein, davon will ich Alice doch besser nichts erzählen. Sie würde uns einfach auslachen. Bedenken Sie doch, lieber Freund, wo soll Harper die vorzüglichen Kenntnisse und das auf seinen Namen lautende amtliche Kapitänspatent herbekommen haben, das er uns in Valparaiso vorzeigte, als unser alter Jenkins so plötzlich an Malaria erkrankte?“
„Die Papiere können gefälscht sein oder einer ganz anderen Person gehören“, warf Sanders hartnäckig ein.
„Nein – nein, Sie müssen sich täuschen!“ verteidigte Miß Hopkins den jungen Kapitän der „Ariadne“. „Außerdem kann es Ihnen auch gar nicht schwer fallen, sich Klarheit zu verschaffen. Sie brauchen sich ja nur bei der Polizei zu erkundigen.“
„Der Vorschlag läßt sich hören“, meinte Sanders nachdenklich. „Ich will auch gleich nachher –“
Er wurde durch Alice Weather unterbrochen, die sich jetzt, nachdem sie ihre weißen Schuhe mit hohen, elegante Lackstiefelchen vertauscht und über ihr leichtes Sportkostüm einen halblangen losen Mantel gezogen hatte, wieder zu ihnen gesellte.
„Nur weiter, Harry“, sagte sie noch immer kampflustig zu dem Leutnant, der bei ihrem Erscheinen plötzlich verstummt war. „Und wenn Sie mit Miß Hopkins irgend welche Geheimnisse haben, so gehe ich gern einstweilen voraus.“
Aber Sanders ließ sich auf ein neues Geplänkel nicht ein. Die Fahrt auf der elektrischen Straßenbahn bis zum Hafen legte die kleine Gesellschaft in recht gedrückter Stimmung und sehr einsilbig zurück.
* * *
Im Hafen war zwischen zwei hochbordigen Handelsdampfern, unweit der mächtigen Speicher der Hamburg-Amerika-Linie die „Ariadne“, eine schlankgebaute, mittelgroße Turbinenjacht, festgemacht.
Kaum hatte Alice das Deck betreten, als sie auch schon durch einen der Matrosen den Kapitän zu sich rufen ließ. Als William Harper vor ihr stand, sagte sie absichtlich laut, so daß Sanders, der mit Miß Hopkins gefolgt war, es notwendig hören mußte: „Wir werden über morgen früh San Franzisko verlassen, Kapitän. Bringen Sie also die Schiffspapiere auf dem Hafenamt in Ordnung und sehen Sie auch zu, daß wir für eine Reise nach Kalkutta genügend mit allem Nötigen versehen sind. Die neue Mannschaft muß ebenfalls schleunigst an Bord kommen.“
Harper zuckte bei dieser Nachricht leicht zusammen, faßte sich aber schnell, legte die Hand salutierend an die Mütze und verschwand wieder unter Deck.
Auch Sanders verabschiedete sich jetzt, da er von neun Uhr abends auf der „Niagara“ die Wache hatte. Alice Weather reichte ihm sehr kühl die äußersten Fingerspitzen, vermied es jedoch, ihn anzusehen.
„Meinen Abschiedsbesuch werde ich morgen machen, wenn Sie gestatten“, sagte der Leutnant sehr förmlich und verließ dann die „Ariadne“, um an Bord seines Panzers zurückzukehren, der als erster in der Kiellinie des amerikanischen Geschwaders dicht bei der Insel Yerba Buena vor Anker lag. Alice stand neben Miß Hopkins an der Reling ihrer Jacht und schaute Sanders so lange nach, bis er hinter einem Haufen aufgeschichteter Petroleumtonnen verschwunden war. Als sie sich in ihrer Hoffnung, daß Harry noch einen Blick nach der „Ariadne“ zurückwerfen würde, getäuscht sah, trat in ihr hübsches Glicht ein geradezu unschöner Ausdruck ärgerlichen Trotzes.
„Meinetwegen braucht er sich morgen wahrhaftig nicht persönlich zu verabschieden“, sagte sie hastig. „Männer mit solchen Eisenköpfen sind mir verhaßt. Immer und immer kehren sie nur die Herren der Schöpfung heraus, als ob wir Frauen überhaupt keine eigene Meinung haben.“
„Ich halte es wirklich auch für ratsam, Alice, daß Sie Ihren Plan nach Kalkutta abzudampfen, nicht mehr ändern“, meinte Miß Hopkins, die dieses Eheprojekt bereits als endgültig gescheitert ansah, eifrig. „Ihr beiden paßt eben nicht zu einander, seid beide zu wenig nachgiebige Naturen.“ Die junge Millionärin schaute überrascht auf.
„Wie, liebe Hopkins, jetzt sind Sie mit einemmal so ganz meiner Ansicht?! Bisher verteidigten Sie Harry doch stets bis zum äußersten, daß es fast den Eindruck machte, als ob Sie sich auch in diesen frischen, fröhlichen Menschen verliebt hätten.“
Worauf Miß Hopkins in stiller Wut ohne jedes weitere Wort von Deck verschwand.
2. Kapitel.
Alte Bekannte.
Die kleine, felsige Insel Yerba Buena liegt ungefähr in der Mitte der Bai von San Franzisko, die wohl der beste natürliche Hafen der ganzen Welt genannt werden muß und einer unbeschränkten Zahl von Seeschiffen sicheren Schutz gewährt. Auf Yerba Buena stand früher eine blühende Niederlassung der Franziskanermönche, die aber durch das Erdbeben im Jahre 1865 völlig zerstört und dann nicht mehr aufgebaut wurde.
Erst fünfzehn Jahre später fand das Inselchen einen neuen Bewohner in einem mürrischen, rotköpfigen Irländer, der für billiges Geld von der Regierung ein größeres Stück anbaufähiges Land an der Südseite des kleinen Höhenrückens erwarb und dort mit Hilfe einer früheren Negersklavin einen bescheidenen Farmbetrieb anfing.
Als die Vereinigten Staaten dann im Jahre 1895 an der Südspitze von Yerba Buena einen Leuchtturm errichteten und an den Felsabhängen größere Befestigungen anlegten, wäre man den Irländer als unbequemen Aufpasser gern wieder losgeworden; aber der ebenso starrköpfige wie habgierige Alte forderte für sein Besitztum einen so unverschämten Preis, daß man ihn unbehelligt ließ und seine späteren, nur wenig bescheideneren Angebote rundweg abschlug.
So kam es denn, daß die „Rote Farm“, wie sie allgemein nach ihrem rothaarigen Eigentümer genannt wurde, auf der kleinen Insel neben den verschiedenen Regierungsbauten der einzige Privatbesitz blieb, – zwei gänzlich verfallene Stallgebäude und ein niedriges Wohnhaus, die fünfhundert Meter vom Südstrand entfernt unter einigen verkrüppelten Eichen lagen.
In dem größten Raume des Wohngebäudes der Farm befanden sich an dem Nachmittag, als die Tennispartie zwischen Alice Weather und Harry Sanders so plötzlich abgebrochen wurde, O’Connor Morris, der Irländer, und seine Wirtschafterin Rosanna, die alte Negerin. Morris lag in seinem Bett, neben dem die Schwarze auf einem Stuhle saß und eifrig strickte. Stunden waren verflossen, ohne daß zwischen ihnen ein Wort gewechselt worden war. Erst der schrille Ton der Hausglocke brachte wieder Leben in die beiden einsamen Bewohner dieser weltabgeschiedenen Besitzung.
„Rosanna, es hat geläutet! Hörst Du denn nicht!“ rief Morris ungeduldig und drehte sich schwerfällig in seinem Bett dem Fenster zu.
„Nur noch eine Runde!“ klang’s zurück, und die Nadeln wurden schneller zwischen den grauschwarzen Fingern der Alten bewegt.
Morris, den ein schwerer Schlaganfall vor zwei Jahren fast hilflos gemacht hatte, brummte ärgerlich eine Verwünschung vor sich hin und starrte dann ergeben zu der verräucherten Decke empor, an der ein paar träge Fliegen wie schwarze Pünktchen umherkrochen.
Wieder wurde draußen an der Glocke gerissen, laut, fordernd. Jetzt legte endlich die Negerin ihr Strickzeug auf das Fensterbrett, erhob sich und verließ das Zimmer. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie zurückkehrte und zu Morris an das Bett trat.
„Ein Herr möchte Sie sprechen. Seinen Namen hat er nicht genannt, und ich kenne ihn auch nicht“, sagte sie mißtrauisch. „Soll ich ihn hereinlassen?“
Auf dem bleichen Gesicht des Gelähmten zeigte sich eine deutliche Unruhe. Er hatte offenbar kein ganz reines Gewissen, und ein Unbekannter brachte vielleicht nichts Gutes. Doch schließlich nickte er Rosanna kurz zu und schaute dann gespannt nach der Tür.
Der Mann, der jetzt mit nachlässigem Gruß die Stube betrat, war eine hochgewachsene Erscheinung mit energischem, von einem Vollbart umrahmtem Gesicht, in dem ein Paar stechende, dunkle Augen funkelten.
„Ich möchte mit Ihnen allein sprechen, Mister Morris“, sagte er mit einer Stimme, die keinen Widerspruch zu dulden schien.
Der Irländer fuhr bei dem Klang dieser Stimme sichtlich zusammen und starrte den Fremden erst eine Weile ganz entsetzt an, bevor er zu der Negerin sagte: „Laß uns allein, Rosanna!“ – Kaum hatte diese das Zimmer verlassen, als er sich mühsam in seinem Bett aufrichtete und ängstlich flüsterte: „Thomas Sinters, Mann, seid Ihr des Teufels, daß Ihr Euch nach Frisko (Abkürzung für San Franzisko) wagt! Ich erkannte Euch nicht gleich wieder mit diesem schönen Vollbart, aber Eure Stimme habe ich nicht vergessen. – Was wollt Ihr hier, Mann! Wenn die Polizei Euch abfaßt, so könnt Ihr den Rest Eures Lebens hinter eisernen Gardinen zubringen.“
Doch auf Sinters schien diese Warnung gar keinen Eindruck zu machen. Er streckte dem Kranken jetzt mit einem sorglosen Lächeln die Hand hin und sagte mit einer gewissen Wärme im Ton: „Ich freue mich ehrlich, daß ich Euch noch lebend und munter vorfinde, Morris. Schade aber ist’s, daß ein Mann von Eurer geistigen Regsamkeit hier zwischen diesen vier Wänden allein mit der alten Negerin seine Tage vertrauern muß. Nun, hoffentlich bessert sich Euer Zustand noch einmal. Was aber meine Person anbetrifft, so könnt Ihr völlig außer Sorge sein. Der Bart verändert mein Gesicht so vollkommen, daß so leicht niemand in dem jetzigen Kapitän der „Ariadne“ jenen Thomas Sinters vermuten wird, der hier jahrelang der Schrecken der Hafenpolizei war.“
Über des Gelähmten Gesicht war bei diesen fast herzlichen Worten ein Freudenschimmer gehuscht. Er hatte Sinters wohlgepflegte Hand in der seinen kräftig geschüttelt und ließ sich jetzt wieder in die Kissen zurückfallen, indem er seinem Gast durch eine Handbewegung bedeutete, in dem Lehnsessel zu Füßen des Bettes Platz zu nehmen.
„Ein Glas Whisky gefällig?“ begann er die Unterhaltung. – „Nicht? – Seid Ihr etwa einem guten Tropfen abhold geworden? Dann wäret Ihr nicht nur auswendig, sondern auch inwendig mächtig verändert, das muß ich sagen.“
„Ich hab’s eilig und wichtige Sachen mit Euch durchzusprechen, Morris. Deshalb wollen wir uns nicht lange aufhalten“, meinte der andere nachdenklich. „Ihr seid mir stets ein treuer Freund und guter Ratgeber gewesen“, fuhr er nach einer Weile fort. „Deshalb bin ich auch heute zu Euch gekommen, um Eure Meinung über einen Plan zu hören, der mich schon seit ungefähr einem Jahre beschäftigt, zu dessen Ausführung mir aber bisher stets die Mittel fehlten. Es ist eine große Sache. Doch damit Ihr alles klar überseht, will ich meinen Bericht möglichst zusammenhängend vortragen. – Auf welche Weise ich hier in Frisko doch noch entkam, nachdem die „Ohio“ uns eingeliefert hatte, wißt Ihr ja. Ihr habt mir selbst die Mittel zur weiteren Flucht vorgestreckt, und diesen Liebesdienst werde ich Euch nicht vergessen. Ich wandte mich dann zuerst nach New York, wo mich dieser verd… Detektiv, den sie mir auf die Fersen gesetzt hatten, aber bald aufspürte. Von New York ging ich nach Südamerika, wo ich mich als Hafenarbeiter verdingen mußte, nur um nicht zu verhungern. Eines Tages, es mag so acht Monate her sein, lernte ich in Valparaiso einen alten Seemann kennen, der in seinen früheren Tagen auch so manchen großen Fischzug auf Kosten derer, die nie alle werden, unternommen hatte. Wir freundeten uns an, und als er erst wußte, mit wem er’s zu tun hatte, wurde er zutraulich und entwickelte mir einen Plan, wie wir beide in den Besitz einiger Tonnen gut gereinigter Goldkörner kommen könnten. Der alte Bill Solmar war nämlich längere Zeit auch da oben in den Minen von Klondyke und kennt das Leben und Treiben dort recht genau. In Dawson hat sich nun eine Gesellschaft von Goldgräbern zusammengetan, die ihre Goldkörner nicht gern einer der dortigen Banken zum Weitertransport nach San Franzisko anvertrauen und die hohen Kosten sparen will. Diese Gesellschaft läßt jährlich zweimal ihre Vorräte an Gold durch einen Frachtdampfer nach Frisko bringen, hält aber die Abfahrtzeit des Schiffes stets sehr geheim, um gewitzten Leuten jede Möglichkeit zu nehmen, einen Überfall auf den „Triton“, so heißt der alte Kasten, vorzubereiten. Bill Solmar gehörte früher auch zu dieser Vereinigung, hat noch heute gute Beziehungen dort oben in Alaska und weiß daher regelmäßig Tag und Stunde, wann der „Triton“ mit seiner wertvollen Ladung die Reise antritt. Der Dampfer verläßt dieses Mal morgen den Hafen von Sitka und soll in zehn Tagen hier in Frisko sein. Ich will Euch nicht lange mit Einzelheiten aufhalten, Morris, sondern nur angeben, wie die Sache heute steht. Erwähnen muß ich jedoch, daß ich mir schon vor einem Jahre von einem Krankenwärter des Hospitals in Vera Cruz die Papiere eines dort am gelben Fieber verstorbenen Schiffskapitäns William Harper für ein recht anständiges Sümmchen besorgt hatte und dann vor sechs Wochen in Valparaiso Gelegenheit fand, mit Hilfe dieser Papiere Kapitän der Vergnügungsjacht „Ariadne“ zu werden, die der Tochter des bekannten Millionärs Weather aus New York gehört. Ich konnte den Posten ruhig annehmen, da ich mir bei meiner vielseitigen Tätigkeit mit den Jahren die genügenden Kenntnisse erworben habe. Und bisher reichten sie auch aus. Denn die „Ariadne“ ist unter meiner Führung glücklich am hiesigen Kai festgemacht worden, nachdem wir immer in anständiger Entfernung hinter der amerikanischen Flotte hergedampft waren. Auf dem Schlachtschiff „Niagara“ befand sich nämlich der Angebetete meiner Gnädigen, den sie gerne für sich kapern möchte. Und dieser Leutnant Sanders ist allein schuld daran, daß wir uns jetzt mit unseren letzten Vorbereitungen für unsere Expedition gegen den „Triton“ mächtig beeilen müssen. Anscheinend hat sich der Leutnant heute nachmittag[2] mit meiner Herrin recht ernstlich entzweit, und sie will nun in ihrem Ärger Frisko Hals über Kopf verlassen. Gerade komme ich vom Hafenamt, wo ich die Abfahrt der „Ariadne“ angezeigt und um einen Lotsen gebeten habe. Diese plötzliche Abreise paßt uns recht schlecht in unseren Kram, da wir uns für die Jacht doch noch eine neue Mannschaft besorgen müssen, eben Jungens, die vor so ein bißchen Seeräuberei nicht zurückschrecken und etwas wagen. – Na, Morris, begreift Ihr nun, wie wir das Ding anfassen wollen?“
Der Irländer schüttelte den roten Kopf. „Sinters, das ist unmöglich! Die Jacht wollt Ihr stehlen?! Habt Ihr Euch auch alle Schwierigkeiten überlegt?“
„Schwierigkeiten? Ihr vergeßt, daß ich Kapitän der „Ariadne“ bin und bei Miß Weather hoch in Ansehen stehe. Was ich ihr vorschlage, tut sie unbedingt. So ist bei unserer Ankunft hier der größte Teil der erst im Frühjahr angeworbenen Besatzung auf meine Veranlassung abgelohnt worden, weil die Jacht zunächst zwei Wochen zur Ausbesserung einer Bodenbeschädigung im Dock liegen mußte und die Leute während dieser Zeit nicht untätig mitgefüttert werden sollten – in Wirklichkeit, damit ich mir nachher die neue Mannschaft selbst aussuchen konnte. Und die habe ich nun auch schon beisammen, trotzdem sie nicht gerade nach dem Geschmack meiner Herrin sein dürfte. Leider sind die braven Jungens aber nicht so leicht abkömmlich, und es wird noch einige Mühe machen, sie glücklich an Bord zu bringen. Nun paßt gut auf, Morris! Wie Ihr wißt, sind keine achthundert Meter von Eurer Farm in einer festen Baracke am Strande der Insel vierundzwanzig Zuchthäusler aus Frisko einquartiert, die mit dem Lossprengen und Behauen von Felsstücken für den Bau der neuen Inselforts beschäftigt werden. Ich habe nun ausgekundschaftet, daß sich auch neun von meinen früheren Leuten und gerade die tüchtigsten Kerle darunter befinden. Auf einige werdet Ihr Euch sicherlich noch besinnen, so auf den langen Sangnassy und den dicken Fred. Ich beabsichtige nun nichts anderes, als diesen vierundzwanzig Mann die Freiheit wiederzugeben und sie mit mir auf die Kreuzfahrt nach Norden zu nehmen. Bill Solmar, der sich schon einige Wochen hier in einer Hafenkneipe aufhält, hat auch bereits die nötige Kleidung, Schiffskisten und Papiere besorgt, so daß es nur noch darauf ankommt, sie aus dieser verwünschten Baracke herauszuholen. Dabei solltet Ihr mir helfen, Morris. – Macht nicht ein so dummes Gesicht, Alter. Ich weiß schon, was Ihr wieder für Bedenken habt. Gewiß – die Kameraden da drüben werden von drei bewaffneten Aufsehern überwacht, außerdem noch von mehreren Bluthunden, die Nachts innerhalb der Palisadenumzäunung frei herumlaufen. Auch führt eine Telephonverbindung nach dem nächsten Inselfort, damit die Wächter sofort Hilfe herbeirufen können, falls ihre Zöglinge einmal rebellieren sollten. Das weiß ich alles, schreckt mich aber nicht ab. Ich brauche die Leute unbedingt. Und wenn nicht diese verwünschte, überhastete Abreise gekommen wäre, so hätte ich schon Mittel und Wege gefunden, mich mit Sangnassy oder Fred in Verbindung zu setzen und mit ihnen das Notwendigste zu vereinbaren. So aber tut jetzt die größte Eile not. Übermorgen früh soll die „Ariadne“ den Hafen bereits verlassen, und bis dahin müssen die Leute an Bord sein! Und deshalb will ich noch heute eine Nachricht nach der Sträflingsbaracke senden.“
„Das klingt ja so, als ob Ihr nur nötig hättet, ein Schreiben durch die Post dorthin bringen zu lassen“, unter brach ihn Morris ironisch. „So einfach dürfte das doch wohl nicht sein, wenn ich auch zugebe, daß es nicht unmöglich ist. Wie wolltet Ihr also die Sträflinge von Eurem Vorhaben verständigend?“
„Darüber möchte ich ja gerade Euren Rat hören“, sagte Sinters unsicher.
Der Irländer dachte eine Weile nach. „Ist’s denn unbedingt notwendig, daß an einen der Jungens in der Baracke Nachricht geschickt wird?“ fragte er nochmals.
„Unbedingt!“ erwiderte Sinters. „Wir können ihnen von außen mit Gewalt keinerlei Hilfe bringen. Einmal fehlen uns dazu die nötigen Leute, und dann darf man das Telephon nicht vergessen, durch das die Wächter bei dem ersten drohenden Anzeichen das nächste Fort alarmieren würden. Leider ist nun die Telephonleitung unterirdisch gelegt, so daß wir sie nicht so schnell auffinden und daher auch nicht zerstören können. Nein, die Leute müssen allein handeln. Nur die Verhaltungsmaßregeln kann ich ihnen geben. Sie brauchen nur morgen abend ihre Wächter im günstigsten Augenblick gleichzeitig zu überfallen und zu knebeln, dann die Hunde zu beseitigen, und sie sind frei. Die Verwandlung in harmlose Seeleute geschieht dann hier in Eurem Haus. Bill Solmar und ich schaffen noch heute nacht[3] die nötigen Kleidungsstücke her“.
„Und das alles wollt Ihr einem Stück Papier anvertrauen, das selbst bei der größten Vorsicht in falsche Hände geraten kann?“ meinte der Irländer zweifelnd. „Ich muß Euch ehrlich gestehen, Sinters, die Sache sieht mir zu gefährlich aus, und ich möchte mich auf meine alten Tage doch lieber nicht an einem solchen Wagnis beteiligen, trotzdem Rosanna den Botendienst sehr gut übernehmen könnte. Denn sie geht in der Baracke dort drüben ungehindert aus und ein, weil sie den Wächtern für die Küche aus unserem Garten das Gemüse liefert und ihnen auch häufig aus Frisko Einkäufe besorgt. Aber, wie gesagt, ein unglücklicher Zufall, und wir spazieren alle drei ins Loch.“
Der Kapitän hatte hoch aufgehorcht. „Also die Rosanna! Ja, so muß es gehen“, meinte er eifrig. „Eure Angst ist ganz überflüssig, Morris. Wenn Ihr meint, daß die Schwarze schlau genug ist, um einem der Jungens, am besten natürlich Sangnassy oder Fred, einen Zettel zuzustecken, so kann ich ihn gleich schreiben. Dann werdet Ihr sehen, daß keinerlei Gefahr dabei ist, weil eben ein Uneingeweihter den Inhalt gar nicht zu entziffern vermag. Ich werde mich unserer alten Zeichenschrift bedienen, die wir früher während unserer hiesigen Tätigkeit benutzten und die allen geläufig war. Sagt mir also, wo ich Papier und Feder finde.“
Nach kaum zehn Minuten war Sinters mit seiner Arbeit fertig. Rosanna wurde hereingerufen, ihr das Notwendigste mitgeteilt, und ebenso erhielt sie auch die genauesten Verhaltungsmaßregeln, damit sie die richtigen Leute herausfinden könne.
„Oh, Mister Sinters soll mit mir zufrieden sein, sehr!“ rief sie hocherfreut und verbarg schnell die zehn Dollar, die der Kapitän ihr in die Hand gedrückt hatte, in ihrer Kleidertasche. „Ich werde mir einen Korb Birnen mitnehmen und es schon so einzurichten wissen, daß ich Sangnassy oder Fred den Zettel übergebe. Die Aufseher lassen mich ja ruhig in der Baracke umhergehen. In einer Stunde bin ich zurück, Mister Sinters.“
3. Kapitel.
Von Piraten entführt.
Das Schicksal wollte es, daß Harry Sanders am nächsten Tage nicht mehr dazu kam, Alice Weather auf der „Ariadne“ zu besuchen. Er war dienstlich bis zum Abend in Anspruch genommen und fand nur noch Zeit, sich in einem kurzen Brief von ihr zu verabschieden. – Die amerikanische Flotte rüstete sich zur Weiterfahrt nach Japan, und während Sanders in den Munitionsräumen der „Niagara“ das Auswechseln der alten Geschoßvorräte gegen neue, aus den Marinedepots gelieferte, überwachte, fand er Muße genug, seine Herzensgefühle einer genauen Prüfung zu unterziehen.
Je länger er über sein Verhältnis zu dem jungen Mädchen nachdachte, desto unzufriedener wurde er mit sich. Schließlich gestand er sich ein, daß nur ihn die Schuld allein traf, wenn Alice jetzt für immer für ihn verloren war. Denn er sagte sich nicht mit Unrecht, daß die junge Millionärin als seine Braut gewiß sehr bald alle ihre kleinen Fehler und Schwächen abgelegt haben würde. Und als er in seinen Gedanken so weit gekommen war, als er sich überlegte, wie heiß sie für ihn empfinden mußte trotz ihres aus so vielen Widersprüchen zusammengesetzten Charakters, da suchte er auch plötzlich nach allerlei Entschuldigungsgründen für jene so auffallende Bevorzugung, mit der sie ihn stets ausgezeichnet hatte und die ihm so unweiblich erschienen war. Hatte doch auch ein törichter, überempfindlicher Stolz ihn selbst dazu verleitet, seinem Glück Hindernisse in den Weg zu stellen, die mehr als schwer zu beseitigen waren, und alles das nur, um ja nicht den Glauben zu erwecken, als ob er aus bloßer Berechnung und ohne ehrliche Neigung sich ihr genähert habe. – Nun, an diesen Dingen ließ sich jetzt vorläufig nichts ändern. Er hatte dem alten Weather feierlich erklärt, daß er erst als wohlhabender Mann wieder um Alice anhalten würde, und sein Wort mußte er unbedingt einlösen. Wie er das anfangen sollte, wußte er freilich noch nicht!
Mißmutig lehnte er an der Wandung des Geschoßaufzuges und schaute gedankenverloren vor sich hin, nickte nur mit dem Kopf, wenn der Bootsmannsmaat ein neues volles Hundert Granaten meldete und in das Munitionsbuch eintrug. Und von der Person der heimlich Geliebten irrte sein Denken weiter ab, hin zu dem Kapitän der „Ariadne“, gegen den er ein unbestimmtes Mißtrauen empfand, das er auch trotz Miß Hopkins beruhigender Worte nicht loswerden konnte.
Als dann endlich gegen zehn Uhr abends die Auswechselung der Munition beendet war, nahm er schnell in der Offiziersmesse einen kleinen Imbiß ein und stieg darauf, bewaffnet mit einem Nachtglase, an Deck, lehnte sich an die Reling und schaute lange nach der Jacht hinüber, deren weißer Schiffskörper in der Dunkelheit noch sichtbar war und deren sämtliche Kajütenfenster in hellstem Licht erstrahlten. Eine große Sehnsucht kam über ihn. Und die Sehnsucht ließ immer mehr gute Vorsätze in ihm ausreifen, ließ ihn auf ein Wiedersehen hoffen, bei dem er Alice alles erklären wollte – alles!
Wohl eine Stunde lang stand er so fast bewegungslos da, starrte durch das Glas nach der „Ariadne“ hin, sah auch, daß zwei Boote an der Jacht anlegten, die von der Insel Yerba Buena her aus der Dunkelheit aufgetaucht und an dem Panzer vorübergerudert waren. Sie schienen dicht bemannt zu sein, und Sanders sagte sich, daß es wohl die neue Besatzung der „Ariadne“ sei, die an Bord gebracht werde, trotzdem er es sich nicht erklären konnte, weshalb man mit den Leuten gerade diesen Weg gewählt hatte.
Als er sich dann gegen Mitternacht zur Ruhe begab, schärfte er seinem Burschen ein, ihn sehr früh zu wecken. Er wollte versuchen, Alice bei der Abfahrt der Jacht noch einen letzten Gruß zuzuwinken. –
Aber eine große Enttäuschung wartete seiner. Als er am Morgen das Deck betrat, war von der „Ariadne“ nichts mehr zu sehen. Von dem wachhabenden Offizier erfuhr er, daß die Jacht bereits vor zwei Stunden die Bai verlassen hatte. –
Am Nachmittag klopfte es plötzlich laut an die Tür von Harry Sanders Kabine. Dieser hatte gerade vor dem kleinen Klapptischchen gesessen und, um seine trüben Gedanken abzulenken, in einem Wörterbuch der japanischen Sprache geblättert. Die Störung kam ihm höchst unwillkommen. Er befand sich nicht in der Stimmung, mit irgend einem sich langweilenden Kameraden vielleicht über gleichgültige Dinge zu plaudern. Daher klang sein Herein wenig freundlich.
Der Eintretende, Oberleutnant Riley, Kommandant des Torpedobootszerstörers „Cleveland“ und ein alter Bekannter Sanders, beachtete jedoch weder des Freundes verdrossenen Gesichtsausdruck noch die kühle Begrüßung, begann vielmehr sofort, indem er seine Hand wie beschwichtigend auf Sanders Schulter legte: „Harry, ich komme in einer sehr ernsten Angelegenheit zu Dir. Ich weiß, daß Du Alice Weather liebst. Erschrick nicht – die „Ariadne“ ist in der letzten Nacht von einer Seeräuberbande entführt worden.“
Sanders sprang entsetzt auf. Aus seinem Gesicht war jede Spur von Farbe gewichen. Aber mit übermenschlicher Energie zwang er sich zur Ruhe, und seine erste hervorgebrachte Frage zeigte, wie alle seine Gedanken nur der Geliebten gehörten: „Und Alice? Ist sie noch auf der „Ariadne“?“
„Wir müssen es leider annehmen“, entgegnete der Oberleutnant. Sekundenlang war’s totenstill in der engen Kabine. Dann ließ Sanders sich schwer in den Stuhl zurückfallen.
„Erzähle, was Du weißt, Riley“, sagte er dumpf. „Schone mich nicht. Ich will alles wissen, damit ich helfen kann. Denn irgendetwas muß doch geschehen – muß!“ schrie er verzweifelt auf und schaute den anderen fast drohend an.
„Fasse Dich, Harry“, bat der Oberleutnant begütigend. „Ich komme ja soeben direkt von dem Flaggschiff, wo ich von dem Admiral und einem höheren Polizeibeamten den ganzen Sachverhalt erfahren habe. Ich soll mit der „Cleveland“ sofort die Verfolgung aufnehmen. Zum Glück wissen wir so ziemlich, wo wir die „Ariadne“ zu suchen haben.“
„Aber, was wird aus Alice, was kann nicht alles inzwischen geschehen! Nein – nein, das ist ja gar nicht auszudenken“, stöhnte Sanders auf und vergrub sein Gesicht in den zitternden Händen.
„Harry, mein Junge, auf diese Weise hilfst Du ihr nicht! Geh lieber zu Deinem Kommandanten und bitte ihn um Urlaub. An Bord der „Cleveland“ bist Du jetzt besser am Platz als hier in dieser Kabine. Meinst Du nicht auch?“
Sanders begriff. „Ja, ich begleite Dich, Riley“, rief er heiser.
* * *
Eine Stunde später verließ der Torpedobootszerstörer seinen Ankerplatz und dampfte mit halber Fahrt dem Goldenen Tor zu. Die untergehende Sonne flammte in feuriger Lohe über den kalifornischen Bergen, und ihr rötlicher Widerschein lag in zuckenden Lichtblitzen auf den Wassern der Bai, die der scharfe Bug des schlanken Kriegsschiffes durchschnitt. Auf der Kommandobrücke stand neben Oberleutnant Riley Harry Sanders, der sich die Geliebte zurückerobern wollte.
Kaum hatte der Zerstörer die offene See erreicht, als er sich auch schon in scharfem Bogen nach Norden wandte. Noch ein Klingelzeichen hinab in den Maschinenraum, und die hohe Heckwelle, die wie ein Wasserberg der „Cleveland“ folgte, zeigte an, daß die Schrauben jetzt mit voller Kraft die Wogen des Großen Ozeans schlugen.
Langsam sank die Dämmerung herab und hüllte das Festland von Amerika in graue Schleier ein, in denen es bald ganz verschwand. Und in der feierlichen Stille dieser endlosen Wasserwüste, in der nichts als das dumpfe gleichmäßige Stampfen der Maschinen und hin und wieder der Schrei eines dem Lande zustreichenden Vogels zu hören war, erzählte Riley dem Freunde noch näher, was er vor wenigen Stunden an Bord des Admiralschiffes über den verwegenen Anschlag auf die „Ariadne“ erfahren hatte.
„Es handelt sich um ein mit größtem Raffinement vorbereitetes Verbrechen“, begann er. „Und nur der Geschicklichkeit der Polizei, besonders der Klugheit eines Detektivs Wilson, haben wir es zu danken, daß es so schnell entdeckt wurde, wenn schließlich auch ein glücklicher Zufall dabei eine Rolle spielt. Auf der Felseninsel Yerba Buena befindet sich nämlich eine Sträflingskolonie, deren Aufseher alle vierzehn Tage abgelöst werden. Als nun heute vormittag die zur Ablösung bestimmten drei Wärter sich der Baracke näherten, in der die Sträflinge untergebracht waren, stand das Tor der Umzäunung weit offen, und die vier großen Bluthunde lagen mit zerschmetterten Schädeln auf dem Hofe. Die drei Aufseher aber fand man gefesselt und mit Knebeln im Mund in einer kleinen Kammer neben der Küche. Sie konnten nur berichten, daß sie am Abend vorher von den Sträflingen plötzlich überfallen und nach kurzer Gegenwehr überwältigt worden waren. Zunächst erschien es unerklärlich, wie den Verbrechern dann die weitere Flucht geglückt sein konnte. Schließlich fiel es einem der Aufseher ein, daß am verflossenen Abend eine alte Negerin, die zu der einzigen auf Yerba Buena gelegenen Farm gehört, nach der Baracke gekommen war und sich längere Zeit in der Küche aufgehalten hatte, wo einige Sträflinge mit Kartoffelschälen beschäftigt und dabei eine Weile ohne Aufsicht geblieben waren. Diese sichere Spur nahm der Detektiv Wilson sofort mit allem Eifer auf. Man verhörte die Negerin und den alten gelähmten Besitzer der Farm, einen Irländer, beide stellten sich aber völlig harmlos an, und es kostete viele Mühe, die Schwarze endlich zum Reden zu bringen. Der Kapitän der „Ariadne“, nebenbei ein Mensch von guter Erziehung, der seinerzeit sogar Maschinenbaufach studiert hat, ist nämlich niemand anders als ein gewisser Thomas Sinters, dessen Bande vor ungefähr drei Jahren den Hafen von San Franzisko unsicher machte und dem Wilson seitdem dauernd auf der Spur ist, ohne ihn jedoch fangen zu können.“
„Hätte ich nur Miß Hopkins Rat sofort befolgt und mich über ihn erkundigt!“ unterbrach ihn hier Sanders ärgerlich. „Wer weiß, ob dann dieser Schurkenstreich nicht zu verhüten gewesen wäre!“
„Sicherlich wäre alles anders geworden, wenn Du über den angeblichen Harper Erkundigungen eingezogen hättest“, meinte Riley. „Doch die Selbstvorwürfe helfen jetzt nichts mehr. Harper oder Sinters, wie Du ihn nennen willst, hat es ja leider fertig gebracht, seine alten Spießgesellen als die neue Besatzung der „Ariadne“ an Bord zu bringen. Es ist kein Zweifel, daß er jetzt einen Anschlag gegen den fälligen Golddampfer plant, der vorgestern den Hafen von Sitka verlassen hat. Aber wir werden ihm das Handwerk legen. Kopf hoch, mein Junge! Wir werden die Jacht sicherlich finden!“
Mit einem guten Nachtglase bewaffnet, verharrte Sanders die ganze Nacht über an Deck und suchte das Meer nach einem hellgestrichenen Schiffskörper ab, auf dem sich Alice Weather inmitten einer Bande verruchter Verbrecher befand. Jedes Schiff, das gesichtet wurde, mußte sich ein strenges Verhör von dem Kriegsfahrzeug gefallen lassen. Aber immer kam die gleiche Antwort: niemand war der „Ariadne“ begegnet.
So verging auch der nächste Vormittag. Da tauchte einige Seemeilen seitwärts der „Cleveland“ ein Boot auf, das eifrig Notsignale mit einem Segel herüberwinkte. Sofort wurde der Kurs geändert, und eine halbe Stunde später kletterten der Steuermann und sechs Leute der „Ariadne“, die Harper als einzige in San Franzisko nicht entlassen hatte, am Fallreep empor an Bord. Was der Steuermann den beiden Freunden erzählte, war geeignet, Sanders wenigstens einigermaßen seine Seelenruhe wiederzugeben.
„Sehen Sie, Mister Sanders, das war Ihnen eine Überraschung, als mir am Abend so gegen zehn Uhr dieser Schurke plötzlich mit dem Revolver in der Hand in seiner Kajüte auf unserer Jacht bedeutete, daß ich mir von seinen sauberen Genossen hübsch ruhig die Hände zusammenbinden lassen sollte, sonst würde er mir ein Loch durchs Hirn blasen. Ich mußte stillhalten und wurde dann ins Vorschiff in ein enges Loch geworfen. Und die sechs Leute von der alten Besatzung, die ich jetzt mitgebracht habe, hatten genug zu staunen gehabt über die neuen Kameraden, wagten aber nichts zu sagen. Und heute morgen verlud er uns dann mit den besten Segenswünschen in das Boot, da wir ihm wahrscheinlich unbequem waren. Das Maschinenpersonal mußte er freilich behalten. Aber im Maschinenraum stehen einhalb Dutzend von den Spitzbuben mit geladenen Pistolen in der Hand und passen auf, daß der „Ariadne“ nicht der Dampf ausgeht. Bin nur neugierig, wo der Harper unsere Herrin und die Miß Hopkins absetzen wird. Ein Leid zufügen wird er den Damen wohl nicht, Mister Sanders, da können Sie ganz ruhig sein. Werden sogar an Bord mit allem Respekt behandelt. Und als wir mit dem Boot vor ungefähr sieben Stunden von der „Ariadne“ losmachten, da stand Miß Weather auf dem Promenadendeck und winkte uns zu. Sah recht blaß aus, unsere Herrin, aber sonst ganz gefaßt. – Nun, wir werden unsere „Ariadne“ ja wohl bald wiederhaben, schätz’ ich!“
Riley drückte dem Freunde stumm die Hand, als sie wieder allein waren.
„Ich weiß, daß Du Dich mit mir über diese Nachricht freust“, sagte Sanders herzlich. „Wirklich, mir ist eine Zentnerlast vom Herzen genommen.“ Nachdenklich schaute der Oberleutnant vor sich hin. „Ich glaube nicht, daß wir die „Ariadne“ so bald finden werden.“
Sanders nickte. „Ich bin ganz Deiner Ansicht, Riley. Nach der Jacht ziellos umhersuchen, hat keinen Zweck. Das vernünftigste wäre, dem „Triton“ entgegenzufahren und ihn zu begleiten. Auf diese Weise kann uns die „Ariadne“ sicher nicht entgehen.“
„Das habe ich mir auch schon überlegt. Wird wohl das richtigste sein. Die „Cleveland“ läuft übrigens ihre vierundzwanzig Knoten, die „Ariadne“ kaum achtzehn. Da holen wir sie sicher ein, wenn wir einmal ihre Spur haben. Also Kopf hoch, mein Junge!“
* * *
Die Dampferlinie Sitka–San Franzisko läuft parallel der Westküste von Nordamerika. In bestimmten Zwischenräumen läßt eine amerikanische Reederei einen Dampfer für Fracht- und Personenverkehr nach Sitka abgehen, ohne allerdings in neuerer Zeit besonders auf ihre Rechnung zu kommen, da der Zuzug von Goldgräbern nach Alaska schon bedeutend nachgelassen hat. Handelsschiffe trifft man nördlich von Kap Flattery kaum noch an, und so verlief auch die Fahrt der „Cleveland“ zunächst äußerst eintönig. Als das Schiff nach zwei Tagen auf die Höhe der Vancouverinsel gekommen war, ließ Riley in weiten Schlägen hin und her kreuzen, da man nach seiner ungefähren Berechnung dem „Triton“ hier begegnen mußte.
Diese Maßregel erwies sich als durchaus notwendig, da der Golddampfer tatsächlich über dreißig Meilen östlich von der eigentlichen Tourlinie gesichtet wurde und daher leicht unbemerkt hätte vorüberlaufen können. Nachdem zwischen den beiden Schiffen ein lebhafter Bootsverkehr stattgefunden hatte, trennten sie sich wieder. Die „Cleveland“ dampfte nordwärts und verschwand bald am Horizont, während der „Triton“ die unterbrochene Reise nach San Franzisko fortsetzte.
4 Kapitel.
An Bord der „Ariadne“.
Auf dem Promenadendeck der „Ariadne“ lehnte Alice Weather neben Miß Hopkins, die in den letzten Tagen infolge der beständigen Angst und Aufregung womöglich noch dünner geworden war, an der Reling und schaute mit umflorten Augen auf die in majestätischer Ruhe heranziehenden Wellen, zwischen denen die Jacht wie in einer mächtigen Wiege geschaukelt wurde, als Harper sich langsam näherte und mit höflichem Gruß neben sie trat.
„Miß Weather“, begann er mit leichter Ironie in dem harten Tone seiner Stimme, „wenn ich auch zugebe, daß Sie einigen Grund haben, mich völlig als Luft zu behandeln, so müssen Sie sich jetzt doch schon in Ihrem eigenen Interesse überwinden und mir zuhören. Vielleicht bemerken Sie schon mit bloßem Auge jenen Rauchstreifen dort vor uns am Horizont – bitte, etwas mehr westlich. – So, danke! Dieser Rauch entsteigt dem Schornstein eines Frachtdampfers, der in seinem Raum eine wertvolle Ladung birgt, eine sehr wertvolle Ladung sogar. Da ich nun ein vorsichtiger Mensch bin und jener Dampfer nicht mehr zu den seetüchtigsten gehört, so habe ich mir die „Ariadne“ für einige Zeit von Ihnen – entlehnen müssen, um von dem „Triton“ dort die kostbaren Frachtgüter auf unsere bedeutend seefestere Jacht überzunehmen. Das wird sehr bald geschehen sein, ich denke in etwa einer Stunde. Höchstwahrscheinlich dürfte aber die Besatzung jenes Dampfers mit dieser Umladung nicht ganz einverstanden sein, und es könnte dann zu erregten Erörterungen kommen, wobei ebenso wahrscheinlich auch einige Schüsse fallen werden. Erschrecken Sie also nicht! Hoffentlich habe ich durch diese vorherige Benachrichtigung dazu beigetragen, die Nerven der teuren Miß Hopkins zu schonen.“
Harper machte eine kleine Pause. Vielleicht nahm er an, daß Alice Weather, die von den eigentlichen Absichten des Kapitäns bisher nichts ahnte, ihn jetzt mit einer Flut von Vorwürfen überschütten würde; aber das junge Mädchen schürzte nur noch hochmütiger die Lippen und starrte weiter geradeaus in die Wogen, ohne von dem dicht neben ihr Stehenden irgendwelche Notiz zu nehmen.
Miß Hopkins aber drückte ängstlich Alices Arm und flüsterte ihr zu: „Geben Sie doch eine Antwort, Sie reizen ihn ja nur unnötig!“
Doch kein Ton wurde laut.
Da glomm in Harpers stechenden Augen ein höhnisches Flackern auf, und mit einer Stimme, aus der deutlich herauszuhören war, welche Genugtuung er empfand, die stolze Millionärin so demütigen zu können, sagte er: „Ich gedenke dann diese Frachtgüter in einer stillen Bucht der Vancouverinsel an Land zu bringen, Miß Weather. Ist diese Arbeit getan, so könnte ich Ihnen auch die „Ariadne“ wieder übergeben, die ich nicht mehr brauche und die von dem Maschinenpersonal leicht in den nächsten Hafen gesteuert werden kann. Ich hoffe aber, Sie werden sich mir gegenüber für die liebenswürdige Behandlung hier an Bord meiner Jacht – denn jetzt bin ich Herr des Schiffes – erkenntlich zeigen und mir nicht nur Ihre Schmucksachen und Ihr Bargeld aushändigen, sondern auch auf folgenden Vorschlag eingehen: – Ich gebe Sie und die „Ariadne“ frei, behalte jedoch Miß Hopkins so lange bei mir in einem guten Versteck, bis Sie mir – Sie allein, Miß Weather – in der Bai von San Franzisko an der Nordspitze der Insel Yerba Buena, wo das Seezeichen am Strand steht, die Summe von Dreihunderttausend Dollar in guten Scheinen überreicht haben. Als Termin für die Übergabe des Geldes setze ich den Tag morgen über drei Wochen fest. Sollten Sie sich an diesem Tage nicht an dem einsamen Gestade der kleinen Insel einfinden oder inzwischen irgendeinen Verrat planen, so gebe ich für die Sicherheit von Miß Hopkins keinen Pfifferling mehr. Meine Jungens verstehen wirklich keinen Spaß, und das Leben Ihrer Gesellschaftsdame wird Ihnen die für Sie so geringe Summe doch wohl wert sein! – Wie gesagt, Miß Weather, wagen Sie kein Verrat! Ich warne Sie!“
Mit einem Schreckensschrei war Miß Hopkins ihrem Schützling in die Arme gesunken, halb ohnmächtig, nicht fähig, irgendein weiteres Wort hervorzubringen. Und so, die zitternde Gestalt des alten Fräuleins umschlungen haltend, die jeden Augenblick zusammenzusinken drohte, stand Alice dem höhnisch lächelnden Kapitän gegenüber.
Aber selbst in dieser unwürdigen, schmachvollen Lage bewies das junge Mädchen eine Beherrschung und schnelle Entschlußfähigkeit, die Harper um den größten Teil des Genusses einer erhofften Demütigung kommen ließ. Wenn auch mit bebender Stimme, so doch mit stolzer Würde in ihrer Haltung erwiderte sie ihm: „Sie sollen alles erhalten, was Sie verlangen. Morgen über drei Wochen ist auch die geforderte Summe in Ihren Händen. Aber ich setze voraus, daß Sie Miß Hopkins während dieser Zeit mit jeder Rücksicht behandeln. Und nun – verlassen Sie mich!“
Während sie sprach, hatten ihre Augen an ihm vorüber ins Leere geschaut. Kein Blick traf den Schurken. Dann führte sie die leise vor sich hinweinende Miß zu dem nächsten Liegestuhl, der im Schutze des hohen Kajütenaufbaues stand, und bettete sie fürsorglich in die weichen Kissen und Decken, indem sie ihr beruhigende Worte zuflüsterte.
Harper hatte sich mißmutig zurückgezogen und besprach nun auf dem Vorschiff mit Bill Solmar den Erfolg seiner Unterredung. „Der ist nicht beizukommen, Bill – hol’s der Henker! Eine Abfuhr habe ich erhalten, daß ich alles kurz und klein schlagen möchte. Wie eine Königin stand sie vor mir, so unnahbar und stolz. – Na, die Hauptsache bleibt, auf ihr Wort kann man sich verlassen, und wir beide machen noch nebenbei ein gutes Geschäft, von dem die andern nichts wissen“, setzte er wie sich selber zum Troste hinzu.
Bald hatte sich auch Miß Hopkins etwas erholt. Kaum war sie aber wieder fähig, ihre Stimme zu gebrauchen, als sie sich in weinerlichen Anklagen gegen Harry Sanders erging, der nach ihrer Ansicht allein an diesem Unglück schuld war. „Hätte er sich damals auf dem Tennisplatz nachgiebiger gezeigt, so wären Sie sicherlich nicht auf die Idee verfallen, so plötzlich unsere Abreise anzuordnen“, meinte sie empört. „Und dann hätte Harper niemals Gelegenheit gehabt, uns in dieser Weise zu verraten! Ich werde noch vor Angst sterben, wenn ich allein in den Händen dieser Verbrecher bleibe!“
Alice hörte sich dieses weinerliche Gerede ihrer Gesellschaftsdame schweigend an. Schließlich unterbrach sie sie jedoch sehr energischen Tones.
„Sie tun Harry bitter Unrecht, liebe Hopkins, glauben Sie mir. Wenn überhaupt das Zerwürfnis zwischen uns als Ursache des Handstreichs gegen die „Ariadne“ in Frage kommen kann, so bin ich allein der schuldige Teil. In den einsamen Stunden der letzten Tage, als die Angst um unser ferneres Schicksal mein ganzes Innere aufgerührt hatte, habe ich Zeit genug zum Nachdenken und Abrechnen mit mir selbst gehabt. Ich glaubte Harry bewegen zu können, seinen Plan, erst später nochmals um meine Hand bei meinem Vater anzuhalten, aufzugeben, und wandte dazu Mittel an, die ihn abstoßen mußten, ihn, der wahrlich genug Feingefühl besitzt, um beurteilen zu können, wie weit ein Weib in den Äußerungen ihrer Liebe gehen darf. Und seien Sie überzeugt, liebe Hopkins, ich werde mich nicht scheuen, ihm das alles bei unserer nächsten Begegnung zu sagen, selbst auf die Gefahr hin, daß er sich nur um so ablehnender verhält. Diese letzten Tage hier auf der „Ariadne“ sind für mich eine heilsame Kur gewesen, die mit meinen Schmucksachen und dem Gelde wirklich nicht zu teuer bezahlt ist.“
Sie wollte noch mehr hinzufügen, aber der gellende Pfiff der Dampfsirene ließ sie erschreckt schweigen. In demselben Augenblick verlangsamte sich die Fahrt, und Alice, die schnell an die Reling getreten war, bemerkte jetzt kaum dreihundert Meter vorwärts einen Dampfer, mit dem die Jacht Flaggensignale austauschte. Flatternd stiegen die bunten Wimpel an dem Signalmast der „Ariadne“ empor, und drüben antwortete man in gleicher Weise.
Harpers Plan schien über Erwarten gut gelingen zu wollen. Der Kapitän des „Triton“ hegte scheinbar keinerlei Argwohn und ließ die so harmlos aussehende Vergnügungsjacht, die ihn um die Abgabe einiger Fässer mit Trinkwasser bat, bei der wenig bewegten See ruhig längsseits kommen.
Kaum aber lagen die Schiffe nebeneinander, als sie auch schon vertaut wurden und nun mit abgestoppten Maschinen fest verbunden auf dem einsamen Ozean schaukelten.
Klopfenden Herzens wartete Alice, die furchtlos dicht an der Reling stehen geblieben war, das weitere ab. Von ihrem Platz aus konnte sie das Verdeck des Frachtdampfers bequem überschauen, auf dem nur wenige Matrosen zu sehen waren, während der alte, grauhaarige Kapitän neben dem Steuermann auf der Kommandobrücke ahnungslos seine kurze Pfeife schmauchte.
Hilfesuchend ließ das junge Mädchen seine Augen blitzschnell über den Horizont hinschweifen. Aber nirgends, nirgends war der graue Rauchstreifen oder die weiße Takelage eines sich nähernden Schiffes, nirgends ein Retter zu sehen, der den „Triton“ vor der Plünderung geschützt hätte! Und jetzt schwangen sich plötzlich zwanzig mit Beilen und Messern bewaffnete Leute von der „Ariadne“ mit Blitzesschnelle auf den wehrlosen Frachtdampfer hinüber, allen voran Harper, den Revolver in der Rechten.
Voll Teilnahme blickte Alice auf den so sorglosen Kapitän des „Triton“, dessen Leben vielleicht nur noch nach Sekunden zählte, wenn er auch nur den geringsten Widerstand wagte. Konnte sie ihren Augen trauen? Auf dem verwitterten Gesicht des alten Seemanns lag ein behagliches, schadenfrohes Lächeln. Keine Spur von Überraschung oder Bestürzung zeigte sich darin. Und ebenso seelenruhig stand der Steuermann neben ihm.
Die Erklärung für diese auffallende Gleichgültigkeit kam schneller als sie denken konnte. Plötzlich durchgellten wilde Schreie, verworrene Angstrufe die Luft. Aber alle Stimmen wurden von einer einzigen übertönt, bei deren Klang Alice eine Ohnmacht zu überfallen drohte, so daß sie sich nur mühsam an der Reling aufrecht hielt.
„Ergebt Euch, Leute!“ donnerte diese Stimme. „Ihr seht, Ihr seid umstellt. Werft die Waffen fort, sonst lasse ich Feuer geben!“
Einen Blick nur warf Alice auf das Deck des „Triton“, auf dem die Eindringlinge jetzt verdutzt dastanden und ihnen gegenüber wohl dreißig amerikanische Blaujacken, die Gewehre schußfertig im Arm. Zwischen beiden Parteien die schlanke Gestalt eines Offiziers, eine Gestalt, die das junge Mädchen nur zu gut kannte. Da hätte Alice Weather am liebsten in Ihrem Herzensjubel die Arme ausgebreitet und ihr ganzes Sehnen nach dem Geliebten in dem einen Wort: „Harry“! hinausgerufen.
Aber sie preßte die Lippen fest aufeinander. Nicht einmal die Hand hob sie zum Gruß. So nahe vor der Entscheidung hatte sie plötzlich ein zagender Kleinmut befallen. Wenn er sie nun doch nicht liebte, wenn er ihr jetzt vielleicht mit seiner kühlen Ruhe entgegentrat, höflich und gemessen, wie er’s damals bei dem Abschied vor fünf Tagen gewesen war, – nein, das würde sie nicht ertragen, das nicht! Und beinahe schwankend, schritt sie auf Miß Hopkins zu, die ihr Gesicht, nur um nichts zu sehen und zu hören, in den Kissen verborgen hatte. Aufschluchzend vor Herzenspein sank sie neben dem Liegestuhl in die Knie, weinte dann still in sich hinein, indem sie Miß Hopkins wie schutzsuchend umklammert hielt.
Minuten, angstvolle Minuten vergingen so. Und dann hörte sie plötzlich einen festen Schritt, hörte ihren Namen nennen. – Sie blickte auf.
Harry Sanders stand vor ihr, streckte ihr jetzt herzlich die Hand zum Gruße hin.
„Ich freue mich, daß es mir vergönnt war, Sie aus dieser gefährlichen Lage zu befreien“, sagte er einfach.
Sie erhob sich schnell. Leuchtenden Blickes bat sie ihn dann, seine Hand noch immer in der ihren haltend …
„Kommen Sie, Harry, – lassen Sie uns in meinen Salon gehen. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen …“
Federnden Schrittes eilte sie ihm voraus.
Dann waren sie allein, ganz allein in dem mit lichtblauer Seide ausgeschlagenen Raume mit den eleganten, zierlichen Möbeln.
Lange, eindringlich sprach die junge Millionärin auf den Geliebten ein, und stumm hörte er ihr zu. Sein frisches Gesicht wurde immer ernster, immer verschlossener.
Als sie dann nichts mehr zu sagen wußte und stürmisch klopfenden Herzens seiner Antwort harrte, die ihres Erachtens nur darin bestehen konnte, daß er sie aufjubelnd in die Arme schloß, erlebte sie eine herbe Enttäuschung.
„Daß ich Sie liebe, Alice, wissen Sie“, sagte er jetzt ernsten und bestimmten Tones. „Was Sie mir soeben vorschlugen, kann ich unmöglich ausführen. Sie kennen mich noch immer nicht genügend. Gewiß – auch ich glaube ja, daß Ihr Vater nach diesen letzten Vorfällen mir schon aus Dankbarkeit Ihre Hand nicht verweigern würde. Aber gerade das ist es, womit sich mein Stolz nie einverstanden erklären wird. Aus Dankbarkeit Sie zum Weibe erhalten, – nie und nimmer! Bedenken Sie: Ich gab mein Wort, daß ich mich Ihnen erst dann wieder nähern würde, wenn ich bewiesen habe, daß ich mehr als ein simpler Marineleutnant, eben ein findiger, energischer Kopf bin, der, wie Ihr Vater sich echt amerikanisch ausdrückt, – „Geld zu machen versteht“. Mein Wort bleibt bestehen. Ich habe jetzt bereits meinen Abschied eingereicht und werde meine Laufbahn als Ingenieur wieder aufnehmen. Ein Ziel schwebt mir vor Augen: Sie, Alice, Sie …! Um Ihretwegen werde ich arbeiten, mich mühen, – Tag und Nacht! – Habe ich dann erreicht, was mir vorschwebt, so … kehre ich zurück zu Ihnen! Bis dahin, Alice, bleiben wir nichts als gute Freunde …!“
Sie nagte mit gekrauster Stirn die Unterlippe.
„Darüber können Jahre vergehen, Jahre …!“ stieß sie endlich hervor.
„Sind wir nicht jung?“ meinte er innig. „Mein Herz wird Ihnen immer gehören, immer …!“
Tränen traten ihr in die Augen.
„Ist das Ihr unwiderruflicher Entschluß, Harry?“ fragte sie leise.
„Ja. Ich kann nicht anders handeln“, erwiderte er ohne Zaudern.
„Dann – dann lieben Sie mich auch nicht so, wie Sie’s vorgeben“, rief sie mit blitzenden Augen. „Bedenken Sie, wie Sie eben meinen Mädchenstolz verletzt haben, – wie sehr! Ich mache Ihnen einen Vorschlag, der uns in kurzer Zeit für immer vereinen kann. Was tun Sie …? – Sie weisen ihn zurück, verschanzen sich hinter Ihrem sogenannten Stolz, der doch nichts ist als … übertriebenes Ehrgefühl! Sie sind mir unverständlich, nie werde ich Sie begreifen! Gehen Sie, – unsere Wege trennen sich mit dem heutigen Tage. Nicht Liebe spricht aus Ihrem Verhalten, sondern kleinlicher Trotz …“
„Alice …!“ Bittend, mahnend war seine Stimme.
„Gehen Sie …!“ Wie ein Aufschrei war’s.
Da wandte er sich langsam zur Tür. Langsam schritt er die Treppe zum Verdeck empor und begab sich auf den Dampfer zurück.
In dem lichtblauen Salon aber schluchzte Alice Weather herzzerbrechend.
Nie hätte sie diesen Ausgang vermutet, nie …! –
Am Abend desselben Tages aber antwortete sie Miß Hopkins, die endlich nach dem Ausgang der Unterredung zu fragen wagte, in schlechtester Laune …
„Sprechen Sie mir nie mehr von Harry, ich bitte Sie …! Zwischen uns ist alles aus. Heute habe ich zum erstenmal einem Manne gegenüber mich gedemütigt. Zum zweitenmal geschieht es nicht …!“
* * *
Als die „Cleveland“ nach drei Tagen gegen Morgen mit den in Eisen gelegten Verbrechern in San Franzisko eintraf, stellte es sich heraus, daß Thomas Sinters noch im letzten Augenblick entkommen war. Seine Handschellen hatte er durchgefeilt, war dann durch einen der Ventilatoren an Deck geklettert, von wo er sich fraglos in die See hinabgelassen und die nahe Küste schwimmend erreicht hatte. Seine Flucht wurde durch das trübe, regnerische Wetter begünstigt, welches den Wachtposten eine genaue Beobachtung des Decks unmöglich machte. Trotzdem sofort eine eifrige Verfolgung eingeleitet worden war, vermochte die Polizei des Flüchtlings doch nicht habhaft zu werden. Dieser hatte sogar noch die Frechheit besessen, an Harry Sanders einen Brief zu schreiben, in dem er dem Leutnant mit seiner Rache drohte.
„Sie haben mir meine Pläne zerstört! Dafür sollen Sie gestraft werden! Thomas Sinters wird Ihren Spuren folgen, wohin Sie auch gehen! Hüten Sie sich!“ – So hieß es in dem Schreiben, das in einem kleinen Örtchen Kaliforniens aufgegeben war.
Als Fred Wilson, jener Detektiv, der den Führer der Hafenpiraten nun schon jahrelang vergebens zu fassen gesucht hatte, diesen Brief von seinem Chef ausgehändigt erhielt, reiste er schon am nächsten Tage nach dem kalifornischen Städtchen ab.
„Es ist immerhin der Anfang einer Spur“, meinte er ingrimmig. „Zweimal ist dieser Mensch nun schon entkommen! Zum drittenmal wird es ihm nicht glücken, – wenn ich ihm nur erst wieder auf der Fährte bin.“
5. Kapitel.
Der schlafende Fakir.
Mehr als ein Jahr ist seit den letzten Ereignissen verstrichen. Harry Sanders hatte Alice Weather seit jener denkwürdigen Unterredung im blauen Salon der „Ariadne“ nicht wiedergesehen und nur gelegentlich aus Zeitungsberichten etwas von ihr gehört.
So wußte er, daß sie ihre Jacht, an die sich für sie so viele unangenehme Erinnerungen knüpften, verkauft, ferner daß die vielgeplagte Miß Hopkins sich in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hatte. – –
Ein Privatkontor mit wuchtigen, schweren Eichenmöbeln. Zwei Männer sitzen sich an dem großen Mitteltisch gegenüber.
Harry Sanders hatte soeben seinen übersichtlichen und alle Schwierigkeiten seines Planes so überzeugend beseitigenden Vortrag beendet und wartete nun mit leicht begreiflicher Spannung auf die Entscheidung seines Chefs.
Dieser, der Besitzer der im ganzen Osten Nordamerikas bekannten Firma W. Hawkens, Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen, Cincinnati, schaute jetzt seinem jungen Ingenieur mit einem Blick in das bartlose Gesicht, der zugleich Staunen und Achtung enthielt.
„Ich gestehe Ihnen ehrlich ein“, sagte er mit leisem Schmunzeln, „diesen verwegenen Unternehmungsgeist hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Sanders! Die Art, wie Sie den Grundstock zu späteren Reichtümern legen wollen, die Sie bei Ihrer mir soeben offenbarten genialen Erfindungsgabe und Tatkraft sicher noch erwerben werden, imponiert mir, würde sicher jedem amerikanischen Geschäftsmann imponieren. Ihr Vorhaben ist wirklich geistreich ausgeklügelt und verspricht auch den erhofften Erfolg, wenn … Aber wozu soll ich Ihnen nochmals all die Hindernisse aufzählen, die auch hier zwischen Wagen und Gelingen liegen! Ihre Gerissenheit wird sie schon zu umgehen wissen. Riskant freilich ist die Geschichte, das ist nicht abzuleugnen! Aber ich nehme dieses Risiko auf mich! – Hier meine Hand, Sanders, Sie sollen die gewünschte Summe von mir als Darlehn zu dem üblichen Zinsfuß erhalten und lassen mich dafür als Entgelt für mein Risiko mit dem fünften Teil am Gewinn teilnehmen. Eine Anweisung über fünfzigtausend Dollar wird wohl zunächst genügen. Und von heute ab sind Sie bis auf weiteres mit vollem Gehalt beurlaubt. – So – und nun viel Glück auf den Weg!“
– – – – – – – –
Sechs Wochen später, Ende Mai des Jahres 1912, wurde dem Direktor der Gewerbeausstellung in Cleveland, der nordamerikanischen, am Eriesee gelegenen Fabrikstadt, von einem Bureaudiener eine Karte überreicht, die folgenden Aufdruck hatte:
„Franklin Houster, Impresario des berühmten schlafenden Fakirs Tuma Rasantasena“.
Und einige Minuten später saß ein junger, schlanker Mann, dessen Augen durch eine große graue Brille verdeckt waren und der einen starken Vollbart hatte, dem Leiter des Riesenunternehmens, das am 15. Juni eröffnet werden sollte, in dem geräumigen Geschäftszimmer gegenüber.
„Sie wünschen, Herr Houster?“ fragte der vielbeschäftigte Direktor Singleton ungeduldig und drehte nervös die Visitenkarte des Besuchers zwischen den Fingern. „Ich habe wenig Zeit. Also fassen Sie sich kurz.“
Den Impresario ließ dieser nicht gerade vielversprechende Empfang völlig kalt.
„Wen Sie vor sich haben, Herr Singleton, hat Ihnen meine Karte bereits gesagt“, entgegnete er mit dem ruhigen, unaufdringlichen Selbstbewußtsein eines von seinem Wert überzeugten Mannes. „Ich komme, um Ihnen Tuma Rasantasena für die Ausstellung als hervorragende Attraktion anzubieten. – Bitte, hören Sie mich erst an, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Sie können sich wohl denken, daß ich es niemals wagen würde, Ihnen eine Offerte zu machen, die nicht wirklich etwas Aussichtsvolles enthält. Gestatten Sie, Ihnen zunächst in Kürze mitzuteilen, wie ich den Fakir kennen lernte und Gelegenheit fand, mich von seinen merkwürdigen Fähigkeiten zu überzeugen.
Ich bin eigentlich Ingenieur. Als solcher war ich im vorigen Jahr in Indien bei dem Bau einer Eisenbahnlinie beschäftigt, die als Abzweigung der Hauptstrecke von Kalkutta nach Benares bisher von allem Verkehr abgeschnittene Gebiete Zentralindiens dem Handel und der Kultur erschließen sollte.
Eines Tages erzählte mir einer unserer indische Arbeiter, daß in einem kleinen Dörfchen in der Nähe unserer Arbeitsstelle ein Fakir der zu ewigem Schweigen verpflichteten Sekte der Mewlewi-Derwische namens Tuma Rasantasena hause, welcher sich schon des öfteren für mehrere Wochen habe begraben lassen, nachdem er sich in einen starrkrampfähnlichen Zustand versetzt hatte. Nach Rücksprache mit meinen Kollegen ließ ich Rasantasena eine größere Summe bieten, wenn er sein Experiment vor uns wiederholen wollte. Der Fakir stellte sich auch wirklich ein, und wir fünf Ingenieure, die wir das Geld für diese interessante Unterbrechung unseres eintönigen Daseins zusammengeschossen hatten, haben dann die Ausführung der seltsamen Vorstellung genau überwacht und dabei festgestellt, daß der Fakir tatsächlich die wunderbare Gabe besitzt, fast zwei Monate in einen Holzkasten zwei Meter tief unter der Erde eingeschlossen in todähnlichem Schlafe zuzubringen.
Ein Betrug war bei den von uns getroffenen Vorsichtsmaßregeln vollkommen unmöglich gemacht, zumal wir abwechselnd Tag und Nacht die Stelle, wo Rasantasena vor unseren Augen eingegraben worden war, bewachten und auch seiner Ausgrabung und Wiedererweckung beiwohnten. Die außerordentliche Seltenheit von Rasantasenas Experiment brachte mich sofort auf den Gedanken, aus des Indiers mir noch heute ganz unbegreiflichen Fähigkeiten Kapital zu schlagen.
Nachdem der Bahnbau vollendet und ich wieder mein freier Herr war, bin ich sofort auf dem kürzesten Wege hierher nach Cleveland gekommen, um auf der demnächst zu eröffnenden Gewerbeausstellung, die fraglos einen ungeheuren Besuch aus allen Weltteilen zu erwarten hat, mit Tuma Rasantasena mein erstes Debüt zu geben.“
Singleton ließ seine grauen, scharfen Augen eine ganze Weile forschend auf dem Gesicht seines Gegenübers ruhen, bevor er fragte:
„Und welche Garantien bieten Sie mir, daß der Fakir tatsächlich imstande ist, ein ähnliches Experiment auch hier auszuführen?“
„Ich werde auf einer hiesigen Bank die Summe von dreißigtausend Dollar deponieren, die vertraglich der Leitung der Ausstellung zufallen sollen, sobald Rasantasena sich als Schwindler erweist, oder aber, wenn er sein Experiment vor Ablauf von sieben Wochen abbricht. Ich glaube, daß Sie mit dieser Garantie zufrieden sein können.“
In bedeutend höflicherem Tone entgegnete der Direktor:
„Ich selbst kann in dieser Angelegenheit nicht endgültig entscheiden, Herr Houster. Jedenfalls möchte ich Sie aber bitten, mir nunmehr mit allen Einzelheiten anzugeben, wie Sie sich das Auftreten des Indiers hier überhaupt denken. Ich nehme an, daß Sie mit einem fertigen Plane zu mir gekommen sind.“
„Allerdings – mein Plan ist bis in die kleinsten Kleinigkeiten vorbereitet“, sagte Franklin Houster mit derselben Liebenswürdigkeit. „Was zunächst die pekuniäre Seite anbetrifft, so verlange ich für die sieben Wochen, die das Experiment Rasantasenas dauert, rund dreißigtausend Dollar, zahlbar nach Beendigung des Engagements. Alle Kosten für Reklame und die notwendigen Baulichkeiten tragen Sie. Ich habe dann noch eine Bedingung zu stellen, die ich Ihnen jedoch erst nachher mitteilen will.“
Der Impresario holte zwei Zeichnungen hervor und breitete zunächst die eine auf dem Schreibtische aus.
„Sie haben hier die genauen Grundrisse und die Totalansicht für einen in dem leichten, graziösen Baustil der indischen Tempel entworfenen Pavillon, der über der Stelle zu errichten ist, wo Rasantasena während seines Schlafzustandes begraben werden soll. Das Publikum wird den Fakir durch diesen viereckigen, von einem Gitter umgebenen Ausschnitt im Boden des kleinen Gebäudes in seinem mit einigen Luftlöchern versehenen Glassarge, der in eine drei Meter tiefe, an den Seiten mit Holz verkleidete Grube versenkt ist, sich ansehen können. Ich gedenke nun – und das ist die Bedingung, von der ich vorhin sprach – für die Besichtigung des schlafenden Fakirs ein Eintrittsgeld von einem Dollar zu erheben, eine Einnahme, die mir allein zufallen muß.“
„Warum nicht, Herr Houster“, meinte der Direktor lächelnd. „Die Art und Weise, wie Sie die Sache arrangieren wollen, sagt mir so vollkommen zu, daß ich Ihnen jetzt schon mit ziemlicher Bestimmtheit eine Annahme Ihrer Vorschläge von seiten der Ausstellungsleitung versprechen kann. Uns hat nämlich bisher – ich bis hierin ganz ehrlich – für unser Unternehmen gerade ein so außerordentliches Zugstück gefehlt. Sie wissen, hier bei uns im gesegneten Amerika geht es nun einmal ohne etwas die Neugier reizenden Jahrmarktsrummel, selbst bei den ernsthaftesten Angelegenheiten, nicht ab. Ihr Fakir kommt uns da wirklich wie gerufen. Ich werde sofort heute nachmittag eine Sitzung des Vorstandes anberaumen und den Herren Ihre Pläne unterbreiten. – Nur eine Frage gestatten Sie mir noch, Herr Houster: Wo soll der Pavillon, der mir in seiner zierlichen, für seinen Zweck so gut gewählten Architektur ausnehmend gefällt, auf dem Ausstellungsgelände aufgeführt werden?“
„Auch diesen Punkt habe ich vorgesehen, Herr Singleton. Ich bin gestern in aller Frühe mit Rasantasena in der Ausstellung gewesen, denn der Fakir kann sein Experiment nur an einer Stelle vornehmen, die gewissen Bedingungen entspricht. So muß sie zum Beispiel von allen Gebäuden möglichst entfernt sein, etwas höher als die Umgebung liegen und viel Sonne erhalten.“
Der Impresario nahm die zweite Zeichnung, einen Plan des Ausstellungsgebietes, zur Hand und wies mit dem Finger auf einen inmitten der gärtnerischen Anlagen vor der gewaltigen Haupthalle gelegenen freien, runden Platz hin, der als Kinderspielplatz dienen sollte.
„Als ich mit Rasantasena das ganze Gelände abgeschritten hatte, bedeutete er mir in seiner mir leicht verständlichen Zeichensprache – er selbst spricht ja seinem Gelübde gemäß kein Wort – daß diese Stelle auf dem Kinderspielplatz der einzig geeignete Ort für sein Experiment sei. Es wäre also unbedingt nötig, hier den Pavillon zu errichten. Die Lage bietet ja auch den großen Vorteil, daß die nach der Haupthalle hinströmenden Besucher in nächster Nähe vorüber müssen.“
Singleton prüfte eine Weile nachdenklich die Zeichnung und reichte sie dann seinem Gegenüber zurück.
„Wird gemacht, Herr Houster – wird gemacht! Die Wahl des Platzes könnte gar nicht besser sein.“
Dann saßen die beiden Herren wohl noch eine Stunde beisammen, und der Impresario entwickelte nunmehr alle Einzelheiten, wie er namhafte Gelehrte der medizinischen Welt für die Sache interessieren wolle, und in welcher Weise er sich eine Kontrolle und eine Überwachung des Indiers während des Experiments gedacht habe.
Am nächsten Vormittag unterzeichnete Direktor Singleton als Vertreter des Ausstellungsdirektoriums und der Impresario des berühmten indischen Fakirs Tuma Rasantasena den Engagementsvertrag, in dem man in allen Punkten den Wünschen Housters nachgekommen war.
6. Kapitel.
Auf der Spur zweier Feinde.
Fred Wilson, der berühmte Detektiv der Friskoer Polizei, war ein kleines, bewegliches Männchen von vielleicht vierzig Jahren. Wie er jetzt Alice Weather gegenüber auf dem steiflehnigen Polsterstuhl Platz nahm, umspielte seine schmalen Lippen ein feines Lächeln.
„Es freut mich, Miß Weather“, begann er die Unterhaltung, „daß ich endlich Gelegenheit habe, Sie persönlich kennen zu lernen. Als Sie mir vor nunmehr vierzehn Monaten den Auftrag gaben, das Tun und Treiben des früheren Marineleutnants Harry Sanders zu beobachten, nahm ich die Sache nur an, weil sie mir ganz vorzüglich in meine eigenen Absichten paßte. Ich habe Ihnen hierüber nichts geschrieben, da ich mit schriftlichen Mitteilungen sehr vorsichtig bin.“
„Allerdings“, meinte das junge Mädchen etwas verstimmt. „Spärlich genug liefen Ihre Nachrichten ein.“
„Es ging nicht anders“, entschuldigte sich der Detektiv höflich. „Wirklich nicht. Eigentlich darf ich als staatlicher Beamter überhaupt Aufträge von Privatpersonen nicht ausführen. Aber da Sie nun schon einmal bei Gelegenheit der Verhandlung gegen die Hafenpiraten, die damals die „Ariadne“ raubten und nachher zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wurden, meinen Namen als den eines einigermaßen gewandten Detektivs sich gemerkt und bei mir angefragt hatten, so ließ ich mich dazu herbei, sozusagen noch nebenher in Ihre Dienste zu treten. Hoffte ich doch so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen …“
„Inwiefern? – Ich verstehe Sie nicht?“
„Nun, Sie wissen doch, Miß Weather, daß jener Thomas Sinters an Harry Sanders einen Drohbrief geschrieben hatte. Ich sollte dem Verbrecher nun weiter nachspüren, erreichte jedoch nichts, nichts. Er war wie in die Erde verschwunden. Da dachte ich mir: wenn er sich wirklich an Harry Sanders rächen will, so ist es das Einfachste, diesen im Auge zu behalten. Dann wird Sinters bald in dessen Nähe auftauchen. Mithin kam mir Ihr Auftrag ganz gelegen. Ich beobachtete nun den früheren Leutnant in der Hoffnung, daß der schurkische Kapitän bald versuchen würde seine Drohungen, die ich völlig ernst nahm, wahrzumachen. Und wirklich: Vor drei Monaten tauchte Sinters in Cincinnati auf, wo Harry Sanders damals noch als Ingenieur bei der Firma W. Hawkens in Stellung war. Wohlverstanden – tauchte auf wie ein Meteor und verschwand wieder spurlos – leider! Inzwischen war dann auch Harry Sanders nach Deutschland abgereist, wie ich Ihnen letztens schrieb.“
„Und wo befindet er sich jetzt?“ fragte Alice erregt.
Der Detektiv zuckte die Achseln.
„Weiß ich nicht, Miß“, meinte er bedauernd. „Hab drüben in Deutschland seine Spur verloren.“
„Wo sahen Sie ihn zum letztenmal?“ Durch diese Frage zitterte etwas wie bange Sorge hindurch.
„In Hamburg, gleich nach der Ankunft des Dampfers. Dann war er nicht wieder aufzutreiben. Er hat absichtlich seine Spuren verwischt, ohne Frage.“
Alice Weather schaute unschlüssig vor sich hin.
„Ob Harry Sanders etwa das Opfer eines … Meuchelmordes geworden ist?“ meinte sie dann zögernd.
„Halte ich für ausgeschlossen. Nur Sinters hätte ein Interesse daran ihn zu beseitigen. Und der befand sich damals nicht in Hamburg. Das weiß ich bestimmt.“
Das junge Mädchen atmete erleichtert auf.
„Was führt Sie jetzt nach Cleveland?“ fragte sie darauf, einer plötzlichen Eingebung folgend.
Fred Wilson schaute sich erst vorsichtig in dem eleganten Hotelzimmer um, bevor er Antwort gab. Und dies tat er, indem er sich ganz dicht zu der jungen Millionärin hinüberbeugte und seine Stimme zu vorsichtigem Flüstern dämpfte.
Alice erbleichte. Das, was der Detektiv ihr soeben mitteilte, ließ ihre Sorge aufs neue aufleben.
Längere Zeit sprachen die beiden dann noch leise und eifrig miteinander. Und als Fred Wilson sich schließlich verabschiedete, kehrte Alice verstimmt zu ihrem Vater zurück, der auf dem geräumigen Balkon beim Frühstück saß.
Der alte Weather fragte nicht mit einem Wort nach den Neuigkeiten, die der Detektiv gebracht hatte. Er tat’s aus Zartgefühl, nicht aus Gleichgültigkeit. Wußte er doch, wie schwer sein einziges Kind unter der Trennung von Harry Sanders litt, der ihm gerade wegen seines energischen Festhaltens an seinen Entschlüssen, mehr als er zugab, imponierte. – –
Fünf Minuten später.
Alice Weather hatte soeben ihrem Vater den neuesten der täglichen Berichte über das Experiment Tuma Rasantasenas aus der „Cleveland Post“ vorgelesen. Jetzt warf sie die Zeitung ärgerlich mitten auf den Frühstückstisch[4], so daß die eine Ecke des Blattes sich in recht überflüssigem Anlehnungsbedürfnis an die goldgelbe Butter schmiegte und daher sehr bald einen großen Fettfleck aufzuweisen hatte.
„Und trotzdem ist alles Schwindel!“ rief sie erregt, „Ich werde schon noch dahinter kommen, wie dieser famose Impresario hier den Leuten Sand in die Augen streut!“
Percy Weather, in New York als einer der millionenschwersten und kühlsten, aber auch waghalsigsten Börsenspekulanten bekannt, lächelte zu diesem Temperamentsausbruch seines Kindes mit jener durch nichts aus dem Gleichgewicht zu bringenden Ruhe, die eine seiner Hauptcharaktereigenschaften bildete.
„Du hast das Ungestüm von Deiner verstorbenen Mutter geerbt“, sagte er nachsichtig und faltete die durchfettete Zeitung behutsam zusammen. „Von Schwindel kann hier keine Rede sein. Du vergißt, daß unsere berühmtesten Ärzte dabei gewesen sind, als der Fakir sich vor sechs Wochen in seinen Glassarg legte und durch Anstarren einer kleinen gläsernen Kugel, die ihm vor die Augen gehalten wurde, in diesen tiefen Schlaf versetzt und dann in die Gruft versenkt wurde. Du übersiehst ferner, daß der festgeschraubte Sargdeckel durch mehrere große Siegel mit dem Unterteil des Sarges verbunden ist. Rasantasena kann also sein gläsernes Gefängnis gar nicht ohne Wissen der über ihn eingesetzten Beobachtungskommission verlassen, die aus mehreren bedeutenden Medizinern und einigen Redakteuren der größten hiesigen Tageszeitungen besteht. Jede Verbindung mit der Außenwelt ist ihm vollständig abgeschnitten, und ebenso wenig ist es möglich, ihm, falls er seinen Schlafzustand nur heucheln sollte, Nahrungsmittel zuzuführen, weil zu allem Überfluß der Pavillon auch nicht einen Augenblick unbewacht bleibt.
Und ein Vorspiegeln des merkwürdigen Schlafzustandes anbetrifft, liebes Kind, – zeige mir doch einmal einen Menschen, der ununterbrochen von morgens acht Uhr bis abends zehn Uhr Tag für Tag völlig unbeweglich in derselben Stellung verharren könnte! Du bist ja übrigens vor acht Tagen Zeugin gewesen, wie der Fakir in seinem durchsichtigen Sarge in den Pavillon hinaufgezogen und nach diesen ersten fünf Wochen seines Experiments von den Ärzten untersucht und tatsächlich noch immer in tiefstem Schlafe liegend vorgefunden wurde. Du selbst hast aus nächster Nähe mitangesehen, daß der Sarg dann wieder versiegelt und langsam unter Vermeidung jeder Erschütterung in die schmale Grube auf seine beiden Böcke herabgelassen worden ist.
Gerade diese Untersuchung, die morgen vormittag wiederholt wird – natürlich nur, um den Geldbeutel des schlauen Impresario durch das zu dieser besonderen Gelegenheit wiederum so unverschämt erhöhte Eintrittsgeld noch mehr zu füllen – gilt mir als der beste Beweis dafür, daß Rasantasena tatsächlich einer jener Bewohner des Märchenlandes Indien ist, die bisweilen über uns ganz unbegreifliche, vom medizinischen Standpunkt kaum zu erklärende Fähigkeiten verfügen. Ich kann Dir nur raten, zerbrich Dir nicht weiter über dieses Wunder Dein eigensinniges Köpfchen!“
„Das ist ja alles schön und gut, doch meinen Verdacht zerstreust Du trotzdem nicht! Ich vergesse jenes wohl nur von mir allein bemerkte höhnische Lächeln nicht, das die Lippen des Impresario umspielte, als Professor Doktor Weasler von der hiesigen Universität an jenem Vormittag vor dem eben geöffneten Sarge des Fakirs seinen gelehrten Vortrag über die durch den hypnotischen Schlaf bei Rasantasena hervorgerufene teilweise Arbeitseinstellung der wichtigsten Organe hielt. Es war ein Lächeln, in dem selbstbewußte Ironie und zugleich auch Verachtung lag. Verachtung all der Dummen, die für ihr teures Geld den Schwindel mitansehen. So deutete ich mir dieses infame Lächeln. Nur schade, daß die Augen dieses Franklin Houster hinter der großen grauen Brille verborgen waren. Vielleicht hätte man sonst aus seinen Blicken noch mehr herauslesen können. Überhaupt – mir kommt der Mann so merkwürdig bekannt vor. Seine krächzende Stimme ist mir freilich höchst unsympathisch. Wenn man nur einmal seine Augen ohne Brille sehen könnte …“
„Besser, Du hast ihm nicht so tief in die Augen geschaut“, meinte der alte Herr mit feinem Spott. „Der Mann hat so einen Zug eiserner Energie um den Mund, der ihn trotz des etwas struppigen Bartes für die holde Weiblichkeit nach meinen Erfahrungen recht gefährlich macht. Fraglos ist er eine von jenen Herrennaturen, die dem schwachen Geschlecht durch brutales, schonungsloses Beweisen ihrer Überlegenheit zu imponieren und gerade dadurch die kühlsten Herzen zu entflammen wissen.
Aber Scherz beiseite, Kind, ich habe Wichtigeres mit Dir zu besprechen. Heute morgen ist ein Brief aus New York eingetroffen, der mich dringend dorthin zurückruft. Wir werden morgen vormittag also bestimmt reisen. Die Ausstellung haben wir ja bis in die verstaubtesten Winkel hinein besichtigt. Und ich habe auch das Hotelleben in diesen zwölf Tagen wieder einmal reichlich satt bekommen.“
In Alice Weathers schmalem, feinem Antlitz zeigte sich bei dieser Nachricht deutlich ein Ausdruck von großer Enttäuschung. Aber mit echt weiblicher Schlauheit erwiderte sie trotzdem gleichmütig:
„Gut, Pa, reisen wir also!“
Dann schaute sie nachdenklich über die Brüstung des blumengeschmückten Balkons auf das von Fahrzeugen aller Art bedeckte nahe Hafenbassin und die blauen, in der Sonne glitzernden Wasser des Eriesees hinaus. Sie schien mit einem Entschluß zu kämpfen.
„Pa – ich möchte Dir etwas anvertrauen“, sagte sie plötzlich.
„Hast Du Dich etwa verliebt oder gar verlobt?“ versuchte er zu scherzen.
Die junge Dame zuckte nur geringschätzig die Achseln.
„Es betrifft den Fakir“, erklärte sie kurz.
„Schon wieder dieser Fakir!“ stöhnte Weather in komischer Verzweiflung. „Also – schieß los, Töchterlein!“
Und sie „schoß los“.
Der alte Herr wurde, je länger sie sprach, immer aufmerksamer und schlug sich schließlich schallend aufs Knie.
„Das hast Du wahrhaftig großartig eingefädelt! Gefällt mir an Dir, diese kurze Entschlossenheit! Bist darin das rechte Kind Deines Vaters.“
„Wir bleiben also?“
„Wir bleiben, trotzdem ich fürchte, daß Du eine Enttäuschung erleben wirst. Die Idee, wie Du diesen Indier zu entlarven gedenkst, ist ja sehr anerkennenswert, der Erfolg steht jedoch auf einem anderen Blatt. Du wirst schließlich wohl einsehen, daß Du Dich getäuscht hast, und das dürfte für Dich eine ganz heilsame Lehre sein.“
„Abwarten – abwarten!“ rief Alice, unbekümmert um diese wenig erfreuliche Prophezeiung.
Und siegesgewiß fügte sie hinzu:
„Ihr Schicksal hängt morgen an einem seidenen Fädchen, Herr Franklin Houster! Nehmen Sie sich vor mir in acht!“
7. Kapitel.
Drohendes Unheil.
Fred Wilson hatte sich in der Moore-Straße in Cleveland bei einfachen Leuten ein billiges Zimmer gemietet, dessen Fenster ihm gestatteten, das gegenüberliegende Haus ständig im Auge zu behalten. Dort befand sich in der ersten Etage ein Pensionat, welches jetzt zur Zeit der Ausstellung bis auf den letzten Platz besetzt war.
Der Detektiv, der dem alten Piratenführer Thomas Sinters seit einigen Wochen wieder auf der Spur war, stand soeben hinter der Gardine verborgen am Fenster und beobachtete mit einem Krimstecher einen alten, würdig ausschauenden Herrn mit weißem Bart, der drüben auf dem Balkon in einem Korbsessel saß und behaglich die Morgenzeitung las.
Plötzlich erhob sich der Fremde, faltete die Zeitung zusammen und verschwand durch die Balkontür in dem dahinterliegenden Zimmer. Wenige Minuten später trat er auf die Straße hinaus, zündete sich erst umständlich eine Zigarre an und schritt dann langsam in der Richtung nach dem Freiheitsplatz davon.
Fred Wilson folgte ihm auch heute wieder in angemessener Entfernung, neugierig, ob der alte Herr, der mit seiner etwas vornübergebeugten Haltung und der goldenen Brille ganz den Eindruck eines harmlosen Gelehrten machte, abermals wie durch ein Zauberwort sich seinen Blicken entziehen würde. Nun, der bereits so oft genasführte Detektiv wollte heute schon die Augen offen halten[5] … Er mußte endlich herausbekommen, was Thomas Sinters – denn mit diesem gefährlichen Verbrecher war der „harmlose Alte“ identisch – in Cleveland vorhatte. Daß es sich um einen neuen Schurkenstreich dieses ebenso waghalsigen wie vielseitigen ehemaligen Kapitäns der „Ariadne“ handelte, stand bei ihm fest. Gewiß – längst hätte er Sinters, der sich ziemlich sicher zu fühlen schien, dingfest machen und der Polizei in Cleveland übergeben können. Aber damit wollte er sich doch noch etwas Zeit lassen. Denn er hoffte zuversichtlich, der rachsüchtige Verbrecher würde ihn schließlich unabsichtlich auf die Fährte Harry Sanders führen, welcher ihm damals in Hamburg so plötzlich entschlüpft war.
Inzwischen hatte der weißbärtige Herr auf dem Freiheitsplatz eine elektrische Straßenbahn bestiegen und war nach dem Ballan-Kai hinausgefahren. Fred Wilson aber stand auf dem Hinterperron des Anhängewagens und gab genau acht, daß der Schurke sich ihm nicht abermals durch eine neue List entzog.
Am Ballan-Kai, dort, wo die mächtigen Speicher der Kanada-Pelz-Kompagnie stehen, verließ Sinters die Straßenbahn und betrat eine der bescheidenen Hafenkneipen, die er nun schon zweimal aufgesucht hatte und die, wie Wilson leider zu spät bemerkt hatte, einen zweiten Ausgang nach einer Seitenstraße besaß.
Der Detektiv, gewitzigt durch seine bisherigen Erfahrungen, schritt unbekümmert auf die auf den Hof des Grundstücks führende Einfahrt zu und öffnete die kleine Pforte, die in einen der mächtigen hölzernen Torflügel eingelassen war. Der Hofraum war leer. Und so konnte sich Wilson bequem hinter einem Bretterstapel verbergen und aus seinem Versteck die Rückfront der Kneipe im Auge behalten.
Eine Viertelstunde verging. Dann trat aus dem Hintereingang des Hauses ein Arbeiter in einer blauen Bluse heraus, den jeder ohne weiteres für einen Irländer gehalten hätte. Ein krauser, rötlicher Bart umgab ein frisches, leichtgebräuntes Gesicht, dessen Züge nichts als fröhliche, behagliche Sorglosigkeit ausdrückten. Im linken Mundwinkel hing dem Manne eine kurze Pfeife, aus der er gemächlich blaue Rauchwolken aufsteigen ließ.
Wilsons Augen bohrten sich trotzdem förmlich in dieses gutmütige Antlitz ein. Mit einemmal lächelte er still vor sich hin.
„Vorsichtig bist Du allerdings, Thomas Sinters“, dachte er dabei. „Aber Deine Hakennase, – die verrät Dich doch …!“ –
Eine halbe Stunde später befand sich der angebliche Irländer vor der Tür eines in der Nähe der Ausstellung, einsam inmitten eines großen Gartens, gelegenen Häuschens. Dort klopfte er mehrmals an, ohne daß ihm geöffnet wurde. Schließlich machte er sich wieder auf den Rückweg nach der Stadt, ständig verfolgt von dem Detektiv, der sich nunmehr der Hoffnung hingab, heute wenigstens einen Schritt seinem Ziele näher gekommen zu sein.
Noch an demselben Tage hatte Fred Wilson festgestellt, daß in dem Häuschen niemand anders als Franklin Houster, der Impresario des „schlafenden Fakirs“, wohnte.
* * *
Am nächsten Vormittag mußte Percy Weather von acht bis elf Uhr, also[6] geschlagene drei Stunden, mit Alice in dem Fakirpavillon ausharren, nur um einen Platz möglichst dicht an dem Gitter zu erhalten, das die viereckige Öffnung in dem Fußboden umgab, und während dieser drei Stunden hatte er die beste Gelegenheit, Tuma Rasantasena dort unten in seinem Glassarg in aller Ruhe anzustaunen. Bei den vier von matten Glasglocken verhüllten Glühbirnen in der Gruft konnte man die mit über der Brust gekreuzten Händen bewegungslos daliegende, in einen hellen, die Füße mitverhüllenden Burnus gekleidete Gestalt Rasantasenas mühelos erkennen, wenn auch die einzelnen Züge seines von einem dichten schwarzen Vollbart umrahmten hageren, braunen Gesichts in der halben Dämmerung verschwammen.
Mit dem Glockenschlag elf bahnte sich die Beobachtungskommission, an ihrer Spitze Professor Doktor Weasler und der Impresario, einen Weg durch das in dem Pavillon dicht gedrängt stehende Publikum, und wenige Minuten später gab der Professor nach einer kurzen Ansprache den Arbeitern einen Wink, den Sarg emporzuziehen. Unter dem beinahe andächtigen Schweigen der Versammelten hob sich der gläserne Behälter immer mehr, bis man ihn auf die über die Fußbodenöffnung geschobenen starken Bretter stellen konnte. Die Herren prüften zunächst sehr sorgfältig die Siegel, die den Sargdeckel mit dem unteren Teile verbanden. Sie waren unverletzt. Hierauf wurde der Sarg vorsichtig geöffnet, und Professor Weasler beobachtete, die Uhr in der Hand, im Verein mit seinen Kollegen eine ganze Weile den Pulsschlag und die Atmungtätigkeit des Fakirs. Alles das wickelte sich unter lautloser Stille mit einer gewissen Feierlichkeit ab.
Alice Weather, die in der vordersten Reihe der Zuschauer ganz dicht zu Füßen des Sarges stand, hatte sich weit vorgebeugt, als der Glasdeckel von den Arbeitern abgehoben und beiseite gestellt wurde. Unverwandt sah sie jetzt auf eine bestimmte Stelle des hellen Burnus Rasantasenas. Ihre Augen schienen etwas Besonderes zu suchen, und ihr reizendes frisches Gesichtchen drückte dabei eine Spannung aus, die immer mehr wuchs, je länger ihre Blicke über das rauhe wollene Kleid des Indiers hinglitten.
Dann huschte ein schnelles triumphierendes Lächeln um ihre Mundwinkel. Hastig flüsterte sie ihrem Vater zu, der nicht weniger aufmerksam das Gewand des Fakirs gemustert hatte: „Ich sehe nichts! Und dieses Nichts ist der Sieg!“
„Leise, leise!“ warnte Weather erschrocken. „Nur hier kein Aufsehen, Kind! Du weißte was Du mir versprochen hast!“
Er wollte noch mehr hinzufügen, aber Professor Weaslers dröhnende Stimme, die den größten Hörsaal auszufüllen vermochte, schnitt ihm jedes weitere Wort ab.
„Meine Damen und Herren“, begann der berühmte Gelehrte mit einer leichten Verbeugung. „Ihnen allen wird bekannt sein, daß Tuma Rasantasena sowohl für die hiesige wie auch für die auswärtige Presse ein Gegenstand vieler Besprechungen geworden ist, daß es nicht wenige Stimmen gegeben hat, die in der ersten Zeit beharrlich immer wieder die Ansicht vertraten, daß dieses ganze Experiment nichts als eine schlau inszenierte Täuschung sei. Diese Zweifler sind jedoch langsam verstummt, da die Überwachungsmaßregeln der Beobachtungskommission jeden Versuch, dem Fakir heimlich Nahrungsmittel zuzuführen, unmöglich machten. Um auch den hartnäckigsten Zweiflern ein Mittel an die Hand zu geben, den Fakir selbst kontrollieren zu können, mache ich auf die Photographien aufmerksam, die von Tuma Rasantasena gleich nach seiner Einsargung angefertigt wurden. Mit Hilfe dieser Bilder, die die Händler auch heute hier wieder feilbieten, läßt sich durch einfaches Vergleichen einwandfrei nachweisen, daß die Stellung des Indiers, die Haltung seiner Arme, Hände und Füße, ja sogar der Faltenwurf seines Burnus genau gleich geblieben sind.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir nun noch einige notwendige wissenschaftliche Bemerkungen. Meine Fakultätskollegen und ich konnten soeben wieder feststellen, daß eine wesentliche Veränderung in dem Aussehen des Schlafenden, der nun schon sechs Wochen ohne die geringste Nahrungsaufnahme, ohne die geringste Bewegung in seiner Gruft zugebracht hat, trotz der langen Fastenzeit auch heute nicht festzustellen ist. Über die auffallende Erscheinung, die darauf schließen läßt, daß bei Rasantasena keine bedeutendere Abnahme des Körpergewichts stattgefunden hat, können wir erst ein wissenschaftliches Gutachten abgeben, wenn der Indier aus seinem starrkrampfähnlichen Zustand erwacht ist. Der Termin für diese nicht nur von den hiesigen Gelehrten mit größter Spannung erwartete Erweckung ist bekanntlich für heute in acht Tagen festgesetzt. Tuma Rasantasena wird dann also volle sieben Wochen in seinem Sarge gelegen haben, eine Zeitspanne, die nur ein mit außerordentlichen Fähigkeiten ausgestatteter Mensch ohne ernste Schädigung seiner Gesundheit unter diesen Bedingungen durchzuhalten vermag. – Jetzt, verehrte Anwesende, können wir den Sarg wieder schließen lassen, und dann versiegeln mit dem Bewußtsein, Ihnen eines der größten medizinischen Wunder aus nächster Nähe gezeigt zu haben.“
Alice Weather hatte während dieser Rede Professor Weaslers ihren Blick förmlich in Franklin Housters Gesicht eingebohrt, der ihr gegenüber am Kopfende des Glassarges stand. Und wieder war es ihr wie schon vor einer Woche aufgefallen, daß gerade bei des alten Gelehrten begeisterten Worten, mit denen er die völlige Unanfechtbarkeit dieser Vorführung pries, über des Impresarios energisches Antlitz blitzschnell ein Lächeln flog. Und dieses Lächeln – es kam ihr so merkwürdig bekannt vor. Wenn nur die große graue Brille nicht gewesen wäre …!
8. Kapitel.
Ein unverhofftes Wiedersehen.
Am Nachmittag desselben Tages hielt ein elegantes Auto vor dem niedrigen Häuschen, das der Impresario Franklin Houster bewohnte. Und wenige Minuten später standen Percy und Alice Weather dem Impresario in dessen Arbeitszimmer gegenüber.
„Womit kann ich den Herrschaften dienen?“ fragte Houster mit seiner heiseren Stimme, die wie das Kreischen einer verrosteten Türangel klang.
Die Augen hätte sie einmal sehen mögen, – – – die Augen dieses Mannes, der sie an irgend jemand erinnerte.
Alice trat schnell einen Schritt vor. „Mein Vater und ich möchten Sie nur fragen, ob Sie uns freiwillig mitteilen wollen, wie Sie diesen Betrug mit dem angeblich schlafenden Fakir bewerkstelligen?“
Der Impresario zuckte leicht zusammen. „Betrug?! – Sie belieben zu scherzen“, sagte er langsam, wobei ein seltsames Lächeln um seine Lippen spielte.
„Nichts liegt uns ferner!“ entgegnete Alice. „Bitte, eine Antwort, mein Herr! Wollen Sie uns Ihr Spiel aufdecken oder nicht?“
Der Impresario lehnte sich seelenruhig an den Schreibtisch und kreuzte die Arme über der Brust. „Sie würden mich zu größtem Danke verpflichten, mein Fräulein, wenn Sie mir erklären wollten, was dieser ganze Auftritt eigentlich bedeuten soll. Sie sprechen hier von Betrug, und scheinen gar nicht daran zu denken, daß unsere Strafgesetze eine Beleidigung auch dann ahnden, wenn sie von so schönen Lippen kommt.“
„Die Strafgesetze haben Sie selbst zu fürchten, nicht ich! Und wenn Sie weiter auf Ihrer Weigerung beharren, so werden wir von hier aus direkt zu Professor Weasler fahren und ihm erzählen, welche Beobachtung wir heute vormittag in dem Fakirpavillon gemacht haben.“
Wieder ruhte jetzt Housters Blick offenbar belustigt auf dem gerade in der Erregung so anziehenden Gesicht seiner hartnäckigen Gegnerin. Dann antwortete er, sich leicht verbeugend: „Bitte, ich hindere die Herrschaften gewiß nicht daran. Professor Weasler wohnt Ohioplatz 24.“
„Professor Weasler wird es fraglos sehr interessant sein, zu erfahren“, rief Alice erregt, „daß heute vor acht Tagen ein weißer Seidenfaden auf dem hellen Burnus Tuma Rasantasenas gelegen hat, als der Sarg nach der Untersuchung durch die Beobachtungskommission wieder in die Gruft hinabgelassen wurde, und daß dieses Seidenfädchen merkwürdigerweise heute nicht mehr da war, wie mein Vater und ich festzustellen Gelegenheit hatten. – Wollen Sie mir vielleicht darüber Aufklärung geben, mein Herr, wie es möglich ist, daß dieser weiße Seidenfaden inzwischen aus dem angeblich festverschlossenen Glassarge verschwinden konnte?“
In Franklin Housters Antlitz verriet auch nicht das geringste Zucken seine Gedanken.
„Mein Fräulein, ich verstehe Sie wirklich nicht“, sagte er, noch immer ganz ruhig.
„Dann muß ich also noch deutlicher werden. Hier – betrachten Sie sich einmal diesen weißseidenen Sonnenschirm, mein Herr. Ihn trug ich in der Hand, als wir, mein Vater und ich, vor einer Woche als Zuschauer der ersten Öffnung von Tuma Rasantasenas Sarg beiwohnten. Während des etwas sehr langatmigen Vortrags Professor Weaslers spielte ich ganz absichtslos mit dieser weißseidenen Schleife hier oben am Schirmstock. Dabei löste sich ein kurzer Seidenfaden ab, den ich dann fortwerfen wollte und den ein Zufall auf des Fakirs hellen Burnus ganz dicht an der Stelle, wo die rechte Hand unter dem Gewande hervorragte, niederfallen ließ, wie ich genau beobachtet habe. Bald darauf wurde der Sarg wieder geschlossen und versiegelt. Das seidene Fädchen aber blieb unbeachtet liegen. – Haben Sie mir bis jetzt folgen können?“ fügte sie mit siegesgewissem Spott hinzu.
Der Impresario nickte nur kurz, hörte kaum noch auf das, was Alice Weather weiter sprach, – wie sein ironisches Lächeln ihren Verdacht zuerst wachgerufen hätte, und wie ihr dann plötzlich der Gedanke gekommen wäre, daß das seidene Fädchen ihr ja den sichersten Beweis liefern könne, ob der Fakir wirklich auch des Nachts völlig bewegungslos in seinem gläsernen Gefängnis verharre oder ob er, wie sie stets vermutet hätte, seinen tiefen Schlaf nur heuchele.
Franklin Houster schaute sinnend vor sich hin. Sollte er sein Spiel aufdecken …? – Eigentlich paßte ihm das nicht in seinen Plan hinein. Freilich – es würde ihm jetzt ja nichts anderes übrigbleiben … Denn – was half es ihm, wenn er weiter zu leugnen versuchte? Professor Weasler würde die Bedeutung dieses aus dem versiegelten Sarge verschwundenen Seidenfadens ebensogut einzuschätzen wissen wie er selbst, würde sicherlich eine genaue Untersuchung des Sarges und fraglos auch der Gruft vornehmen, und dann – –
„Antwort, mein Herr! Tuma Rasantasena muß zum mindesten den rechten Arm bewegt und sich dabei den Seidenfaden abgestreift haben! Sprechen Sie doch! Noch eine Minute gebe ich Ihnen Zeit! Sonst soll Professor Weasler noch heute erfahren, was ich Ihnen soeben mitgeteilt habe!“
Franklin Houster schaute erst Alice Weather, dann ihren Vater mit einem halb ironischen, halb traurigen Blick an und sagte dann mit seiner natürlichen Stimme, die jetzt so ganz anders klang …
„Schade, daß Sie mir den Spaß vorzeitig verdorben haben, Alice …!“
Dabei nahm er sich den tadellos befestigten falschen Bart, die Perücke und die Brille ab …
„Harry!“ Die junge Millionärin rief’s jubelnd voller Seligkeit.
Dem alten Weather aber entfuhr nur ein … „Donnerwetter – das ist mal eine Überraschung!“
Harry Sanders hatte beide Hände des jungen Mädchens in die seinen genommen und fragte lachend …
„Nun – wollen Sie noch immer die Verräterin spielen, Alice?!“
Ihr feines Gesichtchen war wie mit Blut übergossen.
„Wer hätte das aber auch ahnen können …!“ sagte sie in holder Verwirrung. „Allerdings – bekannt kam mir dieser Herr Impresario ja schon immer vor …!“
Der alte Weather schien die Vertraulichkeit zwischen den beiden nicht gerade gern zu sehen. Er räusperte sich stark und erklärte mit unzufriedenem Kopfschütteln …
„Vergessen Sie nicht, Sanders, was Sie mir seiner Zeit versprachen! Alice ist auf dem besten Wege, Ihnen die Erfüllung Ihrer Zusage recht schwer zu machen und …“
„Keine Sorge, Master Weather!“ unterbrach ihn Harry siegesgewiß. „Hören Sie erst meine Geschichte, und dann lassen Sie uns weiterreden. Da die Sache jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, darf ich Ihnen wohl diese Stühle anbieten. – So, und nun werde ich beginnen …
Daß ich den Dienst quittiert hatte, wissen Sie. Um mich zunächst wieder in mein Fach, die Ingenieurwissenschaften, einzuarbeiten, trat ich als Ingenieur bei der Firma W. Hawkens, Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen, ein. Ich bitte zu beachten – Kanalisationsanlagen, denn das ist wichtig für das folgende. An einem der ersten Apriltage unseres gesegneten Jahres saß ich nun in dem Bureau von W. Hawkens an dem großen Arbeitstisch und hatte vor mir eine Zeichnung der Kanalisationsanlagen von Cleveland liegen, die meine Firma im Jahre 1891 ausgeführt hatten. Ich studierte diese Zeichnung lediglich zu dem Zweck, um meine praktischen Kenntnisse in meinem Beruf zu erweitern. Neben mir hatte ich einen Situationsplan der Gewerbeausstellung ausgebreitet, der uns zugleich mit der Aufforderung, die Ausstellung mit Modellen unserer modernen Wasserfilter und sonstiger Spezialfabrikate zu beschicken, zugestellt worden war.
Unwillkürlich verglich ich diese beiden Zeichnungen miteinander und stellte so fest, daß eines der größten Abflußrohre, die nach den Rieselfeldern im Süden der Stadt gehen, gerade unter der großen Haupthalle der Ausstellung und den vor derselben projektierten gärtnerischen Anlagen, zu denen auch ein Kinderspielplatz gehören sollte, entlang lief. Damit hatte ich meinem fachmännischem Streben für diesen Vormittag Genüge getan.
Ich legte die beiden Pläne beiseite und griff zu der New-Yorker Illustrierten Zeitung, die ich mir morgens auf dem Gange ins Bureau erstanden hatte. In diesem Blatte interessierten mich bald zwei Aufsätze.
Der eine behandelte das Leben und Treiben der indischen Fakire, der andere einige kurz hintereinander erfolgte Einbrüche in die Stahlkammern mehrerer Bankgebäude.
In dem ersten Artikel über die Fakire war sehr eingehend das wunderbare Experiment eines Indiers beschrieben, der sich acht Wochen lang hatte eingraben lassen und nachher frisch und munter seinem kühlen Erdgefängnis wieder entstiegen war.
Die zweite Abhandlung schilderte mit allen Einzelheiten den Einbruch in das Kassengewölbe der Kaliforniabank in San Franzisko, der mit Hilfe eines von den Dieben in monatelanger Arbeit hergestellten unterirdischen, direkt unter dem Gewölbe mündenden Ganges ausgeführt worden war.
Während ich noch diesen letztgenannten Artikel las, durchzuckte mich plötzlich ein Gedanke, oder vielmehr es entrollte sich mit wahnsinniger Hast in meinem Hirn der vollständige Plan für meine spätere Tätigkeit als Impresario Tuma Rasantasenas, ein Plan, den ich in allen, selbst den feinsten Einzelheiten mit einem Male wie ein plastisches Gemälde fix und fertig vor mir sah. Im ersten Augenblick schreckte ich vor dieser Offenbarung wie vor einer bösen Versuchung zurück, weil ich mir sofort sagte, daß dieser Plan sich mit den nötigen Geldmitteln, der nötigen Vorsicht und Kühnheit sehr wohl in die Wirklichkeit umsetzen ließe. Drei Tage vergingen trotzdem noch, ehe ich zu einem bestimmten Entschlusse kam.“
Harry Sanders machte eine kurze Pause.
„Dann entschloß ich mich doch, die Sache zu wagen“, fuhr er fort. „Ich hoffte eben, mir durch diesen … Bluff soviel Geld zu verdienen, daß ich damit den Grundstock zu einem späteren Vermögen legen konnte. Zur Verwirklichung meiner Idee gehörten nun bedeutende Barmittel, die ich leider nicht besaß. Da vertraute ich mich denn meinem Chef, Herrn William Hawkens, an, der ein viel zu smarter Geschäftsmann ist, als daß er nicht das nötige Verständnis für diese unter Umständen recht einträgliche Idee gehabt hätte. Er war es, der mir ohne langes Besinnen trotz des großen Risikos fünfzigtausend Dollar vorstreckte und mich auch bis auf weiteres beurlaubte.“
9. Kapitel.
Das Geheimnis des schlafenden Fakirs.
„Bereits am Tage nach der Unterredung mit Hawkens brachte mich der nächste Schnelldampfer nach Hamburg. Hier in der altehrwürdigen Hafenstadt, in der man Vertreter fast aller Volksstämme der Welt antreffen kann, fand ich bald, was ich suchte: einen Indier mit einem schönen, langen Vollbart, der als Türhüter in goldstrotzender Uniform bei einem Varietee dritter Güte seinen Lebensunterhalt verdiente. An diesen Indier, der Tuma Bengavi hieß, machte ich mich vorsichtig heran, um mich auch von seinen geistigen Fähigkeiten zu überzeugen. Diese Prüfung hatte ein gutes Ergebnis. Tuma Bengavi war durch seinen langjährigen Aufenthalt in den verschiedensten Großstädten zu einem siebenmalgesiebten Gauner geworden und zeigte sich, nachdem er einige Goldstücke als Vorschuß erhalten hatte, sofort bereit, die ihm zugedachte Rolle zu übernehmen. Er brannte seinem bisherigen Brotherrn einfach durch und begleitete mich zunächst nach Berlin.
Auf diese Weise wurde ich Impresario des berühmten Fakirs Tuma Rasantasena. Ich verpflichtete ihn gleich bei Abschluß unseres Kontraktes dazu, fortan den Stummen zu spielen, und ich muß ehrlich sagen, er hat diese nicht leichte Aufgabe ebenso glänzend gelöst, wie er seine ganze Rolle mit außerordentlicher Gewandtheit durchführte.
Für mich gab es aber noch einen zweiten Grund, weshalb ich gerade nach Deutschland gegangen war, um mir dort meinen schlafenden Fakir anzuwerben. In Berlin nämlich ließ ich in dem Atelier des rühmlichst bekannten Wachsmodelleurs Kastan den Kopf und die Hände Tuma Rasantasenas täuschend ähnlich in Wachs nachbilden. Ebenso besorgte ich mir von einem Fabrikanten von Modellpuppen eine auseinandernehmbare Gliederpuppe, die genau den Körpermaßen des Indiers entsprach. Mit diesen für meine Absichten durchaus notwendigen Dingen ausgerüstet kehrte ich in Begleitung Rasantasenas nach Amerika zurück. – In welcher Weise ich dann die Leitung der hiesigen Gewerbeausstellung für meine Pläne gewann, was ich dem Direktor Singleton über meine Erlebnisse in Indien und meine Bekanntschaft mit Tuma Rasantasena berichtet habe, – das alles ist ja von den Zeitungen aufs ausführlichste in die Öffentlichkeit getragen worden. Den kostspieligen Glassarg ließ ich mir nach meinen Angaben erst in Amerika anfertigen. Er ist bekanntlich vor Beginn des Experiments von der Beobachtungskommission genau daraufhin untersucht worden, ob es einem durch Festschrauben des Sargdeckels an den Unterteil darin Eingeschlossenen durch die ganze Konstruktion tatsächlich vollkommen unmöglich gemacht sei, sich aus diesem gläsernen Gefängnis von innen heraus und nur mit eigener Hilfe zu befreien. Die Kommission hat denn ja auch ihren Spruch dahin abgegeben, der Sarg entspreche den gestellten Anforderungen voll und ganz. Sie hielt eben diese offenbare Unmöglichkeit einer Befreiung „von innen heraus“ für die wichtigste Kontrollmaßregel für den Indier. Denn darauf, daß sich jemand in den nachts andauernd unter strengster Bewachung stehenden Pavillon Eingang verschaffen, die oberste Glasplatte des Sargdeckels in aller Seelenruhe dann eben von außen losschrauben und so den Prinzen aus dem deutschen Märchen spielen könnte, der das Fakir-Dornröschen aus dem Zauberschlaf erweckt, – darauf kam niemand von den klugen Herrn!
Das Direktorium der Ausstellung schloß also mit mir einen außerordentlich vorteilhaften Vertrag ab und bewilligte mir auch für den Aufbau des Pavillons gerade die eine Stelle des Ausstellungsgeländes, auf die es mir ankam, nämlich genau über der großen Kanalisationsröhre, die unter dem ursprünglich projektierten Kinderspielplatz vor der Haupthalle vier Meter tief unter der Erde entlangführt, wie ich schon damals beim Vergleichen der beiden Zeichnungen in unserem Bureau in Cincinnati festgestellt hatte. Dieselbe Zeichnung des Kanalisationsnetzes von Cleveland sagte mir dann auch, daß man von dem Keller dieses Häuschens aus einen Zugang zu einem der Zweigrohre herstellen konnte. Ich mietete daher dieses Grundstück für ein halbes Jahr, und –“
„Sanders, Sie sind ja der geriebenste Halun…, pardon, der geriebenste Geschäftsmann, wollte ich sagen, der mir je vorgekommen ist!“ unterbrach ihn hier der alte Weather begeistert. „Also auf diese Weise haben Sie sich mit Ihrem famosen Genossen in Verbindung gesetzt, so von unten herauf, während die Wächter oben in treuester Pflichterfüllung den Pavillon umkreisten!“
„Zunächst danke ich für das Kompliment, Master Weather“, meinte Sanders ohne jede Empfindlichkeit. „Dann aber möchte ich doch sehr nachdrücklich betonen, daß die Durchführung meines Kunststückes keineswegs so einfach gewesen ist, wie Sie es anzunehmen scheinen. Mußte ich doch jeden Tag eine Entdeckung und damit den Zusammenbruch meiner ganzen Hoffnungen befürchten. Um es ehrlich einzugestehen, – hätte ich vorher geahnt, welche Anforderungen die Durchführung meines Planes an meine Nerven stellen würde – niemals hätte ich mich auf diese Sache eingelassen!
Es dürfte Sie ermüden, wollte ich Ihnen ein eingehendes Bild meiner Tätigkeit in jenen Wochen vor der Eröffnung der Ausstellung entwerfen. Bedenken Sie zum Beispiel, daß ich schon mein Äußeres völlig verändern mußte, um der Gefahr zu entgehen, von irgend jemand als der Ingenieur Harry Sanders angesprochen zu werden. Der Vollbart, leider hat er zur Verschönerung meines bisher völlig bartlosen Gesichts nicht das geringste beigetragen – sowie die Perücke und diese Brille mit den grauen Riesengläsern erfüllten ihren Zweck jedoch vollkommen. Niemand hat bisher hinter meiner Person etwas anderes vermutet als eben den Impresario Franklin Houster, der mit seinem Schützling direkt aus Indien hierher nach Cleveland gekommen ist.
Bedenken Sie ferner, welch eine Leistung es für Tuma Rasantasena und mich bedeutete, von dem Keller dieses Gebäudes aus einen Schacht nach dem Kanalisationsrohr zu graben, und einen zweiten dann bis unter den Fakirpavillon! Diese Arbeit konnten wir zudem nur des Nachts vornehmen, und dazu noch in steter Furcht vor den giftigen Gasen, die dem Schlammwasser der halb gefüllten Kanäle entströmten, und vor einer Überraschung durch eine Kolonne der Kanalisationsreiniger. Vergessen Sie auch nicht, daß ich Tuma Rasantasena die Rolle, die er an dem Tage seiner Einsargung zu spielen hatte, wie ein gewissenhafter Regisseur eindrillen und ihn nachher vor jedem fremden Blick in diesem einsamen Gehöft ängstlich verbergen mußte.
Und – wenn Sie nur das Wenige, das ich Ihnen eben andeutete, genügend zu würdigen verstehen, dann werden Sie auch begreifen, wie stolz ich darauf war, mein Werk bisher so glänzend gefördert zu haben.
Jetzt“ – der junge Ingenieur verbeugte sich leicht gegen Alice hin – „haben Sie mir die Überzeugung aufgezwungen, daß ich für einen – na, sagen wir für einen Hochstapler großen Stils doch nicht die nötige Umsicht besitze, denn diese Geschichte mit dem Seidenfädchen Ihres Sonnenschirmes ist –“
„Halt, mein Lieber!“ fuhr der Millionär polternd dazwischen. „Über Ihre Fähigkeiten zu urteilen, gestatten Sie wohl besser anderen Leuten. Die Geschichte ist übrigens zu interessant und zu spannend, um sich auch nur das geringste davon entgehen zu lassen. Da wäre zunächst –“
„Also hören Sie weiter. Den besten Überblick über das, was sich sozusagen hinter den Kulissen des Fakirpavillons abspielte, erhalten Sie wohl, wenn ich Ihnen jenen Tag schildere, an dem der Indier das Experiment begann. Es war ein Donnerstag, und zwar der erste Donnerstag nach der Eröffnung der Ausstellung. Für mittags zwölf Uhr hatten Riesenplakate die Einsargung Tuma Rasantasenas angekündigt. Eine Stunde vorher verabreichte ich hier in diesem Zimmer meinem Fakir eine Dosis eines unschädlichen Schlafpulvers, die –“
„Schlafpulver – Schlafpulver! Das ist’s ja, was uns noch zu den besten Freunden machen wird, woran ich sofort gedacht habe!“ rief Weather. „Aber lassen Sie sich nicht stören. Wenn Sie mich jetzt auch noch nicht begreifen, bald soll Ihnen ein Licht aufgehen, und zwar ein sehr wertvolles Licht, mein Bester, so wahr ich Percy Weather heiße und in New York eine chemische Fabrik besitze.“
„Also mein Fakir erhielt eine Dosis eines unschädlichen Schlafpulvers, dann brachen wir nach der Ausstellung auf, wo uns in dem Pavillon bereits eine Korona der allergelehrtesten Mediziner und eine dicht gedrängte Menge empfing. Tuma Rasantasena lehnte während der nun folgenden Vorbereitungen für seine Einsargung und der erläuternden Ansprache Professor Weaslers in völlig unbeweglicher Haltung und mit halbgeschlossenen Augen an einem Pfeiler, als ob ihn die ganze Sache auch nicht das mindeste anginge. Mit seiner schlanken, in den hellen Burnus gekleideten Gestalt, dem mageren braunen Gesicht und dem dichten schwarzen Vollbart gab er eine Figur ab, die in ihrer starren Ruhe wirklich etwas Geheimnisvolles an sich hatte.
Bereits während der letzten Sätze von Professor Weaslers Rede bemerkte ich, daß der Indier offenbar mit aller ihm zu Gebote stehenden Energie gegen die immer stärker werdende Schlafsucht ankämpfte, und er taumelte fast, als er dann die wenigen Schritte nach dem offenen Sarge hin machte, um sich mit meiner Hilfe in sein gläsernes Gefängnis zu legen. Das Schlafpulver tat eben ganz in der von mir vorher berechneten Weise seine Schuldigkeit.
Nachdem ich das Gewand des Fakirs hierauf geordnet und er die Hände über der Brust gekreuzt hatte, hielt ich ihm eine kleine Glaskugel dicht vor die Augen. Nur wenige Minuten dauerte es, bis ihm die Lider zufielen, und seine regelmäßigen Atemzüge verrieten, daß er in tiefstem, anscheinend durch Hypnose hervorgerufenem Schlafe lag.
Eine Viertelstunde später war der Sarg bereits zugeschraubt, versiegelt und auf die beiden Böcke unten in der mit Holz ausgekleideten Grube gesetzt. Zwölf Stunden später, gegen Mitternacht, watete ich mit der Blendlaterne in der Hand und einer Leiter über der Schulter durch die übelriechenden Wasser der unterirdischen Kanäle bis zu jener Stelle hin, wo wir, Rasantasena und ich, mit unendlicher Mühe und Vorsicht den Schacht bis dicht unter die Gruft des Fakirpavillons getrieben hatten, eine Arbeit, die wir natürlich erst zu Ende führen durften, nachdem der Boden des Fakirgrabes mit Brettern eingedeckt war.
Aber auf weitere Einzelheiten über die Anlage sowohl dieses als auch des in den Keller meines Häuschens hier mündenden Schachtes will ich mich nicht einlassen, möchte nur bemerken, daß es für mich als Tiefbauingenieur kein großes Kunststück darstellte, diese beiden Schächte ganz unseren Zwecken entsprechend und für uneingeweihte Augen vollkommen unauffällig herzustellen.
Mit Hilfe der Leiter stieg ich dann so weit empor, bis ich den aus Brettern bestehenden Bodenbelag der Gruft über mir mit den Händen erreichen konnte. Eine feine Stichsäge, die fast geräuschlos arbeitete, beseitigte auch dieses letzte feste Hindernis, und durch das aus dem Fußboden herausgeschnittene Loch gelangte ich, nachdem ich einen der Teppiche, mit denen auf meine Veranlassung der Fußboden der Grube angeblich nur zur Dekoration bedeckt war, zurückgeschlagen hatte, ohne weitere Anstrengungen in das Grab Rasantasenas und damit auch in das Innere des Pavillons.
Eine ganze Weile stand ich zunächst noch mit abgeblendeter Laterne regungslos, angespannt lauschend neben dem Glassarge da.
Doch meine Angst, das leise Kreischen der Säge könnte von dem Wächter oben gehört worden sein, war überflüssig. Ganz deutlich drang jetzt das Geräusch der gleichmäßigen, langsamen Schritte des Mannes an mein Ohr, der da über mir ahnungslos den gut verschlossenen Pavillon umkreiste, um jedem Unberufenen den Zutritt zu verwehren.
Und diese schweren Schritte, unter denen der Kies knirschte, diese einzigen Laute, die ich da unter der Erde in der schweigenden Nacht vernahm, beruhigten mich vollkommen. Sicherlich hat auch damals um meine Lippen wieder jenes ironische Lächeln gespielt, das Sie, Alice, vorhin zu erwähnen beliebten.“
Das junge Mädchen nahm diesen Hieb schweigend hin.
„Jetzt, da ich mich ganz sicher fühlte“, setzte Harry Sanders seine Erzählung fort, „ließ ich den Lichtstrahl meiner Laterne über das Kopfende des Sarges, über des Indiers Gesicht gleiten, Aber dessen Augen blieben geschlossen, keine Bewegung deuten darauf hin, daß er schon erwacht war. Mit einem Schraubenzieher begann ich nun vorsichtig die Schrauben zu lösen, die die oberste, sehr breite Glasplatte des Sargdeckels mit den Seitenteilen verbanden, was auch weiter keine Schwierigkeiten machte, für den in den gläsernen Sarg Eingesperrten freilich selbst mit den besten Werkzeugen ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre. Schon nach wenigen Minuten konnte ich die schwere Glasscheibe mühelos abheben. Tuma Rasantasenas versiegeltes Gefängnis war damit gesprengt, ohne daß die Siegel irgendwie beschädigt zu werden brauchten.
Meine nächste Aufgabe war nun, den noch immer wie ein Murmeltier schlafenden Indier wachzubekommen. Auch das gelang mir durch ein Ätherfläschchen, welches ich ihm recht dicht unter die Nase hielt. Das folgende brauche ich wohl nur anzudeuten, da alles übrige sich nach diesen Aufklärungen leicht zusammenreimen läßt. Also, – mit meines Fakirs Unterstützung brachte ich dann die in das helle Gewand Tumas gehüllte Gliederpuppe, der der von Kastan modellierte Wachskopf aufgesetzt war, in dem Sarge unter, ordnete sorgfältig den Faltenwurf des Burnus nach der Vorlage einer der am Vormittag des Einsargungstages hergestellten Photographien, und verließ dann mit meinem Gefährten die Gruft auf demselben Wege durch die Kanäle, nachdem wir den Sarg und auch die Fußbodenöffnung wieder verschlossen, letztere auch mit dem Teppich überdeckt und die Spuren der Säge so den Blicken entzogen hatten.
Sie sehen also, Herr Weather, so schlau wie Professor Weasler, der heute die photographischen Aufnahmen zur Kontrolle über die völlige Unanfechtbarkeit des Experiments so warm empfahl, war ich schon lange! – Um nun endlich mit meiner Beichte fertig zu werden: Selbstverständlich habe ich dem Publikum den wirklichen „schlafenden Fakir“ nur an den Tagen gezeigt, wo der Glassarg in den Pavillon zur Untersuchung seines Inhalts durch die Ärzte der Überwachungskommission hinaufgezogen wurde, und das war eben vor einer Woche und heute. Sonst bewunderten die verehrten Ausstellungsbesucher nichts als eine tadellos gearbeitete Puppe. Sie werden sich wohl schon selbst gesagt haben, daß ich natürlich für die beiden Tage, an denen der Indier mit seinem gläsernen Gefängnis aus der Gruft hinaufgewunden wurde, die Wachspuppe wieder gegen meinen Helfershelfer eintauschen mußte. Dies geschah, nachdem ich ihn vorher in derselben Weise für den „hypnotischen Schlaf“ empfänglich gemacht, das heißt, ihm dieselbe Dosis des Schlafpulvers eingegeben hatte. Und zurzeit stehe ich Ihnen daher eigentlich als vollkommen makelloser und ehrlicher Impresario des berühmten indischen Fakirs gegenüber, denn augenblicklich ruht in dem Glassarge ja wirklich der „lebende“ Tuma Rasantasena. Allerdings nicht mehr für lange, denn nach einigen Stunden werde ich wieder meine nächtliche Wanderung durch die Kanäle antreten und meinen Fakir befreien.
Hätten Sie also, Alice, Ihre Drohung von vorhin wahr gemacht und wären zu Professor Weasler gegangen, um ihm von Ihrer Beobachtung mit dem aus dem Sarge verschwundenen Seidenfädchen Mitteilung zu machen, so würde der Herr Professor, falls sein Argwohn erwacht und von ihm der Glassarg und die Gruft einer eingehenden Besichtigung unterzogen wäre, selbst dann mich nur als Betrüger haben entlarven können, wenn er eben auf die Idee gekommen wäre, den mit Teppichen belegten Bretterboden des Grabes sich genauer anzusehen, diesen Bretterboden, aus dem auch meine Geschicklichkeit nicht so schnell die runde Spur der Stichsäge und damit den Hinweis auf den darunter befindlichen Schacht nach dem Kanalisationsrohr entfernen konnte.
Nur die Furcht vor dieser Entdeckung hat mir heute ein Geständnis abgezwungen, das mir mit seinen für mich noch gar nicht zu überschauenden Folgen wahrlich nicht leicht geworden ist, besonders deswegen nicht, weil mein bis in die kleinsten Kleinigkeiten so fein ausgearbeiteter Plan auch die in der Nacht vor der Beendigung des Fakirexperiments notwendige Beseitigung aller verräterischen Hindeutungen auf die Lösung meiner Geheimnisse durch Einfügen neuer Bretter anstelle der durchsägten und durch Ausfüllen der beiden Schächte vorgesehen hatte.
Wären Sie nicht dazwischengetreten, Alice, der Impresario Franklin Houster hätte sicherlich unangefochten mit einem glänzenden Gewinn den Staub Clevelands von den Füßen schütteln können, und wäre dann vielleicht in einem weiteren Jahre durch einen ähnlichen genialen Bluff … zum Millionär und ernsthaften Bewerber um Ihre Hand geworden. Wie gesagt, nun haben Sie mir den Spaß insofern verdorben, als Sie meine Zukunftsabsichten ebenso wie meine bisherigen Erfolge kennen. Jedenfalls habe ich Sie nicht vergessen, Alice. Was ich tat, geschah alles nur, um Sie zu erringen. Und ich bedaure nur das eine, daß mir die Überraschung, plötzlich als Mann, der „Geld zu machen versteht“, auftreten zu können, verdorben ist.
Weiter habe ich den Herrschaften nichts zu offenbaren. Höchstens noch die eine bittere Wahrheit als Bemerkung so ganz nebenbei, daß mein Schicksal wirklich an einem seidenen Fädchen hing, – falls eben jemand anders und nicht gerade Sie, Alice, dieses seidene Fädchen verloren hätte, über das ich nur zu leicht ins Verderben gestolpert wäre.“
10. Kapitel.
Ein Feind von früher.
„Verderben ist gut!“ sagte der alte Weather mit behaglichem Schmunzeln und einem Blick, der die schlanke Gestalt Harry Sanders beinahe zärtlich umfaßte. „Ich glaube im Gegenteil, mein Lieber, daß dieses Seidenfädchen von dem Sonnenschirm meiner Tochter Ihnen sehr viel Glück bringen wird, falls Sie eben klug genug sind, auf meine Vorschläge einzugehen. – Vorhin, als Sie zum ersten Male das Schlafpulver erwähnten, mit dem Sie Ihren famosen Fakir für den hypnotischen Schlaf empfänglich gemacht haben, ist mir nämlich eine sehr aussichtsvolle Idee gekommen. Ich besitze, wie Sie wissen, in New York eine chemische Fabrik, und kürzlich haben da meine Herren Chemiker ein neues, für unsere heute so überaus nervöse Menschheit geradezu unentbehrliches Medikament zusammengebraut, das seinen bereits vielfach erprobten Wirkungen nach eine großartige Neuerung darstellt.
Aber ohne eine Riesenreklame ist mit einem solchen Präparat kein Geschäft zu machen, das wissen Sie auch! Und zu dieser Riesenreklame sollen eben Sie mir verhelfen! Etwas wirklich noch nie Dagewesenes soll es werden, etwas, wovon die ganze amerikanische Presse notwendig Notiz nehmen muß, etwas, das einen wahren Sturm hier in Cleveland und im ganzen Osten der Vereinigten Staaten entfachen, worüber die Gassenjungen auf der Straße und der Millionär in seinem Palast mit demselben beifälligen Lachen sprechen werden!
Ein echt amerikanisches Geniestückchen habe ich mir da eben ausgesonnen, und ich will es mich auch eine gehörige Stange Geldes kosten lassen, da ich unsere Verhältnisse hier gut genug kenne, um mit einer lohnenden Verzinsung der aufgewendeten Gelder bestimmt rechnen zu können! –
Passen Sie auf, mein Bester, wir beide werden durch das Fakirschlafpulver unsere Schäfchen schon ins Trockene bringen, – kein Schäfchen, wett’ ich, sondern einen ganz gehörigen Hammel!“
Percy Weather hatte sich in eine wahre Begeisterung hineingeredet, wurde jetzt aber durch einen kühl geschäftsmäßigen Einwurf des jungen Ingenieurs ziemlich stark ernüchtert.
„Freuen Sie sich nicht zu früh! Bevor ich die Einzelheiten Ihres Planes nicht kenne und nicht weiß, wie meine Beteiligung am Gewinn geregelt werden soll, gehe ich auf nichts ein, auf nichts. Ich bin Geschäftsmann wie Sie, und muß das auch Ihnen gegenüber bleiben, bis ich so viel verdient habe, daß auch ich … eine gute Partie bin.“
„Allerhand Achtung, junger Mann!“ rief der Millionär. „Das muß man Ihnen lassen: bescheiden oder ängstlich treten Sie nicht auf, trotzdem Sie doch alle Ursache hätten, mir als Ihrem zukünftigen Schwiegervater möglichst entgegenzukommen. – Aber dieser – na, sagen wir „stark ausgeprägte Geschäftssinn“ stört mich gar nicht! Im Gegenteil – Sie gefallen mir immer besser.“
Nun entwickelte er dem immer erstaunter aufhorchenden Sanders die Idee zu der beabsichtigten Riesenreklame in kurzen Worten und in einer so scharf durchdachten Art und Weise, daß der doch wirklich recht gerissene Ingenieur sich eingestehen mußte, hier einen völlig ebenbürtigen Kompagnon gefunden zu haben.
„Also, wie gesagt, Sanders“, schloß Weather jetzt immer vertraulicher werdend seine Ausführungen, „ich trage die ganzen Unkosten und ebenso den Verlust der dreißigtausend Dollar, die Sie auf der hiesigen Union-Bank[7] deponieren mußten als Reugeld für den Fall, daß Tuma Rasantasenas Experiment sich als Humbug herausstellt. Dafür treten Sie als Geschäftsführer mit einem Anfangsgehalt von fünfzehntausend Dollar jährlich in meine chemische Fabrik ein und erhalten außerdem für Ihre Einwilligung in meine Vorschläge eine einmalige Abfindung von zweimalhunderttausend Dollar. – Ich meine, damit können Sie wohl zufrieden sein! – Und alle die Drucksachen, die wir ja notwendig gebrauchen, lasse ich nun schleunigst von meinen Angestellten in New York, auf deren Verschwiegenheit ich bestimmt rechnen kann, anfertigen und nachher auch an Ort und Stelle derart verteilen, daß unser schönes Plänchen nicht vorzeitig verraten wird. – Hand her, Mann! Schlagen Sie ein!“
Schon streckte der ehemalige Leutnant die Hand aus, als draußen im Flur plötzlich so anhaltend die Glocke schrillte, daß Sanders mit einem „Entschuldigen Sie mich einen Augenblick“ hinauseilte, nachdem er Perücke, Bart und Brille wieder angelegt hatte.
Sehr bald kehrte er zurück.
„Bitte, – treten Sie doch in dieses Kabinett, meine Herrschaften“, sagte er etwas verstört. „Ich habe Besuch erhalten. Ein Unbekannter ist draußen, der angeblich wichtige Dinge mit mir zu besprechen hat. Lange wird die Unterredung ja nicht dauern.“
Vater und Tochter verschwanden in dem Nebenraum.
Dort meinte der alte Weather, indem er nachdenklich sein Kinn streichelte …
„Hm –, fandest Du nicht auch, Alice, daß der Harry recht betreten aussah. Der neue Gast scheint ihm nicht angenehm zu sein. Will doch so ein wenig den Lauscher spielen.“
Damit stellte er sich dicht an die Tür.
„Aber Pa!“ sagte das junge Mädchen vorwurfsvoll. „Du wirst doch nicht …! Horchen – das tut man nicht!“
„Stimmt! Als Privatmann nicht. Aber ich bin jetzt der Kompagnon Deines Anbeters geworden, mein Kind, und das ändert die Sache. Kann ich wissen, ob der Harry nicht vielleicht irgendwelche Dummheiten macht, die unsere Pläne stören?! –
Setz’ Dich nur ruhig dort hin. Ich bin nur vorsichtig …!“
* * *
Inzwischen hatte der Fremde, ein Mann in einer blauen Arbeiterbluse mit einem rötlichen Vollbart, es sich in dem Arbeitszimmer Sanders in einem Sessel bequem gemacht.
Der angebliche Impresario lehnte ihm gegenüber am Schreibtisch und betrachtete mit unbestimmter Angst das frech lächelnde Gesicht dieses Besuchers, dessen ganzes Benehmen etwas eigentümlich Herausforderndes hatte.
„Mit wem habe ich das Vergnügen?“ fragte Harry Sanders jetzt kurz, indem er eine möglichst sichere Haltung anzunehmen suchte.
Der Fremde grinste noch stärker.
„Vergnügen?! – Hm –?! Ob’s für Sie gerade ein Vergnügen werden wird – wer weiß!“ meinte er schadenfroh. „Jedenfalls tut mein Name vorläufig nichts zur Sache.“
Sanders runzelte drohend die Stirn.
„Sie schlagen mir gegenüber einen Ton an, der mir nicht zusagt, Mann! Entweder Sie nennen Ihren Namen und werden überhaupt höflicher, oder aber … Sie fliegen unweigerlich hinaus!“
„So? Wirklich hinaus?!“ spottet der andere.
„Allerdings. Meine Geduld ist zu Ende und …“
„… und überhaupt nicht sehr groß, Master Harry Sanders, nicht wahr?!“ hohnlachte der Mensch kaltblütig.
Der junge Ingenieur war bei den letzten Worten des Unbekannten fast entsetzt zusammengefahren. Umsonst suchte er seine Fassung wieder zurückzuerlangen. Erst nach einer Weile gelang es ihm sich zu einer Entgegnung aufzuraffen.
„Harry Sanders? – Ich heiße Franklin Houster, wie Ihnen bekannt sein dürfte“, meinte er kühl.
„Allerdings. Hier nennen Sie sich so. – Doch genug des Geschwätzes. Ich wollte Ihnen nur sagen, daß ich Ihren Fakir-Schwindel längst entdeckt habe, längst …!“
Sanders stützte sich schwer auf den Schreibtisch. Vor seinen Augen flimmerte es, zuckten feurige Sterne auf … In seinen Ohren sang das Blut … Und nur ein Gedanke jagte ihm durch den Kopf, ein Gedanke, der ihm das Herz schneller schlagen ließ … „Verloren … vielleicht alles verloren!“
Trotzdem zwang er sich zu einem selbstbewußten Lächeln.
„Fakir-Schwindel?! Was soll das heißen?! Ich verstehe Sie nicht!“ meinte er mit leicht zitternder Stimme.
„Werden’s bald begreifen, kalkulier’ ich, sogar sehr bald“, entgegnete der Fremde langsam, jedes Wort förmlich mit Wohlbehagen reckend. „Ich kenne nämlich zufällig dort hinten in der unbebauten Hornefferstraße einen Zugang zu dem unterirdischen Kanalnetz der Stadt Cleveland, Master Harry Sanders, durch den ich mir zuweilen in die Schächte einzudringen erlaube. – Na, geht Ihnen jetzt ein Licht auf?“
Der ehemalige Marineleutnant hatte jetzt, wo er sich einer ernstlichen Gefahr dicht gegenübersah, plötzlich seine ganze Kaltblütigkeit wiedererlangt. Fraglos – dieser Mann, wahrscheinlich ein Kanalarbeiter, war dem Geheimnis Tuma Rasantasenas auf die Spur gekommen und wollte nun versuchen, aus der Geschichte eine gehörige Summe Geldes herauszuschlagen, – mithin nichts als eine Erpressung.
Und so sagte Harry Sanders denn ganz gefaßt, indem er sein Gegenüber scharf fixierte, da er sich zunächst Gewißheit verschaffen wollte, wie weit der Mann eigentlich Bescheid wußte …
„Meinetwegen können Sie so oft Sie wollen die Kanäle besuchen. Was geht das mich an?!“
„Ich denke recht viel. Es dürfte Sie interessieren zu hören, daß ich Sie und Ihren Helfershelfer letztens[8] durch den Schlamm waten sah, bewaffnet mit einer Leiter und einer Laterne …“
Harry Sanders atmete schwer. Und erst nach einer ziemlich langen Pause fragte er dann …
„Sie sind Kanalarbeiter, nicht wahr?“
Der Fremde verzog sein Gesicht zu einem widerlichen Grinsen.
„Ich bin stets in dem Berufe tätig, der gerade ein nettes Sümmchen abzuwerfen verspricht“, erwiderte er höhnisch.
„Mann“, rief der junge Ingenieur aufgebracht, dem jetzt vor Wut das Blut zu Kopfe stieg, „Sie spielen mit mir wie die Katze mit der Maus. – Wie wollen Sie beweisen, was Sie da eben behaupteten?“
„Ach so – Sie meinen, daß die Fakir-Sache nichts als purer Schwindel ist! – Nun, schwer wird mir das nicht gerade fallen. Ich sagte Ihnen ja schon, daß ich Sie mit dem gelbbraunen Burschen zu einer Zeit in den Kanälen gesehen habe, als der famose Fakir eigentlich in seinem Glassarg liegen sollte. Nun – eine Wachspuppe tut’s ja auch …“
Sanders biß die Zähne so fest in die Unterlippe, daß er plötzlich einen leisen Blutgeschmack auf der Zunge spürte.
„Diese ganze Geschichte läuft doch nur auf eine Erpressung hinaus!“ sagte er finster. „Wieviel verlangen Sie für Ihr Schweigen?“
„50 000 Dollar“, antwortete der andere bestimmt.
„Gut, Sie sollen Sie haben. Ich werde Ihnen eine Anweisung auf die Union-Bank geben.“
Zufällig blickte Harry Sanders in demselben Moment nach der Tür des Nebenraumes, in dem sich Alice Weather und ihr Vater befanden.
Diese Tür hatte sich lautlos so weit geöffnet, daß der ehemalige Leutnant des alten Weathers Gesicht deutlich sehen konnte. Blitzschnell tauschten die beiden Männer einen Blick aus. Sie verstanden sich sofort. Weather lächelte schadenfroh und lehnte die Tür wieder an, so daß der Fremde, der mit dem Rücken nach dem Nebengemach hin saß, nichts auffälliges entdecken konnte, selbst wenn er sich plötzlich umgedreht haben würde.
Sanders entnahm jetzt seiner Brieftasche ein Formular, füllte es aus und reichte es dann dem Unbekannten hin.
„Überzeugen Sie sich – richtig ausgestellt“, sagte er kurz.
Der Fremde las die Anweisung sorgfältig durch und schob sie dann in die Tasche. Aber daran, seinen Sessel zu verlassen, dachte er nicht. Im Gegenteil schlug er gemütlich ein Bein über das andere und fragte mit übertriebener Höflichkeit …
„Ihr Genosse, der Fakir, liegt zur Zeit wirklich in dem Sarge, nicht wahr?“
Sanders nickte nur. – Was wollte der Mann noch weiter? – Er war wirklich gespannt darauf.
„Dann sind wir hier also jetzt ganz allein, was mir sehr angenehm ist.“
Wie spielend hatte der unheimliche Besucher dabei einen Revolver aus der Tasche gezogen, den er jetzt auf Sanders Brust richtete.
„Bleiben Sie stehen und rühren Sie kein Glied, mein Lieber“, fuhr er höhnisch[9] fort. „Die blauen Bohnen in diesem Dinge sitzen ziemlich locker. Und nun gestatten Sie, daß ich mich Ihnen endlich vorstelle. Mein Name ist Thomas Sinter, oder auch William Harper, ehemalig Kapitän der Jacht „Ariadne“, die mir leider durch Ihr Dazwischentreten nicht zu den Schätzen des Goldschiffes verhalf, wie ich es gehofft hatte. Wir haben mithin noch eine alte Rechnung zwischen uns zu begleichen, Herr Leutnant Harry Sanders. Daß ich Sie stets in liebevoller Erinnerung behalten würde, schrieb ich Ihnen ja schon damals vor zwei Jahren.“
Die bisher so höhnische Sprache des hartgesottenen Schurken wurde plötzlich drohend und brutal.
„Den Streich, den Sie mir und meinen braven Jungens spielten, habe ich Ihnen nicht vergessen. Die Stunde der Rache ist da! Bevor ich jedoch das tue, was Ihnen zu erraten nicht schwer werden dürfte, will ich Ihnen noch so einige hübsche Mitteilungen machen, denen Sie fraglos voller Teilnahme lauschen werden. – Schon damals umschlich ich jede Nacht heimlich dieses Haus, als Sie noch mit Ihrem Genossen dabei waren den Schacht nach dem Kanal hier im Keller zu graben. Sie waren nicht vorsichtig genug. Die ausgehobene Erde, die Sie im Garten nachher verteilten, verriet mir Ihre Maulwurfstätigkeit. Und daher machte ich mir die Mühe, auch Ihrem weiteren Tun und Treiben in den Kanälen nachzuspüren. Sehr bald hatte ich alles entdeckt. Aber ich ließ mir mit dem heutigen Besuche Zeit, wollte warten, bis Sie kurz vor dem endgültigen[10] Erfolge Ihres feinen Schwindels standen. Jetzt, mein Lieber, habe ich Ihren Scheck in der Tasche. Und falls man Sie dann nachher, wenn ich längst über alle Berge bin, hier mit einem hübschen kleinen Loch im Schädel auffindet, wird jeder denken, daß Sie sich selbst entleibt haben, wenn ich eben diesen Revolver neben Ihre Leiche hinlege und der Polizei ein Brieflein zugehen lasse des Inhalts, daß ein Unbekannter Ihre Betrügerei entdeckt und Ihnen erklärt hätte, den wahren Sachverhalt unter allen Umständen sofort der Öffentlichkeit preisgeben zu wollen. Der Selbstmord aus Verzweiflung über das fehlgeschlagene Unternehmen ist dann so sehr verständlich, – nicht wahr?! – Und – selbst wenn die schlaue Polizei doch Argwohn schöpfen sollte, was schadet das mir, der dann …“
Weiter kam er Verbrecher nicht.
Urplötzlich wurden von rückwärts seine Arme fest umklammert, so daß er die Hände nur ein geringes bewegen konnte. In demselben Moment war auch Harry Sanders beiseite gesprungen, der jetzt Percy Weather half, den völlig überraschten Sinters zu entwaffnen.
Bald lag der Schurke, in ohnmächtiger Wut an seinen Banden zerrend, gefesselt an Boden.
11. Kapitel.
Enthüllungen.
Den Sessel, den bisher Thomas Sinters innegehabt hatte, nahm jetzt Percy Weather ein.
Mit einem Lächeln, das nichts Gutes verhieß, schaute der Millionär auf den Gefangenen, der sich, nachdem er das nutzlose seiner Befreiungsversuche eingesehen hatte, nunmehr ziemlich ruhig verhielt.
„Freut mich, Sinters, auch mal Eure Bekanntschaft gemacht zu haben“, meinte der alte Weather, indem er die Hände über seiner seidengestickten Weste faltete. „War ’ne nette Überraschung, Mann, – stimmt’s? – Ja, und für mich ein Genuß, all das mitanzuhören, was Ihr mit meinem Kompagnon Harry Sanders vorhattet. Fürchte, Euer Schuldkonto macht Euch reif für den Stuhl.“ (In Amerika wird die Todesstrafe bekanntlich durch Elektrizität vollstreckt, wobei die Verbrecher auf einem sogenannten „elektrischen Stuhl“ festgeschnallt werden.)
Dann wandte er sich Harry zu, der in leisem Gespräch mit Alice am Fenster stand.
„Hören Sie, Sanders, nehmen Sie dem lieben Gast zunächst einmal wieder den Scheck ab und verbrennen Sie den Wisch. In dieser Beziehung kann man nicht vorsichtig genug sein.“
Der junge Ingenieur tat’s ohne daß Sinters eine Bewegung wagte.
„Sind sehr zahm geworden, Mann“, lachte Weather. „Ja, oft kommt’s so ganz anders als man denkt.“
Harry führte Alice jetzt in das Nebenzimmer und schloß die Verbindungstür. Dann sagte er zu dem Millionär, der sich eben eine lange, dunkle Importe ansteckte …
„Was tun wir nun mit dem Burschen? – Böse Sache das in unserer Lage.“
„Stimmt. Will überlegt sein. – Machen Sie mal einen Vorschlag. Vielleicht denken wir an dasselbe“, meinte Weather, behaglich den Rauch von sich blasend.
„Nun – der Polizei können wir den Mann vorläufig nicht übergeben. Das dürfte ausgeschlossen sein. Sonst ist’s mit der Reklame-Idee vorbei.“
„Sicherlich.“
Sinters, der regungslos dagelegen hatte, hob jetzt den Oberkörper ein wenig.
„Ich schwöre, daß ich schweigen werde, wenn Sie mich freilassen“, sagte er ängstlich. „Sie können sich auf meinen Schwur verlassen. Ich will auch …“
Weather machte eine abwehrende Geste mit der Hand.
„Auf Sie ist erst Verlaß, wenn Sie den Stuhl hinter sich haben“, schnitt er dem Gefangenen jedes weitere Wort ab. „Dieses Mal wird’s Ihnen nicht wieder gelingen zu verschwinden, – darauf können Sie Gift nehmen.“
Thomas Sinters schien ein anderer Gedanke gekommen zu sein.
„Bedenken Sie, daß der ganze Schwindel mit dem Tuma Rasantasena aufgedeckt wird, wenn Sie mich der Polizei ausliefern“, sagte er mit bösem Lächeln. „Es wird Ihnen also wohl nichts anderes übrigbleiben, als mich laufen zu lassen, falls Sie mich eben nicht kaltblütig abschlachten und irgendwo im Garten verscharren wollen. Und das traue ich Ihnen doch nicht zu.“
„Danke für die gute Meinung, Mann!“ erwiderte Weather mit den Augen zwinkernd. „Werden uns hüten einen Mord zu begehen. Nein, in den Kanälen gibt’s so schöne stille Plätzchen und so viele freßgierige Ratten, die uns die Arbeit ohne Einladung abnehmen.“
Sinters erbleichte.
„Das … das werden Sie nicht wagen …“, stotterte er.
„Nicht wagen?! Pah! Was kann uns dabei geschehen? Nichts, gar nichts! – Ich wette, daß in zwölf Stunden von Ihnen nur noch ein paar kahle Knochen übrig sind. Habe mal so eine Leiche gesehen, die in den New-Yorker Kanälen kaum sechs Stunden gelegen hatte. War nicht mehr wiederzuerkennen.“
Der Verbrecher ließ sich matt zurücksinken und schloß wie betäubt die Augen.
Harry Sanders, der schweigend dieser unerquicklichen Aussprache zugehört hatte, fragte jetzt etwas ungeduldig …
„Was tun wir also mit unserem Gefangenen, Master Weather?“
„Nun – wir halten ihn hier solange fest, bis … bis wir mit allem im Reinen sind, sehr einfach. In den Kellern wird sich doch wohl irgendein Winkel finden, wo der Mann verstaut werden kann.“
„Freilich. Es gibt da unten eine alte Räucherkammer mit einer schweren Holztür. Dürfte sehr geeignet sein für unsere Zwecke“, erklärte Harry Sanders nach kurzem Nachdenken.
„Gut denn.“ – Weather richtete darauf das Wort an Thomas Sinters, der sich von der vorhin ausgestandenen Angst schon wieder erholt hatte.
„Wollt Ihr gutwillig mitgehen, oder sollen wir Euch tragen?“ fragte er, indem er aufstand und den Revolver des Verbrechers zur Hand nahm.
Zu einer Antwort kam Sinters nicht.
Plötzlich wurde die nach dem Korridor führende Tür aufgerissen. In deren Rahmen stand ein kleines Männchen, das jetzt mit einer harten Kommandostimme ins Zimmer rief …
„Was geht hier vor? – Hände hoch – oder ich schieße!“
Weather, der in der Rechten des neuen Eindringlings eine Schußwaffe glänzen sah, ließ schnell den Revolver fallen. Auch Harry hatte wie automatisch die Arme hochgestreckt, da er wußte, daß in den gesegneten Gefilden der Vereinigten Staaten mit Leuten, die so energisch diesen Befehl „Hände hoch!“ vorbrachten, nie zu spaßen war.
Der kleine Mann trat jetzt vollends ins Zimmer. Mit einemmal schüttelte er verwundert den Kopf.
„Master Percy Weather …? Sehe ich recht?“ fragte er erstaunt.
„Percy Weather in Person. Und wenn ich nicht sehr irre, sind Sie der Detektiv, den Alice in Diensten hat.“
Der Millionär lachte dröhnend und ließ beruhigt die Arme sinken, welchem Beispiel auch Sanders folgte.
Fred Wilson schaute noch immer verwundert von einem zum andern. Vorläufig begriff er nicht, was hier vorgefallen war.
Weather schien die Ratlosigkeit des Beamten außerordentlich zu amüsieren.
„Was führt Sie denn eigentlich hierher, Master Wilson?“ fragte er jetzt absichtlich, um dem Detektiv bei einer mit Sicherheit zu erwartenden ähnlichen Frage zuvorzukommen.
Der Detektiv deutete auf den Gefangenen.
„Der Mann dort, bei dem Sie mir ja bereits die Hauptarbeit abgenommen haben.“
„Konnte ich mir denken“, meinte der Millionär. „Ein guter Fang, kalkulier’ ich, Wilson!“
„Stimmt, Master Weather. Bin ja hinter dem Thomas Sinters schon jahrelang her. War ’ne mühselige Jagd, Heute schlich ich ihm abermals nach, und da er gar nicht wieder aus diesem Hause herauskommen wollte, mußte ich schon mal nachsehen, wo er geblieben war. Fand die Haustür unverschlossen, und … da bin ich eben.“
Percy Weather begab sich jetzt mit dem Detektiv in das Nebenzimmer, wo er diesen dann in die Sachlage einweihte.
„Tausend Dollar für Sie, Wilson, wenn Sie uns den Sinters hier vorläufig bewachen. Nachher werden Sie schon eine Ausrede finden, weshalb der Mann so spät der Polizei übergeben wurde“, sagte er zum Schluß, um auch des Detektivs letzte Bedenken zu beseitigen.
Wilson zauderte noch.
„Master Weather, ich kann mich unmöglich insofern zu Ihrem Mitschuldigen machen, als ich jetzt doch eigentlich verpflichtet bin auch diese Fakir-Sache zur Anzeige zu bringen. Für mich kann’s die übelsten Folgen haben, wenn …“
Da mischte sich Alice in das Gespräch, die bisher schweigend zugehört hatte.
„Pa, ich lege noch tausend Dollar zu. Vielleicht findet Master Wilson dafür einen Ausweg.“
Der Detektiv erklärte sich nunmehr für einverstanden.
„Sonst sieht es so aus, als ob ich Ihre Notlage ausnutzen wollte, Master Weather“, meinte er.
Eine Viertelstunde darauf befand sich Thomas Sinters in der sicheren Räucherkammer, aus der kein Entrinnen gab.
* * *
Eine Woche später gegen elf Uhr vormittags war der Fakirpavillon in der Gewerbeausstellung zu Cleveland wieder von einer neugierigen Menge bis auf den letzten Platz gefüllt. Sollte doch heute der Indier aus seinem nunmehr sieben Wochen andauernden Schlafzustand erweckt werden.
Die Beobachtungskommission erschien. Doch vergebens schaute sich Professor Weasler suchend nach dem Impresario Franklin Houster um.
Man wartete fünf Minuten, man wartete zehn Minuten – kein Impresario ließ sich sehen.
Das Publikum wurde ungeduldig. Man schickte einen Eilboten nach dem anderen, alle kamen unverrichteter Sache zurück, von dem Gesuchten hatten sie keine Spur entdecken können.
Professor Weasler bespricht sich flüsternd mit den anderen Herren der Kommission.
Dann gibt er den Arbeitern ein Zeichen, und langsam schwebt der Glassarg aus der Gruft zum Tageslicht empor.
Das Publikum drängt näher heran, schiebt und stößt sich hin und her, nur um den berühmten Fakir jetzt einmal ganz aus der Nähe betrachten zu können. Und dann – niemand weiß, wer’s zuerst ausgerufen hat, dann klingt’s immer lauter, vermischt mit höhnischem Gelächter:
„Eine Wachspuppe – eine Wachspuppe – gar kein Mensch – Schwindel – Humbug!“
Mit zitternden Händen prüft der von alledem ganz fassungslose Weasler die Siegel an dem Sarge.
Sie sind unverletzt – kein Zweifel!
Eiligst schraubt man den Sargdeckel ab, und sofort reißt eine vorwitzige Hand mit einem Ruck den hellen Burnus von der regungslosen Gestalt. Das Lachen wird plötzlich zu einem Brüllen, alles schreit durcheinander, fuchtelt mit den Armen in der Luft herum, denn in dem Sarge liegt in der Tat nichts als eine starre Gliederpuppe, zwei braune Wachshände und ein Wachskopf, der allerdings vollkommen dem des Originals gleicht. – –
Am Nachmittag spricht man in ganz Cleveland von nichts anderem als dieser überraschenden, unerklärlichen Auffindung der Wachspuppe in dem Fakirsarge. In den Restaurants, den Kaffeehäusern und Geschäften, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, ganz besonders aber auf den Promenaden der Ausstellung und vor dem Fakirpavillon sieht man dichte Gruppen von Leuten umherstehen, die lebhaft dieses geradezu unglaubliche, sensationelle Ereignis nach allen Seiten hin erörtern.
Wie mag wohl die Gliederpuppe mit dem so täuschend ähnlichen Wachskopf in den Glassarg gelangt sein, in denselben Glassarg, in dem noch vor acht Tagen ganz zweifellos der lebende Tuma Rasantasena gelegen hat? Weshalb, zu welchen Zwecken mag man den wirklichen Fakir überhaupt gegen die Wachsfigur eingetauscht haben? Wo ist der Impresario geblieben, der noch gestern mit den Herren des Ausstellungsdirektoriums über einzelne Anordnungen für die bevorstehende Erweckung des Indiers verhandelt hat? Und schließlich – wo ist Rasantasena selbst hingeraten?
Das sind alles Fragen, die niemand beantworten kann, Fragen, die um so verwickelter und unerklärlicher werden, je mehr Einzelheiten über die Resultate der sofort von der Überwachungskommission in dieser Angelegenheit aufgenommenen Untersuchung bekannt werden.
Unverzüglich hat man nämlich die Gruft und den Pavillon aufs sorgfältigste nach einem geheimen Zugang durchforscht, hat sogar den Fußboden und den Bretterbelag der Seitenwände der Grube abgerissen, hat die Wächter den umständlichsten Verhören unterzogen – alles vergeblich, alles! Nirgends ein Anhaltspunkt, der auch nur im entferntesten auf eine Erklärung dieser geheimnisvollen Geschehnisse hingedeutet hätte.
Inzwischen ist es fünf Uhr nachmittags geworden.
Halb Cleveland ist jetzt in der Gewerbeausstellung versammelt, und vor dem Fakirpavillon herrscht ein geradezu lebensgefährliches Gedränge.
Mit einem Male hört man in den dichten Menschenmassen hier und da schrille Knabenstimmen, die irgendein Extrablatt ausrufen.
Eine seltsame Bewegung kommt ebenso plötzlich in die Menge, und um jeden der in die Tracht der Messengerboys gekleideten Jungen, die ein dickes Paket großer Zettel unter dem Arm halten, ballt sich ein unentwirrbarer Menschenhaufe zusammen.
Man reißt sich um diese Zettel, überfliegt den Inhalt, schüttelt erst ungläubig den Kopf, liest nochmals langsamer und genauer – und lacht dann aus vollem Halse, schreit dem Nachbar ganz begeistert zu:
„Was sagen Sie nur – das ist doch einmal wieder eine smarte Reklame! Wirklich ein Teufelskerl, dieser Weather mit seinem Fakirschlafpulver!“
Auch der arme Professor Weasler, der bei all den Aufregungen und besonders aus Angst vor einer mehr wie peinlichen Bloßstellung seiner Gelehrtenwürde durch diesen unseligen Indier kaum mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, hat endlich eines der Blätter erhascht. In roten Riesenlettern steht darauf:
„Weathers Fakirschlafpulver ist das allerbeste der ganzen Welt, was die untenstehende Aufdeckung der Geheimnisse des Fakirpavillons der Gewerbeausstellung zu Cleveland untrüglich beweist.“
Dem unglücklichen Professor beginnen die Knie zu zittern. Er ahnt Furchtbares, ahnt, daß die ganze Beobachtungskommission blamiert, unsterblich blamiert ist, hauptsächlich aber er selbst, der noch vor einer Woche so warm, mit so zündender Beredsamkeit für die völlige Unanfechtbarkeit des Experiments Tuma Rasantasenas gesprochen hat.
Mit bebenden Händen liest er jetzt weiter, liest, während ihm Schweißperlen auf die Stirn treten, liest all das, was Harry Sanders damals dem alten Weather und dessen Tochter über die Ausführung seiner genialen Fakirkomödie gebeichtet hat. Nur des Impresarios wahrer Name ist in dieser äußerst packend beschriebenen Schilderung nicht genannt, ebenso sind auch alle Angaben vorsichtig weggelassen, die zu einer Entdeckung seiner Person führen könnten.
Doch in einem Punkte haben die Tatsachen auf diesem Extrablatt allerdings eine völlige Umwandlung erfahren: alles ist so dargestellt, als ob Rasantasenas tiefer Schlaf, durch den sich so viele und bedeutende Ärzte täuschen ließen, lediglich durch „das völlig unschädliche, für jeden an nervöser Schlaflosigkeit Leidenden unentbehrliche“ Weathersche Präparat herbeigeführt wurde, und das ganze Auftreten des Indiers von vornherein nur der Reklame für das Fakirschlafpulver dienen, und das Experiment auch zweckentsprechend den jetzigen Abschluß finden sollte.
Während Professor Weasler noch in dumpfem Brüten auf diese Zeilen hinstarrt, die ihm die Unzulänglichkeit des eigenen Wissens und die Überlegenheit des geistvollen, waghalsigen Impresarios unangenehm klar zum Bewußtsein bringen, legt sich eine Hand schwer auf seine Schulter.
Erschreckt aufblickend, erkennt er einen seiner Kollegen von der Universität, der ebenfalls zu der Überwachungskommission gehörte.
„Aber Weasler – welches Gesicht! Haben Sie denn als Amerikaner wirklich gar kein Verständnis für den Witz dieser Geschichte?“ ruft Doktor Morton gutgelaunt. „Ich muß Ihnen ehrlich gestehen, als ich dieses Reklameblatt gelesen und damit des Rätsels Lösung endlich gefunden hatte, da habe ich wie befreit hell aufgelacht! Sagen Sie doch selbst, Weasler: können wir nicht eigentlich stolz darauf sein, daß unser schönes, freies Land Genies hervorbringt, die zur Erreichung ihrer geschäftlichen Ziele einen derartigen, geradezu kunstvoll ausgeklügelten Reklamefeldzug ins Werk zu setzen wissen?! Fraglos wird ganz Amerika ebenso denken wie ich! Dafür sind wir ja Amerikaner! Deshalb wird es auch hier niemand einfallen, uns Professoren als die bei dem interessanten Experiment mit ihrer Kathederweisheit Hereingefallenen zu verhöhnen, oder etwa diesen Herrn Percy Weather, der mit seinem Fakirschlafpulver jetzt einen Bombenverdienst haben wird, irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen!“
* * *
Schluß.
Mit diesen seinen Behauptungen behielt Doktor Morton vollkommen recht.
Ein halbes Jahr später konnte der alte Weather bei einem glänzenden Festmahl in seinem palastartigen Hause in New York die Verlobung seines einzigen Kindes Alice mit dem Ingenieur Harry Sanders seinen Gästen bekanntgeben.
In der humorvollen Ansprache, die er bei dieser Gelegenheit hielt, kam auch ein Satz vor, der der jungen Braut die heiße Röte in die Wangen trieb.
Dieser Satz lautete …
„Mein Töchterchen hat einen Mann gefunden, wie es so leicht keinen zweiten in Amerika geben dürfte, – einen Mann, der sie erst aus den Händen von Piraten befreien mußte, bevor ich es zuließ, daß sie ihn durch ein kleines Seidenfädchen für immer an sich fesselte, ihn, – diesen Mann mit der eisernen Energie und dem … unausstehlich ironischen Lächeln …!“
* * *
Einen Monat später wieder hauchte Thomas Sinters seine schuldbeladene Seele auf dem elektrischen Stuhle aus.
Druck: P. Lehmann G. m b. H., Berlin.
Verlagswerbung:
|
Vergißmeinnicht-Bibliothek. |
|
|
|
Preis 1 Mark und 25 Pfennig Teuerungszuschlag.
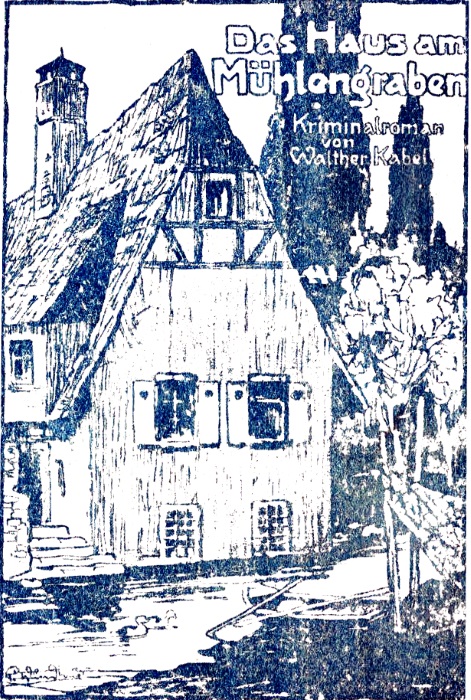
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie vom
Verlag Moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.
Anmerkungen:
- ↑ In der Vorlage steht: „Gade“.
- ↑ In der Vorlage steht: „heute Nachmittag“.
- ↑ In der Vorlage steht: „heute Nacht“.
- ↑ In der Vorlage steht: „Früstückstisch“.
- ↑ In der Vorlage steht: „hatten“.
- ↑ In der Vorlage steht: „aso“.
- ↑ „Unionbank“ / „Union-Bank“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Union-Bank“ geändert.
- ↑ In der Vorlage steht: „letzens“.
- ↑ In der Vorlage steht: „hönisch“.
- ↑ In der Vorlage steht: „endgültigem“.
