Hauptmenü
Sie sind hier
Flecken von einst
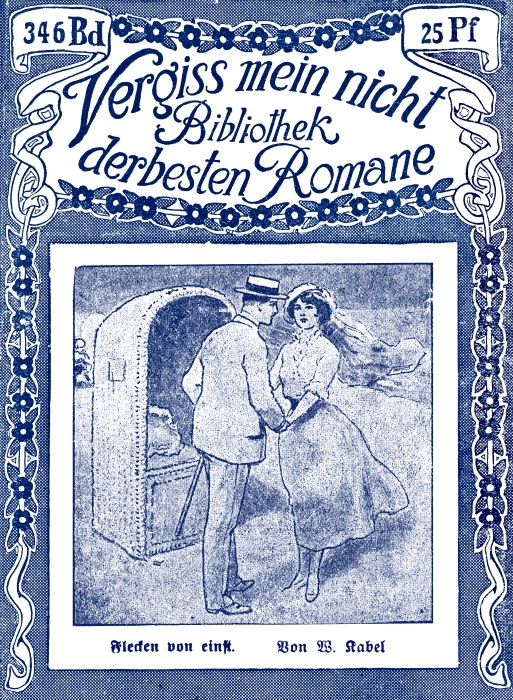
Vergißmeinnicht
Bibliothek der besten Romane
Band 346
Flecken von einst.
Roman von
Walter Kabel.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin 14,
Dresdener Straße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.
Copyright by Verlag mod. Lektüre G. m. b. H., Berlin.
1. Kapitel.
„Unsereiner hat nischt zu sagen, nur … zu hören und zu sehen! Und auch das möchten sie einem gern verbieten. Aber ’s geht zum Glück nich – ne, das bleibt nu mal das Privileg der Dienerschaft. Und dieses Privileg, verehrte Leidensgefährten, genügt für mancherlei, wenn man’s bloß versteht, nämlich das Hören und das Sehen …“
Karl, der Diener, führte mit vornehmer Nachlässigkeit die Zigarre zum Munde, paffte drei Züge in die Luft, sozusagen für jeden seiner Zuhörer eine Rauchwolke, und schaute dabei dieses kleine Auditorium nacheinander an, als ob er die Wirkung seiner wohlgesetzten Rede feststellen wollte.
Die Köchin Marie hob den Kopf von ihrem frommen Erbauungsbuch, warf Karl über den Rand ihrer Stahlbrille hinweg einen strafenden Blick zu und fragte unsicher:
„Prüfülech? Was ist das? Wo haben Sie das aufgeschnappt? Wenn Sie hier schon Unzufriedenheit stiften wollen, tun Sie’s wenigstens auf gut Deutsch …“
Karl lächelte mild. „Privileg heißt Vorrecht, teure Marie. Von Unzufriedenheit stiften kann aber keine Rede sein! Ich wollte nur darauf anspielen, daß, wer hier jetzt in Villa Friedensruh Ohren und Augen son bißchen aufmacht, leicht merkt, was vorgeht.“
Marie klappte ihr Buch laut zu. Das Stubenmädchen Helene aber, ein blondes, blasses Ding mit kecken Augen, beugte sich vor Neugier weit über den Tisch, und der Chauffeur und Gärtner Heinrich Blaschke tat dasselbe, sagte aber noch:
„Raus mit die Wurst, Karl! Was jeht denn vor?“
„Nu, Kinder, sehr einfach: Die Geschichte da oben stimmt nicht mehr!“ Er reckte den rechten Arm dabei zur Decke empor.
„Also Sie meinen, mit die Liebe wird’s flauer, nicht wahr?“ meinte die blonde Zofe eifrig. „Aber – dann hätte ich doch auch was merken müssen, Karl. Ich bin doch auch nicht gerad’ auf’n Kopp gefallen.“
„Ne – das stimmt, – in manche Dinge sind Sie sogar für Ihre neunzehn Jahre schon zu helle. Aber eben nicht für so feinere Beobachtungen, so ’ne Seelenanalysen, wie der gebildete Mitteleuropäer ’s nennt, das heißt, für unbedeutendere Verstimmungen zwischen zwei liebende Herzen, die aber die Ursache zu ernstere Dinge werden können.“
Marie stand auf. „Sie sind ’n Quatschkopf, Karl! Ich gehe schlafen. Gut’ Nacht.“
Sie verließ die Küche und warf die Tür laut ins Schloß.
„Da zieht sie hin mit ihre fromme Schwarte „Christliche Gedanken einer wahrhaft frommen Nachtjungfrau“ … So was zu lesen …! Ich hab’ einmal reingeblickt …! Es ist ein richtiger … Na, ich will den Verfasser nicht beleidigen.“
Helene hatte laut aufgelacht. „Es heißt ja janz anders, Karl. „Nachtgedanken einer wahrhaft frommen christlichen Jungfrau“ … Ich finde manches sehr schön. Letztens hab’ ich ordentlich geweint über ein paar Sätze …“
„Geschmacksache!“ meinte der Diener, der wie ein Schauspieler aussah. „Die Marie war ja früher bei den Eltern unserer Jnädigen. Und diese Hamburger Senatorenfamilien sind fast alle frömmer als fromm, haben’s auch nötig, weil an all dem Geld, das sie zusammengekratzt haben als Großkaufleute, die Schweißtropfen ihres schlechtbezahlten Personals kleben. Na – und unsere Jnädige, die ist doch auch man bloß hier in Berlin so janz peu a peu anders geworden – scheinbar! Überhaupt – wie so’n moderner Mensch wie der Herr Doktor Ullriegi ausgerechnet die aschblonde Tugendfee heiraten konnte – das begreif ’n anderer! Aber, wie jesagt, Kinder: die Geschichte fängt an zu duften, wie mein Vater sich immer ausquetschen tut. Ihr versteht mich …! In Romanen steht immer: „Es begann eine leichte Entfremdung zwischen den Gatten sich bemerkbar zu machen …“ … Det trifft auch hier zu. Ich könnt’ Euch ’ne janze Menge Beweise aufzählen …“ Seine Stimme sank zum Flüstern herab. „Sie spioniert ihm nach – Tatsache! Und sie hat auch recht, die Jnädige. Der Doktor wandelt auf faule Promenaden …!“
„Ach ne?!“ rief Helene gespannt. „Wirklich, Karl? – Was Sie so allens wissen wollen …?!“
Und Heinrich, der Chauffeur, ein harmloser Mensch, für den Karl Mühling geradezu ein kleines Wundertier war, sagte ebenso eifrig: „Nachspionieren? Ja – das kann sind! Sie hat seit zehn Tagen das Auto nicht benutzt – ist immer mit einem Taxameterstänker zurückgekommen …“
Karl grinste überlegen. „Ihr habt nur kein Kombinationstalent, Kinder …! So aus kleine Vorfälle muß man sich ’n Strauß winden und dann reinriechen. Dann kriegt man det Richtige in die Neese.“ Er berlinerte nur, wenn er sich mit Leuten einließ, die er als tief unter sich stehend erachtete. Sonst sprach er ein geschraubtes Hochdeutsch wie aus den rührendsten Romanen einer Volksfrauenzeitschrift. „Heut’ zum Abendbrot hat „sie“ wieder so jut wie nischt gegessen. Vorjestern ebenso. Und „er“ is jetzt immer so viel weg, – zu Sitzungen und so weiter – sagt „er“! Na – diese Sitzungen kennt man … – Die beeden passen eben nich für’nander. Wie sollte det auch wohl sind?! So ne Frau, die immer rumjeht, als wär’ sie in der Kirche, – da muß einem ja janz wehleidig werden, wenn man der zugehörige Gatte is …“
„Na na, Karl, Sie übertreiben …!“ meinte die blasse Zofe. „Sie sagten doch selbst vorhin, die Jnädige is anders geworden. Ich seh’ doch auch manches. Sie küßt ihn oft genug, als wenn … Na, ich versteh’ ja nichts von Liebe. Aber …“
Karl schlug sich auf den Schenkel. „Jut jeunkt, Fräulein! Versteh’ nichts von Liebe …! Da bleibt kein Auge trocken! Und wenn …“
Das Schrillen der Glocke des Haustelephons, das neben der Tür hing, schnitt ihm den Satz entzwei.
Helene sprang auf, nahm den Hörer ab.
„… Jawohl, gnädige Frau, – ich hab’ verstanden – – jawohl … – Karl soll den großen Koffer in den kleinen Salon bringen, Heinrich das Auto sofort bereithalten und ich der gnädigen Frau packen helfen …“
Sie hing den Hörer an, wandte sich dem Küchentische zu, an dem die beiden Männer saßen, und sagte ganz aufgeregt:
„Karl, Sie haben recht gehabt … Da scheint die Bombe schon geplatzt zu sein. „Sie“ verreist noch heute …! Man stell’ sich vor: Noch heute! Und dabei ist’s halb zehn schon …! Und – sie reist allein – ganz allein!“
– – – – – – – –
Der Nachmittagsvortrag im Goethebund hatte bis gegen neun gedauert. Doktor Ullriegi beeilte sich, seine Sachen aus der Garderobe herauszubekommen. Es war ihm unangenehm, Agathe abermals warten zu lassen.
Als er gerade in den kurzen, seidegefütterten Sportpaletot schlüpfte, sprach ihn der Schriftleiter der Monatsschau, sein Schulfreund Lüder, an. Ullriegi mußte notwendig erfreut tun, da Lüder ein lieber, anhänglicher Mensch war und nebenbei in Berliner literarischen Kreisen zu den tonangebenden Persönlichkeiten gehörte.
Gemeinsam verließen die Freunde die Philharmonie und schritten in rascher Gangart, die Ullriegi sofort angeschlagen hatte, durch stille, frühlingswarme Straßen dem Untergrundbahnhof Wittenberg-Platz zu.
„Du hast es eilig, Fred,“ sagte der breitschultrige Lüder jetzt, indem er den Schlapphut abnahm. „Siehst nicht gut aus, mein Alter“, fügte er unvermittelt hinzu. „Etwas abgehetzt und zerstreut. Frau Aga bekommt Dir nicht, scheint’s. Du weißt, ich bin immer ehrlich. Bis zur Grobheit.“
Der Doktor ging langsamer, hielt den Kopf gesenkt, erwiderte dann mit gekünstelter Harmlosigkeit:
„Du hast stets den Frauen die Schuld gegeben, wenn Du Grund hattest, dies oder jenes zu bemängeln, Heinz. Leute wie Dich sollte man der Öffentlichkeit entziehen. Du vergrämst die Freier. Alle Mütter in Berlin hassen Dich.“
„Schon möglich. Dafür lieben mich so und so viele Glückliche, die einer Ehefalle entschlüpft sind. – Aber im Ernst, Fred: Dein Aussehen macht mir Sorge! Und auch sonst …“
Ullriegi blickte auf. „Sprich weiter …“
„… auch sonst geht es mit Dir rückwärts. Dein letzter Roman gehört ins Feuer. Ich werde ihn in der Monatsschau nicht besprechen. Die Arbeit ist nicht mehr wie Deine früheren; zerfahren, ungleichmäßig, zum Teil geradezu unkünstlerisch – Allerweltskitsch.“
„Danke! Die Kritik genügt …“ Es war etwas Müdes, Gleichgültiges in des berühmten Schriftstellers Stimme.
Lüder schob seinen Arm in den des Freundes.
„Sprich Dich mal aus, Fred“, sagte er herzlich. „Zwischen uns hat es noch nie Geheimnisse gegeben, bis – bis Du Dich verlobtest. Fräulein Agathe Rautensen lehrte Dich das Schweigen zur Unzeit.“
„Laß doch meine Frau aus dem Spiel, Heinz. – Ich weiß ja, Du meinst es gut. Aber es gibt Dinge, die selbst Du nicht kennst. Jeder Mensch hat ein Gespenst, das hinter ihm in einer Versenkung lauert und das sich zuweilen hochreckt.“
„Aha – also das ist’s! Und dieses Gespenst kommt Dir gerade jetzt sehr ungelegen, da Frau Aga es sehen könnte, die als Tochter des Hauses Rautensen Gespenster für unmöglich oder doch für verwerflich hält.“
Ullriegi schwieg eine Weile. Dann meinte er dumpf, und tiefer Groll klang durch die Worte hindurch: „Ich fürchte, die Gulbran intrigiert gegen mich. Ihre Vertraulichkeit mit Aga ist verdächtig. Ich hätte meine Frau warnen sollen. Aber – – was versteht sie von Weibern von der Art der Gundra Gulbran …?! Sie zwängt alles in eine Schablone. Alles …!“
Lüder drückte des Freundes Arm. „Fahr’ fort so, mein Alter. Deine Zunge beginnt sich zu lösen. Dein Herz ist übervoll von irgend etwas. Gieße mir ruhig in die Ohren, was zu viel darin ist. Ich möchte Dich wieder mal heiter sehen. Vielleicht scheuche ich das Gespenst in den Abgrund zurück.“
„Das gelingt auch Dir nicht“, sagte der Doktor kurz. Die Andeutung vorhin reute ihn schon.
Lüder schüttelte den Kopf, der zu einem bayrischen Jägerhabit so vorzüglich gepaßt hätte, erwiderte ärgerlich und in steigender Erregung: „Gut denn – bleibe stumm. Vielleicht bereust Du es bald. Ich kenne auch diese Art von Frauen, zu der Agathe gleichfalls gehört, – diese sanft erscheinenden, die doch …“
„Quäle mich nicht!“ rief Ullriegi leise. Ein leeres Auto heranwinkend fügte er hinzu: „Leb wohl. Meine Frau erwartete mich eigentlich um acht zurück. Der Vortrag dauerte länger als vorauszusehen.“
Der Hüne Lüder mit dem wallenden, leicht ergrauten Vollbart und den klaren, hellen Augen unter den dicken, buschigen Brauen schaute dem Kraftwagen ernst nach, dachte: „Armer Kerl! Sie hat Dich schon halb klein gekriegt! Aber – der Gulbran will ich doch das Handwerk legen! Eine Bestie, dieses Weib …!“
2. Kapitel.
Agathe ging im Musikzimmer langsam auf und ab. Der seidenglänzende Perserteppich duldete das ruhelose Hin und Her ihrer Schritte nun bereits eine halbe Stunde.
Agathe trat ans Fenster, schlug den schweren, golddurchwirkten Vorhang zurück und blickte in den Vorgarten hinab. Über den gelben Kiesweg schlich eine Katze; hinterdrein eine zweite. Beide ließen die Schwänze kokett hin und her pendeln, verschwanden im Gebüsch, aus dem gleich darauf ein lautes Jaulen und Fauchen hervordrang.
Agathe murmelte etwas vor sich hin, ließ den Vorhang fallen und setzte sich an den offenen Flügel, die Hände im Schoß, sehr gerade; nur den Kopf hielt sie gesenkt, schaute nachdenklich auf die Tasten. Um ihre schmalen Lippen lag ein harter, feindseliger Zug. Das längliche Gesicht, das in all seiner tadellosen Regelmäßigkeit zumeist reizlos erschien, verriet so wenigstens einige Erregungsfähigkeit.
Ihre rechte Hand glitt jetzt über die Tasten, suchte eine Melodie. Da hörte sie draußen ein Auto vorfahren. Sie stand auf, ging in das Speisezimmer, setzte sich in den Klubsessel vor den breiten, kaminartigen Ofen und legte die Falten ihres langen, seidenen Hauskleides zurecht, das jede Klosteroberin hätte tragen können, so sehr entbehrte es bei aller Kostbarkeit jedes gefälligen Aufputzes.
Manfred Ullriegi trat ein, schaute sich um, sah Agathe und kam zögernd auf sie zu.
„Entschuldige, daß es wieder später geworden …“
Vor ihrer gleichgültigen Handbewegung verstummte er, blieb stehen, sah sie unsicher an und fragte leicht beunruhigt:
„Bist Du verletzt, weil ich Dich heute abermals …“
„Ich habe mit Dir zu sprechen“, unterbrach sie ihn kalt. „Wenn Du Platz nehmen willst …“ Sie deutete auf den zweiten Klubsessel am Kamin.
Ullriegi fühlte die Gewitterschwüle. Ein Würgen stieg ihm in der Kehle hoch. Es war eine blinde Wut, fast Haß, die in ihm hochquoll.
„Danke!“ stieß er hervor. „Ich kann stehen. Im übrigen wieder mal ein reizender Empfang … Seit einer Woche weht hier ein Eiseshauch … Das halte der Teufel aus …!“ Er war hinter den Klubsessel getreten und schlug mit der Faust leicht auf das Leder der hohen Rücklehne, die vor ihm war wie eine Schutzwand.
Ihr mißbilligender, ernster Blick entlockte ihm halb ungewollt ein: „Verzeih! Ich habe noch immer zu viel Temperament.“
Sie ließ den Kopf wieder etwas sinken, schaute auf das schwarze Bärenfell zu ihren Füßen, sagte dann langsam:
„Du warst in der Philharmonie?“
„Ich denke, Du weißt es …“
„Das ist keine Antwort.“
Eine Pause. Seine gespreizten Hände preßten das weiche Leder der Rücklehne zu einer dicken Falte.
„Willst Du mich reizen, Agathe?“ fragte er, sich mühsam beherrschend. „Seit Tagen spielst Du hier nun die … die Sphinx; gibst mir Rätsel auf. Wie lange soll das noch dauern?“
„Vielleicht nur noch kurze Zeit. – Du warst also in der Philharmonie. Hast Du den ganzen Vortrag gehört?“
Er erstarrte förmlich. Sein Gesicht wurde bleich.
„Also nicht“, sagte sie, schneller sprechend. „Wo warst Du vorher?“
Ein häßliches Auflachen fuhr ihm über die Lippen.
„Hast Du spioniert, Agathe? Es scheint so! Nun – dann sind wir ja gerade weit genug!“
Die eisige Ironie beantwortete sie mit einem Achselzucken.
„Ich habe nur das getan, was jeder Frau gutes Recht ist: Mir Aufschluß darüber verschafft, was Dich in den letzten 14 Tagen so oft von Hause fernhielt.“ Sie stand jetzt auf, schaute ihn voller Verachtung an, fuhr fort: „In der Alsenstraße Nummer 16 bist Du jetzt jeden Tag gewesen. Ich hätte Dir mehr Geschmack zugetraut. Eine Tänzerin!“ Ihre Stimme zitterte, wurde heller. „Ja – eine Tänzerin! Und das – das mußte ich, Agathe Rautensen, hinnehmen! Ach – wie schäme ich mich jetzt vor mir selbst, daß Du es fertig brachtest, durch Deine Zärtlichkeiten die strenge Auffassung von Sittsamkeit, die mein Elternhaus mich lehrte, mich vergessen zu lassen! Wie gedemütigt bin ich nun, daß – daß Du Anrechte auf mich geltend machen durftest, die – die mich zuerst abstießen und erst Deine gewissenlosen Künste mir erträglich erscheinen ließen.“
„Aga!“
Jetzt lachte sie auf diesen vorwurfsvollen Zwischenruf hin fast schrill, stieß hervor: „Spare Dir das! Auch dieses Aga war stets wie eine Entweihung. Mama meinte, ich hätte es mir gleich verbeten sollen. Das tut man in guten Kreisen nicht.“
Sein Gesicht hatte das Starre verloren. Etwas wie ein Lächeln umspielte seinen Mund. Er kam um den Klubsessel herum und setzte sich, schlug die Beine übereinander, stützte das Kinn in die Linke und schaute zu ihr empor.
„Ach – die Mama ist also auch wieder dem Wortschatz einverleibt,“ meinte er. „Höchst erfreulich! Dann brauche ich mir weiter keine Mühe zu geben, Dir die Tänzerin auszureden! Wo die Mama erst spukt, ist Polen verloren!“
„Beleidige meine Mutter nicht. Eine Frau wie sie kannst Du Dir nicht einmal mit all Deiner Schriftstellerphantasie vorstellen, wirst Du nie verstehen.“
„Allerdings nicht! Oder ich müßte gerade die Unnatur, die Unduldsamkeit, den Hochmut und die Rechthaberei als etwas Schätzenswertes erkennen lernen. – Doch – wozu eigentlich noch all dies Unerquickliche?! Machen wir Schluß! Du wirfst mir vor, ich betrüge Dich, nicht wahr?“
„Eine Antwort ist überflüssig.“
„Gut. – Deine Beweise?“
„Du gehst in der Wohnung der Frau Schmiedecke ein und aus, bist von der Straße aus am Fenster der dort als Untermieterin polizeilich gemeldeten Tänzerin Gustava Olten gesehen worden, hast dorthin allerlei Einkäufe mitgenommen: Süßigkeiten, teure Konserven und anderes.“
„Vortrefflich spioniert!“
„Also Du gibst alles zu?“
„Nichts gebe ich zu.“
„Das – das ist feige, das –“
Rede und Gegenrede waren wie Schwertstreiche gefallen. Jetzt schnellte Manfred Ullriegi hoch.
„Genug,“ sagte er kalt. „Beenden wir diese Aussprache. – Was gedenkst Du zu tun?“
Sie seufzte. Sie hatte nicht erwartet, daß er ihr das Letzte so leicht machen würde. Ihre Eitelkeit bekam einen harten Stoß. Die Hoffnung, er könnte sich doch vielleicht irgendwie zu entschuldigen wissen oder doch ihre Verzeihung anzuflehen suchen, sah sie schwinden. Wie gleichgültig mußte sie ihm wohl sein, daß er so schnell den Kampf aufgab?! – Ihre Feindseligkeit wuchs, wurde zu Haß, machte sich Luft in den Worten:
„Fort aus diesem Hause der Schmach will ich – nur fort! Oder – glaubtest Du etwa, ich würde auch nur eine Sekunde länger bleiben als nötig?!“
Sie schritt schnell zur Tür, legte die Hand auf den Drücker, öffnete.
Da. – Er hatte leise gerufen:
„Aga!“
Sie zauderte. – Und abermals:
„Aga! Ich könnte Dir mein Ehrenwort –“
Sie drehte sich um, schaute ihn durchdringend an, sagte hastig, ihm ins Wort fallend:
„Ehrenwort?! Auch das noch! Das ist stets die letzte Schanze, hinter die Ihr Euch verkriecht. – Für wen waren denn heute die Blumen, die Du mit in die Wohnung der Schmiedecke nahmst?“
Er wich ihrem Blick aus, schwieg, machte dann ein paar schnelle Schritte vorwärts auf sie zu, blieb stehen, ließ den Kopf sinken und sagte dumpf:
„Es ist ja doch alles zwecklos.“
Die Tür fiel ins Schloß. Und Manfred Ullriegi ließ sich tief aufseufzend in den Klubsessel fallen.
Er saß da und lauschte auf die Geräusche, die aus dem Flur und den anderen Räumen zu ihm drangen; hörte die blasse Helene sprechen, dann Agas tiefes Organ.
Aga verließ ihn. Die Ehe war gebrochen – wie ein Stab, den man in der Mitte zu schwer belastet. Nun würde die Frau Senator Rautensen triumphieren, würde die Hände falten und sagen: „Danke dem Allmächtigen, daß er Dich dieses Kreuz nur ein Jahr tragen ließ! Und nach schicklicher Zeit denke an Robert Johansen, der den Makel dieser ersten Ehe durch seinen ehrlichen Namen gern von Dir nehmen wird.“
Ullriegi hörte unten vor der Freitreppe das Auto vorfahren. Nach einer Weile klappte der Schlag laut zu, der Wagen setzte sich wieder in Bewegung, verließ den Vorgarten.
Aus – aus! Und das war nun das große Glück gewesen, das der Ausklang von zwölf Monaten, in denen er versucht hatte, dieses junge Weib sich ganz zu erringen, in dem verkehrte Erziehung und das träge Blut der Rautensen immer wieder so stark sich bemerkbar gemacht hatten, daß ihm von all diesem Werben um ihre Weiblichkeit selbst die Seele wund geworden war. –
Unten im Erdgeschoß in der Küche sagte die blonde Helene zu dem Diener Karl:
„Sie kommt nicht wieder. Sie hat mir zum Abschied lumpige zehn Mark geschenkt! Der arme Doktor! Aus der war ja nie klug zu werden.“
Karl nickte. „Es war ’ne Heirat zwischen Lamm und Löwe! Oder so ähnlich. Jedenfalls ein Unsinn von vorn herein.“
3. Kapitel.
Heinz Lüder schaute dem Auto nach, seufzte.
„Armer Kerl, diese Frau ist für Dich wie ein schleichendes Gift. – Wer weiß, was er damit meinte, daß die Gulbran ihre schönen Modellhändchen hier irgendwie im Spiel hat? Hm – ob ich nicht mal zu ihr gehe? Freuen wird sie sich ja nicht gerade. Aber – ich muß wissen, was dieses Weib eigentlich wieder hinter den Kulissen zu arbeiten hat.“
Er ging weiter, fand auch für sich ein Auto und befahl dem Chauffeur: „Am Lietzensee Nr. 2.“ –
Frau Gundra Gulbran hauste in einem malerisch dicht am See gelegenen und hinter hohen Baumwuchs völlig versteckten norwegischen Blockhause seit Jahren nur in Gesellschaft zweier Dienstboten, deren Treue und Verschwiegenheit ebenso erprobt waren wie ihre Brauchbarkeit zu gelegentlichen besonderen Diensten.
Als der Witwe des schwedischen Generalkonsuls und Geheimen Kommerzienrates Axel Gulbran standen ihr die Salons nicht nur der Berliner Hof- und Hochfinanzkreise, sondern auch infolge gelegentlicher erfolgreicher schriftstellerischer Versuche die bescheidenen, aber interessanteren Versammlungsstätten des Künstlertums der Reichshauptstadt weit offen, – weit, denn überall hatte diese seltsame Frau es verstanden, ohne sich gewaltsam in Szene zu setzen sehr bald eine erste Rolle zu spielen. Trotzdem waren die Urteile über sie sehr geteilt. Die meisten verstanden sie nicht und fürchteten sie, ein kleiner Teil beneidete sie und nur wenige begriffen so etwas den komplizierten Charakter dieses Weibes, von dem noch heute niemand recht wußte, woher sie stammte und wie alt sie war, denn die polizeilichen und beurkundeten Angaben über ihre Personalien zogen die Eingeweihten stark in Zweifel.
Als Frau Weyl, die bei Gundra Gulbran Haushälterin, Zofe und Köchin in einer Person spielte, Heinz Lüder jetzt in den kleinen Salon führte, den er seit Monaten nicht mehr betreten hatte, war des berühmten Schriftleiters und Kritikers erste Empfindung die uneingeschränkter Anerkennung des bis zum Raffinement verfeinerten Ausstattungsgeschmackes der Besitzerin dieser Räume, in denen schon so manche Fürstlichkeit vor den Nixenaugen der rotblonden Hexe, wie die Schar der Neider die Witwe gern nannte, zum unbedeutendsten der unbedeutenden Sterblichen herabgesunken war.
Die gelbverschleierte Ampel an der Decke übergoß die weiße Marmorfigur der Göttin Astarte in der einen Ecke mit einem geradezu gespenstischen Licht, zauberte in den Tiefen des Steines Farbentöne hervor, als hätte man eine außergewöhnlich guterhaltene Mumie vor sich. Lüder saß in der Ecke gegenüber in einem niedrigen Seidensessel, in dessen weiche Polsterung man sich ganz nach Gefallen einschmiegen konnte. Dann wurde der Vorhang nach dem Musikzimmer von einer weißen Hand, die keinerlei Schmuck trug, zurückgeschlagen, und in der Öffnung erschien das blasse Gesicht Gundra Gulbrans wie ein frei in der Luft schwebendes Haupt, da das dunkle, schleppende Kleid mit dem dunklen Hintergrund in eins verschmolz.
„Ich freue mich, daß Sie auch einmal wieder den Weg zu mir gefunden haben, mein Freund,“ begrüßte die Witwe den Gast, indem sie jetzt vor dem Vorhang stehen blieb und ihm die Hand hinstreckte.
Er erhob sich, ging auf sie zu, drückte diese kühlen Finger leicht und sagte:
„Freuen Sie sich nicht zu früh, Frau Gundra. Ich komme, um den Großinquisitor zu spielen, mich in Dinge einzumengen, die Sie sicherlich ableugnen werden, so weit es sich dabei um ein Eingreifen Ihrerseits handelt.“
„Nehmen Sie Platz, Heinz Lüder.“ Sie deutete auf ein kleines Teetischchen, an dem zwei Klubsessel standen. Auf der Tischplatte, einer altindischen Mosaikarbeit, die die Götzenfigur Brahmas darstellte, war stets der Samowar bereit. Die Stehlampe daneben flammte auf. Sie hatte einen Seidenschirm von besonderem Rot, auf den schwarze Teufelsgestalten, einen Reigen tanzend, aufgenäht waren und der zusammen mit der gelben Ampel den Gesichtern bevorzugter Gäste, – denn nur diese genossen den kleinen Salon, einen warmen Fleischton gab. Auch das Lämpchen des Samowars[1] puffte jetzt auf, und dann nahm Frau Gundra aus der Vitrine daneben zwei hauchdünne japanische Täßchen und eine goldene Schale mit allerlei Süßigkeiten heraus, sagte dabei:
„Wir haben uns seit dem 5. Januar dieses Jahres nicht gesprochen; also vier und ein halb Monate haben Sie mich gemieden. Verletzte Eitelkeit vermag viel. Meine Freundschaft schlugen Sie aus. Liebe konnte ich Ihnen nicht geben. So verlor ich Sie. Und jetzt kommen Sie als Feind, wahrscheinlich Ullriegis wegen. Ich war ebenfalls in der Philharmonie heute, sah, wie Sie Ullriegi begrüßten. Er wird Ihnen sein Leid geklagt haben.“
Sie stellte die Tassen und die Schale auf den Tisch, noch Zigaretten dazu, setzte sich nun langsam. Hastige Bewegungen schienen ihr fremd. Jede Geste war abgerundet, weich und gefällig. Ihre Stimme paßte sich dem völlig an; war kräftig und doch wie das Klingen eines tiefen Geigentons.
Lüder merkte, wie der Zauber des eigenartigen Weibes langsam wiederum von ihm Besitz ergriff. Vergeblich sagte er sich voller Ironie, die doch nicht echt war: „Alles Getue, alles fein ausgeklügelte Berechnung.“ Und dachte weiter: „Selbst wenn dem so ist, so habe ich hier eine gottbegnadete Schauspielerin vor mir, die ständig auf der Bühne des Lebens diese schwere Rolle der geistreichen, originellen Frau spielt.“
„Ich bewundere Ihr Kombinationstalent,“ erwiderte er nun und griff nach einer Zigarette. – Sie reichte ihm einen brennenden Fidibus aus wohlriechendem Papier.
„Die Fackel des beginnenden Krieges,“ scherzte sie mit kaum merklichem Lächeln, bei dem sich ihre vollen Lippen etwas öffneten.
Er beugte sich vor. Mit leisem Knistern fing die Zigarette Feuer. Dann flog das erste Rauchwölkchen hoch.
„Weshalb stören Sie abermals die Kreise Ullriegis?“ fragte er dann und schaute auf ihre großen, mandelförmigen Augen, die hinter den langen, dichten Wimpern stets halb geschlossen wie hinter Schleiern lagen.
Sie antwortete nicht; lehnte sich zurück, ließ den Fidibus dicht vor ihrem Gesicht verbrennen, blies[2] die Flamme aus und sog den wohlriechenden, feinen Qualm mit tiefem Atemzuge ein.
Heinz Lüder kannte ihre Besonderheiten und sprach daher weiter:
„Sie werden jetzt von vielen Ihrer Bekannten „Frau Vorsehung“ genannt, Gundra. Man erzählte nur einige Fälle, in denen Ihr Eingreifen in die Schicksale armer Toren klar zu Tage betreten ist. Dieses Eingreifen war zumeist nicht derart, daß „Frau Vorsehung“ den Namen „gütige Fee“ verdient hätte. Ein lebhaftes Schütteln des Kopfes gab es letztens bei Meinerts, als Alwin ter Neelen erzählte, wie Sie den jungen Olbers behandelt haben.“
Er lehnte sich nun gleichfalls bequem zurück. Zwischen Lampe und Samowar konnte er sie gerade noch sehen, wenn er den Kopf etwas zur Seite bog. Sie schwieg noch immer.
„Ich glaube,“ fuhr er fort, „Frau Vorsehung begann ihr Wirken damals, als sie nach Hamburg fuhr und „zufällig“ die Bekanntschaft der Frau Senator Rautensen machte, eine Begegnung, die zur Folge hatte, daß man Ullriegi als Bewerber um Fräulein Agathe noch kälter aufnahm. – Weshalb eigentlich damals diese Einmischung, Gundra? Ich stehe noch heute in dieser Beziehung vor einem Rätsel. Sie haben aus Ihrer Gleichgültigkeit oder besser geheimen Abneigung gegen meinen Freund nie ein Hehl gemacht. Und trotzdem diese Fahrt nach Hamburg, dieser Besuch des Rennplatzes, dieses beabsichtigte Zusammentreffen mit Rautensens.“
Da endlich kamen über die Lippen der regungslos Dasitzenden Worte einer halben Abwehr.
„Ich war drei Tage mit Rautensens zusammen.“
„Was heißt das?“
„Daß Sie mit dieser Anklage, die ich heute zum zweiten Male höre, vielleicht doch auch Unrecht haben.“
Der Samowar begann zu summen. Man hörte draußen eine Glocke schrillen.
Und Frau Gulbran erklärte: „Prinz Herbert hatte sich für diesen Abend angemeldet. Ich werde ihn fortschicken. Sie sollen nicht sagen, Heinz Lüde, daß ich vor einem Großinquisitor Angst habe.“
Sie stand auf, ging hinaus, kam in kurzem zurück.
Lächelnd nahm sie wieder Platz. „Der Prinz war sehr enttäuscht, sogar etwas ungehalten. Königliche Hoheiten glauben, auch hier gekrümmte Rücken vorzufinden. Er wird sich daran gewöhnen müssen, daß er nur Mensch ist, sobald er meinen Vorgarten betreten hat. – Doch: zurück zu Ullriegi. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Also – welch’ neue Anklage bringt die Gegenwart?“
„Sie haben mit Frau Aga einen Verkehr begonnen, der nach Ansicht Manfreds lediglich den Zweck haben kann, Unfrieden in seine Ehe hineinzutragen.“
„Sie sind deutlich, Heinz Lüder. Und ehrlich wie früher.“
„Mit 45 Jahren verlernt man die Phrasen.“
Sie schenkte die Täßchen voll, zeigte auf die Schale. „Bedienen Sie sich. Oder essen Sie Süßigkeiten nicht mehr so gern wie damals, als Sie so oft hier saßen und mir klar machen wollten, daß wir beide ein vorzügliches Ehepaar abgeben würden?“
„Ich habe mich in diesen Monaten nicht geändert, Gundra. Nur darin, daß ich eingesehen, wie wenig wir für einander paßten.“
„Ein großer Gewinn, diese Erkenntnis. – Ullriegi meint also, ich störe sein Eheglück.“
„Sie färbten eben dieses „Eheglück“ stark ironisch. Sie glauben also an dieses Glück nicht?“
„Nein. Ullriegi hat sich überschätzt und den Einfluß der muffigen Luft eines Hamburger Patrizierhauses zu gering bewertet. Er hoffte Funken aus einem Stein schlagen zu können, der nur gebrannter Ton war, – zu weich für den Stahl infolge seiner künstlichen Herstellungsart. Kunststeine geben selten Funken.“
„Ich verstehe. Er hat Temperament dort zu wecken gehofft, wo keines vorhanden ist.“
„Oh – das ist zu viel gesagt. Vorhanden wohl doch. Nur – er verstand nicht das Mittel zu finden, es herauszuschälen aus der Rinde von Unnatur der Erziehung einer Frau Rautensen, die noch heute errötet, wenn man von Schlafzimmer oder auch nur Betthimmel spricht.“
Lüder lachte zwanglos auf.
„Wir beide taxieren die Frau Senator richtig ein, das merke ich! – Aber, Gundra, – nun mal ehrlich: Weshalb der Verkehr mit Agathe?“
Sie antwortete erst nach einer Weile.
„Hat Ullriegi Ihnen genaueres darüber mitgeteilt, weshalb er mich als Störenfried betrachten zu können glaubt?“
„Nein. Er sprach nur ganz im allgemeinen, war jeder Bitte meinerseits, mir doch sein Herz auszuschütten, unzugänglich.“
Draußen abermals die ferne Glocke. Dann kam Frau Weyl, reichte ihrer Herrin einen Zettel und verschwand wieder.
Gundra las ihn und verbrannte ihn an der Samowarflamme. Ihre Hand zitterte leicht dabei. Lüder sah es, wunderte sich, beobachtete sie schärfer.
Sie stand jetzt hastig auf. „Entschuldigen Sie mich!“
Als die Tür nach dem Flur hinter ihr sich geschlossen hatte, nahm Lüder den Rest des Zettels aus der Aschenschale, strich den schmalen, angekohlten Papierstreifen glatt und konnte darauf noch entziffern:
„– plötzlich abgereist. Erwarte weitere Anweis –“
Die Schrift, klein und unausgeschrieben, kam Lüder begannt vor. – Er drückte den Papierstreifen wieder zusammen und warf ihn in die Aschenschale.
Minuten vergingen. Auf einem Hocker hinter dem Tischchen lag ein Buch. Das Bild des Deckels erregte Lüders Neugier. Es zeigte einen mit Ketten gefesselten Sträfling, der die Arme sehnsüchtig nach einer über einem See scheinenden Sonne ausstreckt. – Er griff nun nach dem Buche: „Das Zuchthaus als Stätte moralischer Einkehr. – Von Staatsanwalt v. Linden“.
„Merkwürdig! Abermals ein Werk über diesen Gegenstand,“ dachte Heinz Lüder. „Gundra hat eine seltsame Vorliebe für alles, was die dunklen Seiten menschlicher Charaktere streift.“
Er schlug das Buch auf. Ein Brief lag darin, darunter ein Zettel. – Er zauderte. Dann las er beide doch. „Ich muß dahinter kommen, wie diese Frau eigentlich in Wahrheit ist,“ murmelte er zu seiner eigenen Entschuldigung. Daß auch etwas wie Eifersucht mitsprach, mochte er sich nicht eingestehen. Der Brief lautete:
Berlin, den 2. April 191…
Werte gnädige Frau!
Sie haben alle Ursache, mich zu empfangen. Ich komme morgen nachmittag 6 Uhr nochmals zu Ihnen. Gemeinsame Erinnerungen an ereignisreiche Tage werden bewirken, daß wir uns schnell wieder nähertreten.
Es grüßt Sie
Ihr ergebener
Baron Benno Löwengaart.
Der Zettel aber, der dieselbe Schrift wie der angekohlte Streifen zeigte:
„Die Frau heißt Karoline Schmiedecke und erfreut sich des besten Rufes. Über Gustava Olten ist nichts Nachteiliges bekannt. Wenigstens habe ich bisher nichts herausgekriegt, was gegen Sie zur Last gelegt werden könnte. Soll ich noch weiter nachforschen?“
Lüder tat das Buch wieder auf den alten Platz zurück. Aus dem Inhalt des Zettels ersah er, daß der, der geschrieben hatte „gegen Sie zur Last gelegt –“ statt „ihr zur Last gelegt –“ ein ziemlich ungebildeter Mensch sein mußte. Die Namen Schmiedecke und Olten merkte er sich genau. Es gab ja ein Adreßbuch. Auf diese Weise konnte man vielleicht feststellen, was Gundra Gulbran für ein Interesse an diesen Personen nahm.
4. Kapitel.
Gleich darauf kam Frau Gundra zurück, setzte sich wortlos, trank ihren Tee aus und nahm eine Zigarette.
Der Fidibus flammte auf, und sie sagte nun, die Zigarette zwischen den roten Lippen:
„Ullriegi verdächtigt mich also wohl hauptsächlich deswegen, weil ich seiner Ansicht nach ihm als Bewerber um Agathe Rautensens Hand geschadet habe. Er tut mir leid.“
„Heißt das, daß Sie ein reines Gewissen haben und Sie ihn nur bedauern können, weil er sich so in eine vorgefaßte Meinung verrannt hat?“
Sie lehnte den Kopf nach hinten, schaute zur Decke empor und schwieg.
„Mit Ihnen verhandeln ist nicht leicht,“ sagt Lüder leicht gereizt. „Sie haben stets die Taktik verfolgt, sich in Schweigen zu hüllen, wenn die Wendung des Gesprächs Ihnen unangenehm wurde.“
„Möglich!“
Heinz Lüder strich sich den langen Künstlerbart in nervöser Hast.
„Bisweilen wünschte ich, ich wäre Lehrer und Sie ein kleiner Bengel,“ meinte er grollend.
„Rohrstock – nicht wahr?!“ Sie hatte sich wieder vorgebeugt. „Sehen Sie mich doch nicht so böse an, mein Freund. Ich –“
Frau Weyl betrat schon wieder den kleinen Salon.
„Herr Baron Löwengaart,“ meldete sie.
„Ich lasse bitten.“ Und zu Lüder gewendet, fügte Gundra Gulbran hinzu: „Die Inquisition ist ja wohl zu Ende. Über haltlose Verdächtigungen spreche ich nicht. – Der Baron ist ein alter Bekannter meines verstorbenen Mannes, ein ganz eigenartiger Mensch.“
Diesem Urteil konnte Lüder nachher nur beipflichten, erweiterte es jedoch insofern noch im stillen, als er schon nach den ersten zehn Minuten einer Unterhaltung zu dreien dachte: „Der Mensch benimmt sich Gundra gegenüber, als hätte er recht große Anrechte an sie. Und Umgangsformen hat er, deren Zwanglosigkeit noch die meinige in den Schatten stellt.“
Baron Benno Löwengaart, ein Schwede, war eine jener Erscheinungen, bei denen man das Alter unmöglich auch nur annähernd erraten kann. Er sah wie ein höherer Diplomat aus, trug Monokel und kurz geschnittenen Schnurrbart, sehr viele Brillantringe, weiße Übergamaschen zu Lackschuhen und sprach das Deutsche leicht gebrochen, machte auch zuweilen kleine Sprachschnitzer. Er war ein recht gewandter Plauderer. Nur zu ironisch, um sympathisch zu wirken.
Gundra Gulbran ihrerseits war ihm gegenüber in ihren Antworten des öfteren fast ungezogen kurz, dann wieder von einer spottgetränkten Liebenswürdigkeit, die er durch plumpe Schmeicheleien belohnte, von denen Lüder nicht recht wußte, ob sie ernst gemeint waren. – Jedenfalls konnte man aus den Beziehungen, die diese beiden Menschen zu teilweise so widerspruchsvollem gegenseitigen Verhalten veranlaßten, nicht recht klug werden.
Der Baron kannte die halbe Welt. In Newyork war er ebensogut zu Hause wie in Kalkutta und Hongkong; von den Philippinen sprach er, als wären es die ostfriesischen Inseln. – Tee verachtete er. Er hatte um Rum gebeten, aus dem er sich eigenhändig unter Zuhilfenahme einer Zitrone, Nelken und heiß gemachtem Moselwein ein Getränk herstellte, das sehr aromatisch duftete.
Die Unterhaltung blieb jedoch völlig oberflächlich. Von Literatur hatte der Baron keine Ahnung, Theater erklärte er für raffinierte Raubstätten an geistig durchaus etwas gelten Wollenden, bildende Künste für zwecklose Handwerke unpraktischer Nichtstuer. Nur Reisen hielt er für anregend und bildend, verteidigte den Satz, daß der Mensch nur im innigsten Verein mit der Natur körperlich und geistig gesund bleibe, mit dem Eifer des fanatischen Naturfreundes und mit wortreicher Geringschätzung jeder verfeinerten Kultur.
So ging wohl eine volle Stunde hin. Dann verabschiedete Gundra ihre Gäste ziemlich unvermittelt.
„Ich fühle mich abgespannt. – Ihre Lobpreisungen des Reisens, Baron, haben im übrigen in mir die Sehnsucht nach Norwegen geweckt. Ich werde übermorgen nicht mehr in Berlin sein!“ Sie sagte das Letzte mit einer etwas stärkeren Betonung.
„Ah – wirklich? Norwegen …! Nehmen Sie mich als Reisemarschall mit, Gnädigste!“ meinte Löwengaart mit einer Verbeugung und einem Lächeln, aus dem Lüder allerlei herauslas. „Jedenfalls werde ich mir erlauben, Ihnen morgen Vorschläge zu machen, welche Route in Norwegen die schönste ist. Ich erwarte, daß Sie mit Dank mein Anerbieten annehmen. Also morgen um elf Uhr vormittags.“
Lüder dachte: „Der Kerl wird zuweilen geradezu unverschämt …“ und war begierig auf Gundras Antwort. Diese lautete – sehr kühl und halb ablehnend:
„Um elf? Nein bitte zwölf, Baron. Ob ich Ihre Vorschläge beherzigen werde, steht freilich noch sehr dahin. – Gute Nacht, meine Herren. Auf Wiedersehen, lieber Lüder …“ – Der Baron erhielt keine besondere Anrede zum Abschied, rief aber noch von der Tür aus:
„Oh – Sie werden sehen, Gnädigste, – meine Reiseroute ist geradezu großartig … Also dann um zwölf …“ –
Die beiden Herren hatten noch ein ganzes Stück bis zur nächsten Straßenbahn. – Der Baron schwärmte in Ausdrücken von Frau Gundra, die Lüder albern und geschmacklos vorkamen. Er begriff das Verhältnis zwischen den beiden immer weniger. Der merkwürdige Brief, den er in dem Buche des bekannten Staatsanwalts von Linden, der als fachwissenschaftliche Größe längst einen Namen hatte, gefunden und auch gelesen, kam ihm nicht aus dem Sinn. Hatte doch der erste Satz geradezu wie eine Drohung und das andere wie eine versteckte Anspielung auf ganz besonders geartete gemeinsame Erinnerungen zwischen Gundra und diesem Schweden geklungen.
„Ich könnte wahrhaftig diese Frau heiraten“, sagte Löwengaart jetzt. „Könnte …! Aber – ich glaube, man wäre bei ihr nicht auf Rosen gebettet …“ Er lachte kichernd. „Sie ist eine Schönheit, aber wohl nichts für einen Fünfzigjährigen wie mich. Wohl kaum … Ach – fünfzehn Jahre jünger – dann – dann …! Schade, daß es keinen Jungbrunnen gibt …“
Lüder waren diese Reden widerwärtig. Als daher ein leerer Taxameter vorüber ratterte, verabschiedete er sich, stieg ein und ließ sich nach Hause fahren.
Nochmals überdachte er nun die letzten Stunden. Deren Endergebnis war doch ohne Frage, daß Gundra Gulbran ihm jetzt noch rätselhafter erschien denn je.
Inzwischen landete Löwengaart in einem Auto vor einem jener Kaffeehäuser des Berliner Nordens, in dem trotz allen äußeren Prunks sich lediglich Laster und Verbrechertum ein Stelldichein geben. Oben in einem der Billardsäle spielte ein älterer, sehr würdiger Herr allein für sich Karambolage. Den Baron begrüßte er sehr unterwürfig. Sie hatten sich hier offenbar verabredet.
Löwengaart fragte dann, indem er sich zum Mitspielen bereit machte:
„Na, Herr Rat, wie steht’s?“
„Hm – die Verhältnisse sind dunkel, schwer zu übersehen. Viel Vermögen dürfte nicht vorhanden sein. Höchstens – höchstens eine halbe Million, die Villa am Lietzensee mit einbegriffen.“
„So – allerdings wenig! – Und die Weyl und der Diener Podgorski?“
„Ja – komische Geschichte das, tatsächlich!“ Der frühere Amtsgerichtsrat, der jetzt in Berlin N. ein sogenanntes Rechtsbureau und eine Auskunftei betrieb, in Wahrheit aber nur der Beschützer aller auf die abschüssige Bahn des Verbrechens Gelangten war und den Behörden mit geradezu gefährlicher Gerissenheit die Gesetzesverächter entzog, begann zu flüstern.
„Donnerwetter!“ rief der Baron dann. „Schau einer an! Das heißt ja das Menschenbeglückertum bis zum Äußersten durchführen!“
Erst gegen Morgen brachen die beiden Billardspieler auf, die inzwischen so viel Alkohol zu sich genommen hatten, daß sie Arm in Arm die Invalidenstraße entlangtorkelten. Der Herr Rat nahm seinen vornehmen Klienten mit heim – nicht sowohl aus edler Menschenfreundlichkeit, als vielmehr seiner besseren Hälfte wegen, vor der er einen Heidenrespekt hatte, denn die frühere Kellnerin, jetzige Frau Rosa Kunkel besaß ein sehr loses Handgelenk und wenig Verständnis für Zechgelage. Heute ließ sie sich schnell milder stimmen, als sie hörte, daß der „andere Saufsack“ der schwedische Baron wäre, der für die Auskunfterteilung gleich dreihundert Mark angezahlt hatte. – –
Heinz Lüder wohnte in Friedenau dicht am Ringbahnhof. Als er seine Wohnung betrat, war es gerade zwölf Uhr. Er wunderte sich daher sehr, im Flur noch einen fremden Hut und Mantel vorzufinden, erkannte dann aber – schon an dem leichten Parfümgeruch – Manfred Ullriegis Sachen und betrat gleich mit einem: „’n Abend, mein Lieber!“ sein Herrenzimmer, in dem der Doktor zusammen mit Lüders Hausdame, der Witwe eines Zahnarztes, am Sofatische saß.
Frau Mieze Worch stand sofort auf und wollte sich zurückziehen … „Der Herr Doktor bat mich, ihm Gesellschaft zu leisten …“, sagte sie entschuldigend. „Gute Nacht … Oder – hätten Sie noch Wünsche, Herr Lüder?“
Ullriegi schüttelte dem Freunde die Hand. „Ich brauchte gerade heute einen verständigen Menschen, der mir die törichten Gedanken verscheuchen half. – Ja – das sind Sie, Frau Mieze: ein lieber, verständnisvoller Mensch! Wenn ich jemandem Gutes wünsche, – Ihnen am allermeisten!“
Lüder reichte der schlanken, üppigen Frau, durch deren Scheitel schon hier und da einige Silberfäden sich hinzogen, gleichfalls die Hand. „Nein – bleiben Sie doch bitte! Dem Fred gönnen Sie Ihre Gegenwart, mir nie! Oder nur als pflichttreues Hausmütterchen, nicht als schätzenswerte Gesellschaft für einsame Stunden. Bitte – also wieder Platz nehmen, Frau Mieze! – Bei Dir daheim ist doch sicher etwas nicht in Ordnung, Fred“, wandte er sich an den Freund. „Sonst hätte ich Dich zu dieser Zeit hier nicht vorgefunden und Du hättest auch nicht von „törichten Gedanken“ und so weiter gesprochen.“
„Stimmt! Nicht in Ordnung! Ich habe Frau Mieze schon mein Leid geklagt. Sie hat ja für alles Verständnis. – Meine Frau hat mich verlassen – das ist’s!“
„Wahrhaftig?!“ Lüder rückte sich einen der schweren Ledersessel neben das Sofa und nahm Platz. „Der Grund?“ fragte er dann.
Ullriegi zögerte mit der Antwort.
„So allerlei Unstimmigkeiten, die allmählich zu einer Entfremdung geführt haben“, erwiderte er nun merklich unsicher.
„Hm – hm!“ Lüder steckte sich eine Zigarre an blies das Streichholz aus und meinte:
„Glaubst Du, daß Deine Frau Ernst macht?“
„Nicht mehr zurückkehren wird? – Sicher nicht!“
„Dann handelt es sich wohl um etwas mehr als nur Unstimmigkeiten“, sagte Lüder, den Freund prüfend anschauend.
Der Schriftsteller, Abgott aller Mädels aus Berlin W, begnügte sich mit einem Achselzucken und einer Handbewegung als Antwort.
Frau Mieze Worch stand nun doch auf und ging. Sie hatte das richtige Gefühl dafür, daß die beiden Herren besser allein wären und sich dann zwangloser aussprechen könnten.
Ullriegi schaute ihr nach. „Ein Prachtweib“, sagte er leise. „Du kannst froh sein, daß Du sie hast. Wo findet man eine so feingebildete taktvolle Hausdame wie sie …!“
Lüder nickte eifrig. „Ganz recht! Ich war auch heilfroh, als sie die Kündigung im Januar zurücknahm. Sie wollte damals um jeden Preis sofort weg von mir. Ich begreife nicht, was damals plötzlich in sie gefahren war.“
Manfred Ullriegi schüttelte den Kopf. „Blind bist Du, Heinz – blind …!“ meinte er ernst. „Ich bin überzeugt: Sie liebt Dich. Im Winter wandeltest Du doch auf Freiersfüßen, mein Lieber! Und da wird …!“
„Hör auf!“ Das klang unverfälscht grob. „Ein Unsinn – lieben! In den drei Jahren, seit sie mich bemuttert, hätte ich doch mal davon was merken müssen!“
Ullriegi zuckte die Achseln. „Eben blind, alter Heinz! Ich würde Dir raten, doch mal an den Vers zu denken: Wozu in die Ferne schweifen – und so weiter!“
„Blech! – Lassen wir das Thema. – Ich komme soeben von Gundra. Ich war halb und halb Deinetwegen dort. Sie markierte aber wieder ganz den weiblichen Moltke – große Schweigerin! – Halt, da fällt mir was ein …“
Er holte das dicke Adreßbuch, blätterte, fand „Schmiedecke“ mit einer ganzen Reihe vertreten und sagte halblaut … „Karoline war der Vorname.“
Dann: „Aha – hier haben wir’s: Karoline Schmiedecke, Witwe, Alsenstraße 16.“
Doktor Ullriegi saß wie erstarrt da. Dann fragte er schnell:
„Wie – wie kommst Du auf diese Frau?“
Lüder blickte auf. „Fred – Du machst ja ein Gesicht, als hättest Du soeben ein Gespenst gesehen … Was hast Du nur?“
„Oh – nichts …“
„Das ist Schwindel! Dieses „nichts“ klang denn doch zu ängstlich.“
„Ängstlich – warum denn wohl?! – Aber – weshalb suchst Du nach der Anschrift der Schmiedecke?“
Lüder berichtete ehrlich von seiner groben Indiskretion, wiederholte auch aus dem Gedächtnis den Inhalt von Zettel und Brief.
Der Schriftsteller spielte den Erstaunten. „Allerdings – recht seltsam! Auch dieser Baron ist eine etwas merkwürdige Erscheinung …! – Wie sieht er denn aus? Was treibt er?“
Lüder fühlte, daß Ullriegi ihn von der Schmiedecke und Alsenstraße 16 ablenken wollte. –
Sie blieben noch bis gegen 2 Uhr zusammen. Der Doktor hatte dem Freunde nun wirklich sein Herz ausgeschüttet. Aber gerade die Hauptsache, der Grund des plötzlichen Zerfalls dieser Ehe, war nicht erwähnt worden.
5. Kapitel.
Frau Agathe hatte sich im Kursbuche versehen. Der Schnellzug nach Hamburg ging erst kurz vor Mitternacht. Nun saß sie im Damenzimmer des Wartesaales auf dem Lehrter Bahnhof und konnte die Zeit nicht besser hinbringen, als daß sie wie in letzter Zeit so oft Rückschau über dieses eine Ehejahr hielt. Wenn sie diese Gedanken wegzuscheuchen suchte – und sie tat’s wiederholt, zunächst aus Widerwillen gegen diese Erinnerungen, dann aus anderem Grunde – wenn sie krampfhaft in dem Roman las, den sie sich hier auf dem Bahnhof gekauft hatte, mußte sie doch sehr bald aufs neue feststellen, daß ihr Denken abermals zu dem einen Punkt zurückgekehrt war, der sie erst leise, dann immer stärker beunruhigte.
Sie hatte sich heute bei dieser letzten Aussprache doch wohl unrichtig benommen, als sie Manfreds Ehrenwort so häßlich in Zweifel zog, denn so weit glaubte sie seinen Charakter doch durchschaut zu haben: Feige war er nicht! Er hatte noch nie gelogen, selbst kaum je etwas zu beschönigen gesucht. Er war fast Wahrheitsfanatiker gleich seinem Freunde, diesem unleidlichen Lüder, der sich als Kritiker wie ein Gott vorkam …
Nein – ein falsches Ehrenwort hätte Manfred nie abgegeben …! Und ihre Schuld war es, daß sie ihn nicht hatte aussprechen lassen, daß sie jetzt nicht wußte, was er mit dieser Beteuerung hatte bekräftigen wollen! Gewiß – aus seinem ganzen Verhalten ging ja hervor, daß er kein reines Gewissen haben konnte. Aber – vielleicht hatte er doch Milderungsgründe für seinen Treubruch bereit gehabt. Er verzichtete nachher wohl nur aus verletztem Stolz, diese Gründe zu nennen, legte ihr nichts mehr in den Weg, als sie in ihrer tiefen Empörung von ihm ging und hinter sich sofort alle Brücken abbrach. Gerade dies reute sie. Immer lebhafter ward ihre seelische Unruhe und immer lauter meldeten sich allerlei Zweifel, ob sie auch richtig gehandelt hätte, ob nicht die Mutter daheim doch die Dinge anders beurteilen würde und nicht vielleicht aus Furcht vor dem unvermeidlichen öffentlichen Skandal, den ihre Rückkehr ins Elternhaus gerade in Hamburg hervorrufen mußte, ihr Benehmen tadeln könnte.
So stiegen allmählich aus diesen Zweifeln neue Empfindungen hervor: Angst vor der herben Kritik der Mutter, vor der Rolle, die sie daheim als Frau, die ihren Gatten verlassen, spielen würde, vor den Fragen der zahllosen Verwandten, deren Anschauungen ja ein derartiger Abschluß einer jungen Ehe stets unbegreiflich bleiben würde und die wahrscheinlich insgeheim auch ihr einen Teil der Schuld an diesem jähen Ende einer vielbesprochenen Liebesheirat beimessen dürften, zumal diese von ihr halb und halb erzwungen worden war, weil Manfred Ullriegi ihr im Vergleich zu ihren nüchternen Hamburger Bewerbern wie ein Wesen aus einer idealeren Welt erschien und seine äußeren und inneren Vorzüge ihr unerfahrenes Mädchenherz völlig in Fesseln geschlagen hatten.
Frau Agathe, die noch so siegessicher in all ihrer Eifersucht den Bahnhof betreten hatte, duckte sich jetzt scheu in ihrer Sofaecke zusammen, fühlte jetzt auf ihrer Seele eine schwere Last, die nichts mehr abwälzen konnte, die blieb und schwerer wurde, je länger diese Kritik am eigenen Verhalten und die Gedanken an daheim währten.
Gerade weil sie so streng erzogen war, weil man ihr eine besondere Art von Gerechtigkeitsgefühl beigebracht hatte, mehr Dressur als echte Urteilsfähigkeit, sah sie ihre Schuld plötzlich in grellstem Licht, dachte sie nur immer an die eine Tatsache, daß sie Manfreds Ehrlichkeit angezweifelt und ihn nicht hatte ausreden lassen.
Plötzlich dann ein Entschluß – und hierin war sie wieder ganz die Tochter Thomas Rautensens, der in Minuten oft Entscheidungen von höchster Wichtigkeit als Großkaufmann treffen mußte …
Eine Stunde darauf war sie unterwegs nach Rostock – nicht nach Hamburg, stieg dann in der mecklenburgischen kleinen Universitätsstadt in einem Fremdenheim ab, blieb dort bis zu einem passenden Zuge, der sie nach dem Seebade Müritz brachte, das die Pensionsinhaberin ihr als still und schön gelegen empfohlen hatte.
Freilich – so bescheiden hatte sie sich Müritz doch nicht vorgestellt, als sie es vorfand. Aber die dicht am Wald und Meer gelegene Pension Parkschloß und besonders die See selbst, die sie als Hamburgerin mehr liebte als Gebirge oder die abwechselungsreichste Binnenlandschaft, söhnten sie schnell wieder mit der einzigen, staubigen Straße aus, an der die Häuschen des Dorfes und die größeren Neubauten wie unregelmäßige Perlen an einer Schnur sich anreihten.
Um sechs Uhr nachmittags war sie eingetroffen. Und schon um halb acht lernte sie an der gemeinsamen Abendtafel Menschen kennen, auf die der berühmte Name ihres Mannes mehr wirkte als ihre kühlvornehme Erscheinung.
Da war besonders ein Rittmeister von den Pasewalker Kürassieren nebst Gattin, Graf von Bergau, und ein Ministerialrat aus Berlin, die sie sofort mit Beschlag belegten.
Der Graf, ein endlos langer Herr mit geradezu typischem Offiziersgesicht, gestand ihr sehr bald ein, daß er selbst ein wenig schriftstellere. Die Gräfin wieder, eine Bürgerliche aus Chemnitz, deren Millionenmitgift die Herkunft der Familie Klose, Firma Klose u. Ko., Spinnereien, mit dem Mantel vergoldeter Liebe zudeckte, machte gar kein Hehl daraus, wie sehr sie Agathe um ihr Äußeres beneidete, da sie selbst von der Natur bei der Verteilung natürlichen Schicks und angeborener Grazie recht stiefmütterlich versorgt worden war; der Geheimrat als Junggeselle aber hielt sich für verpflichtet, der schönen Frau des berühmten Ullriegi kräftig den Hof zu machen, hoffte durch diese Bekanntschaft auch in ersten Berliner Künstlerkreisen festen Fuß zu fassen.
Kurz, Agathe war gleich an diesem Abend nicht eher allein, als sie gegen elf Uhr ihre beiden Zimmer betrat und sich auf den dazu gehörigen Balkon setzte, um zunächst sich einmal etwas zu erholen, denn sie fühlte sich plötzlich seelisch und körperlich so zerschlagen, daß sie nicht sofort zu Bett gehen konnte.
Auf dem Balkon bequem in einem Strandstuhl liegend, ließ sie das Rauschen der Tannen dicht vor dem Hause und das gleichmäßige Brandungsgeräusch des Meeres still auf sich wirken, geriet so bald in eine träumerische Stimmung, in der selbst in ihrem Herzen ein wehes Sehnen aufstieg und wuchs und wuchs …
Dann rollten plötzlich die ersten Tränen über ihre Wangen … Weshalb sie weinte – sie wußte es nicht. Es war nicht allein das Gefühl der Einsamkeit, des Verlassenseins, nein, – es war wie ein jähes Aufzucken von Blitzen, die eine dunkle, graue Wolkenbank mit einem Schlage erleuchten, wieder erlöschen, abermals aufflammen und ringsum alles erkennen lassen.
Die Blitze waren einzelne Erinnerungen an ihre Ehe, an Manfred, – auch an seine Zärtlichkeiten, sein frohes Lachen, das leider immer seltener wurde, je länger sie neben ihm dahingegangen war nicht als eine freiwillig Spendende, sondern als eine, der er jede heiße Stunde förmlich abringen oder abschmeicheln mußte und die kaum je ihm die Arme von selbst um den Hals legte, sich an ihn schmiegte und mit gierigen Lippen küßte … – –
Stunden der Einkehr kommen für jeden Menschen. Selbst der verrohteste Verbrecher und der, bei dem die Selbstgerechtigkeit alles andere überwuchert, entgeht ihnen nicht. Nicht immer lösen sie ein Gefühl der Reue aus. Oft nur eine dumpfe Wut gegen die Schicksalsmächte, denen schwache Naturen alle Schuld an dem eigenen Seelenzerfall zuzuschieben suchen. – Agathe Ullriegi litt unter dieser ihrer Stunde der Einkehr unsäglich. Ihre arme Seele, von Jugend an durch die Umwelt, die ihre Anschauungen beeinflußte, in eine falsche Entwicklungsrichtung gedrängt und geknebelt in allen natürlichen Empfindungen, wand sich wie in schmerzhaften Zuckungen. Die Erkenntnis, daß sie sich jetzt bereits nach dem Manne sehnte, der sie in diesem einen Jahre hatte zum Weibe erziehen wollen, suchte sie zunächst mit allen möglichen Mitteln von sich zu weisen als etwas Häßliches, Unreines. Es war wie ein Kampf zwischen der früheren Agatha Rautensen und der neuen Agathe Ullriegi. Diese siegte doch schließlich, gestand sich ein, daß sie eigentlich Manfred gegenüber stets eine Gefühlskälte geheuchelt hatte, die gar nicht mehr vorhanden war, und daß sie so und so oft ihrem ungestümen Verlangen nach seinen Zärtlichkeiten gleichsam Gewalt angetan hatte, und all das nur, weil im Hause ihrer Eltern und im Kreise der Verwandten die eheliche Liebe stets wie etwas behandelt worden war, das man mit dicken Vorhängen verhüllt, deren Vorderseite mit heuchlerisch-harmlosen Bildern bemalt ist. –
So geschah in dieser einen Stunde das, was Manfred Ullriegi in unzähligen umsonst versucht hatte: Frau Aga wurde Weib, sträubte sich nicht mehr gegen die Erkenntnis, daß die Macht der Sinne auch bei ihr größer geworden als der Ballast anerzogener Zurückhaltung …
Die Tränen waren jetzt versiegt. Mit weiten Augen starrte sie geradeaus in das Dunkel des Waldes, hinter dessen Wipfeln nun der Mond langsam hochstieg. Hätte sie jetzt Manfred vor sich gehabt, wäre die entscheidende Aussprache ganz anders verlaufen … Doch: nun war es zu spät. Sie hatte ihn nicht zu Worte kommen lassen, hatte ihn beleidigt, als sie höhnend sein Ehrenwort anzweifelte. Das würde er nie vergessen, nie verzeihen …! Sie kannte ihn in dieser Hinsicht nur zu gut …
Zu spät?! … – Aus ihrer inneren Zerrissenheit und Verzweiflung tauchte doch eine leise Hoffnung auf, wie ein winziges Flämmchen erst, bald aber höher und höher flackernd … Wenn sie an ihn schrieb, – sofort, – wenn sie ihn bat, ihr zu erklären, ob er sich wirklich schuldig gemacht hätte oder ob nur der Schein gegen ihn spräche, – vielleicht ersah er dann aus diesem Briefe, daß sie unter der Trennung von ihm schwerer litt, als er je annehmen konnte, daß sie es war, die eine Brücke zurück zu ihm bauen wollte – sie, die kühle, stolze Agathe Rautensen …
Sie stand schnell auf. Und dann saß sie an dem altertümlichen Damenschreibtisch in ihrem Wohnzimmer und ließ die Feder über das Papier gleiten. Es war ein Briefbogen mit dem Stempel des Pensionats. Einen anderen hatte sie nicht zur Hand. Sie schrieb eng, schrieb von Rand zu Rand, um ja jede Stelle auszunutzen, suchte nicht lange nach Worten, sondern vertraute dem Blatt an, was ihr in die Feder floß.
Gegen drei Uhr morgens erst war der Brief beendet. Sie überlas ihn; änderte nichts; unterstrich nur von den letzten Worten ein paar. Und diese Worte hatte Frau Aga bisher nie ausgesprochen, geschweige denn dem Papier anvertraut …
„Wenn ich Dir unrecht getan habe, verzeih’ mir! Sollte nur der Schein gegen Dich gewesen sein, so schließe jetzt die Augen und denke an mich, die Dich in Gedanken küßt, sich an Dich schmiegt – ganz, ganz eng, und deren Lippen sich nach den Deinen sehnen … – Deine Aga.“
So lautete das, was die Frau Senator Rautensen ohne Zweifel als eine schwere Gedankensünde und als einen groben Verstoß gegen die gute Erziehung aufgefaßt haben würde. –
Frau Agathe lag noch lange wach; sah den neuen Tag mit fahlem Licht das einsame Zimmer füllen, hörte die gefiederten Bewohner des Waldes ihre Morgenlieder anstimmen, sah die ersten Sonnenstrahlen noch durch die Vorhänge lugen.
Dann schlief sie endlich ein. Aber ihre Träume machten den Schlaf unruhig und wenig erfrischend …
6. Kapitel.
„Frau Weyl, ich verreise morgen früh – nach Norwegen. Packen Sie mir den Kabinenkoffer, nur das Nötigste.“
Frau Gundra ging im kleinen Salon hastig auf und ab, blieb dann vor ihrer Haushälterin stehen, legte ihr die Hand leicht auf die Schulter und fuhr fort:
„Ich fliehe, Frau Weyl, – damit Sie Bescheid wissen, Sie treue Seele! Ich fliehe vor der Vergangenheit, von der Sie vielleicht ahnen, daß sie Gespenster in sich einschließt, Flecken hat …“
„Aber liebe gnädige Frau …! Nichts ahne ich, nichts – nun gar so etwas! Flecken …?! Ja, wenn unsereiner noch so reden wollte …“
Gundra Gulbran lachte leise auf. „Meinen Sie, Frau Weyl, ich will etwa mit diesen Flecken mich interessant machen?! Vor Ihnen …?! Nein, gute Seele, vor Ihnen gebe ich mich stets so wie ich bin. – Ich muß flüchten … Und wer weiß, ob …“
Sie schwieg plötzlich, senkte den Kopf, wandte sich ab und begann abermals das eilige Hin und Her.
Das alte Frauchen mit dem glatten, längst weiß gebleichten Scheitel schüttelte nachdenklich und sorgenvoll den Kopf.
„Fliehen …?! – Ja, wenn’s damit seine Richtigkeit hat, dann steckt dieser Baron dahinter, ganz sicher! Der Herr gehört nicht in dieses Haus, niemals! Meine Menschenkenntnis müßte mich doch arg im Stiche lassen in dieser Beziehung.“
Frau Gundra zündete sich am Teetisch eine Zigarette an, sagte nichts zu diesen Auslassungen ihrer Vertrauten.
„Also den Kabinenkoffer, gnädige Frau. Gut, wird besorgt“, meinte die Weyl dann langsam. „Sonst noch Wünsche, gnädige Frau? – Nein? – nun, dann gute Nacht.“
Gundra Gulbran war allein. Sie setzte sich wieder an den Teetisch, schenkte ihre Tasse voll, trank schluckweise und überdachte den heutigen Abend … – Heinz Lüder traute ihr das Schlechteste zu … Und Manfred ebenfalls … „Alle Menschen, die ich gern zu Freunden haben möchte“, spann sie ihre Gedanken weiter aus, „halten mich für ein zu jeder, selbst einer gemeinen Intrige fähiges Weib, das lediglich aus Lust, ihre Mitmenschen so etwas zu beherrschen und in ihre Lebensschicksale einzugreifen, für diesen oder jenen ein stärkeres Interesse zeigt. So schätzen sie mich ein, so …! Und ahnen nicht, wie weit sie von der Wahrheit entfernt sind …! Wenn nun dieser Elende wirklich seine versteckten Drohungen in die Tat umsetzen sollte, wird mir nirgends ein Verteidiger erstehen, wird man mich fallen lassen, und über die gestürzte Größe, über die vielbeneidete, vielgehaßte Gundra Gulbran wird sich eine Flut von Gehässigkeit ergießen, die alles fortspült, was vielleicht noch für mich spricht. – Das ist der Enderfolg meinem Daseins …!“
Wieder lachte sie bitter auf. Und ihre Gedanken glitten zu Agathe Ullriegi hin, ihrem letzten … Opfer …! – Abgereist – offenbar nach Hamburg zu ihrer Familie …! Nun mußte sich ja bald herausstellen, ob eine Gundra Gulbran in diesem Falle die weitere Entwicklung falsch vorausberechnet hatte …
Am folgenden Tage saß sie im D-Zuge nach Warnemünde. In Rostock hatte der Zug nachmittags einen ungewöhnlich langen Aufenthalt. Da sah sie Agathe Ullriegi auf dem Bahnhof, stutzte, begriff nicht sofort, was Manfreds Frau hier zu tun hätte, beobachtete sie heimlich weiter, änderte danach ihre eigenen Pläne und wählte gleichfalls das kleine Seebad Müritz zum vorläufigen Aufenthalt. – –
Als der Baron Löwengaart bei Amtsgerichtsrat a. D. Kunkel seinen Rausch auf dem Diwan in dem sogenannten Salon ausgeschlafen und mit seinen liebenswürdigen Logiswirten ein reichliches Katerfrühstück, für dessen Besorgung er Frau Rosa einen 20 Mark-Schein in die Hand drückte, verzehrt hatte, war es höchste Zeit geworden, zu Gundra Gulbran hinauszufahren an den stillen Lietzensee. Er hatte sich ja bei ihr angesagt und durfte diese Verabredung auf keinen Fall versäumen.
Er läutete an der Vorgartenpforte. Erst nach einer ganzen Weile kam der Diener und Gärtner Podgorski, ein hagerer, älterer Mann mit einem seltsam verschlossenen Gesicht, langsam herbeigeschlurft, zog die Schirmmütze nicht eben überhöflich und fragte nach den Wünschen des Herrn Barons, den er bereits als gelegentlichen Gast seiner Herrin kannte.
„Hm – die gnädige Frau sprechen?! – Wird schwer halten! Nämlich – sie ist heute früh verreist – nach Norwegen, Herr Baron. Ich glaube aber, sie hat für den Herrn Baron einen Brief dagelassen. Wenn der Herr Baron inzwischen dort auf der Bank Platz nehmen wollen.“
Er öffnete die Pforte und ließ Löwengaart eintreten, verschwand dann nach dem Hause zu.
Der Baron wartete, bis er sich entfernt hatte, folgte ihm nachdenklich, während um seinen Mund ein besonderes Lächeln lag.
So traf er gerade vor der Eingangstür der Blockhausvilla wieder mit Franz Podgorski zusammen, der in der Hand einen Brief trug.
Er riß ihn dem Diener aus den Fingern, öffnete ihn, las und stieß eine halblaute Verwünschung aus. Dann schob er ihn in die Tasche, schaute Podgorski lauernd an und sagte mit herablassender Freundlichkeit:
„Sie heißen Franz Karl August Podgorski. – Stimmt, nicht wahr? – Sie stammen aus Oppeln. Ihr Vater war Gerbermeister. Ihre drei Brüder und zwei Schwestern haben es im Leben weiter gebracht als Sie, der Sie über eine – unrichtig gewählte Farbe und verwischten Druck gestolpert sind.“
Podgorskis gebeugter Rücken krümmte sich noch mehr, als ob man ihm eine unsichtbare Traglast aufgebürdet hätte. In gleichem Maße sank sein Kopf tiefer auf die eingefallene Brust.
Löwengaart kicherte in sich hinein. „Fein ausgedrückt, nicht wahr? Farbe und Druck! Na – es war eben ein Versuch, bequem reich zu werden. Ein gelernter Buchdrucker kommt leicht auf solche kleinen Experimente. Nur – man muß dabei dann höllisch sorgfältig vorgehen. Ihre Hundertmarkscheine hatten nicht das Blau der echten und auch der Druck war mangelhaft, was leider zur Folge hatte, daß Sie für ein paar Jahre Staatspensionär wurden – – im Zuchthaus Mewe, – hm ja! – Das hat doch alles seine Richtigkeit, Podgorski, nicht wahr?“
Der hagere Mensch schielte ihn von unten auf mit einem halb scheuen, halb feindseligen Blick an, nickte widerstrebend und hielt den Kopf schuldbewußt gesenkt.
„Ja – wenn man Pech hat,“ höhnte der Baron weiter. „Auch die Frau Weyl fand auf ihrem Lebenspfade ein kleines Hindernis, – einen Koffer, der ihr nicht gehörte. Und als sie dann die Erinnerung an das Freiquartier im Stettiner Gefängnis durch alkoholische Getränke zu töten suchte, passierte ihr im halben Rausch nieder was Ähnliches. Diesmal war’s eine Geldbörse, die in einer Manteltasche steckte. Den Mantel hatte ein feiner Herr an, der den Eigentumswechsel seiner Börse noch eben rechtzeitig bemerkte. – Auch Pech! – So – und nun will ich Ihnen drinnen im Hause, der Weyl und Ihnen, mal so eine kleine andere Geschichte erzählen. Kommen Sie, Podgorski. Es wird Sie interessieren. – Tatsache! Ja – ja, man soll lieber nicht zu früh nach[3] Norwegen fahren, – nein, – das soll man bleiben lassen, wenn man den Baron Löwengaart zum Freunde und Berater hat.“ –
Als Frau Agathe gegen elf Uhr vormittags den Brief an Manfred nach der Post trug, um ihn als durch Eilboten zu bestellen aufzugeben, begegnete sie kurz vor dem Postamte Gundra Gulbran.
Aga Ullriegi glaubte ihren Augen nicht trauen zu dürfen, schaute nochmals hin, beschleunigte dann ihre Schritte und rief der bei aller Einfachheit der Kleidung so vornehm aussehenden Gundra aufrichtig erfreut zu:
„Liebe Frau Geheimrat – Sie hier in Müritz? – Nein, das nenne ich wirklich eine Überraschung!“
Die beiden Damen schüttelten sich lachend die Hand. Agathe war wirklich froh, daß Frau Gulbran, die sie aus dem Berliner Bekanntenkreise mit am meisten schätzte, ebenfalls gerade dieses kleine mecklenburgische Bad für den Sommeraufenthalt ausgewählt hatte, fragte auch gleich in einem Atem: „Sind Sie schon lange hier? Und wie lange gedenken Sie zu bleiben?“
„Die „Frau Geheimrat“ können Sie doch immer noch nicht lassen, beste Frau Doktor,“ meinte Gundra, ein wehleidiges Gesicht schneidend. „Wenn Sie wüßten, wie schrecklich mir dieser Titel ist, würden Sie mich sicher damit verschonen. Im übrigen bin ich gestern eingetroffen. Dauer des Aufenthaltes unbestimmt, abgestiegen im Pensionat Strandblick. – So, nun wissen Sie alles. Und nun zu Ihnen. Sind Sie allein hier?“
Nachdem man so das Wichtigste sich gegenseitig abgefragt hatte, besorgte Agathe den Brief und wanderte dann zusammen mit Frau Gulbran zum Strande, wo man zwei Strandkörbe mietete und auch gleich in der Nähe des[4] Seesteges aufstellen ließ.
Agathe hatte bisher über die Trennung von ihrem Gatten nichts verlauten lassen. Jetzt, als man in den Strandkörben dicht beieinander saß und Gundra die Bemerkung machte, der Eilbrief deute doch auf große Sehnsucht hin, traten Aga plötzlich Tränen in die Augen, und mit einer Heftigkeit, die ihr sonst ganz fremd war, stieß sie hervor:
„Ich will Sie nicht belügen, liebe Frau Gulbran – zwischen Manfred und mir hat es ein ernstes Zerwürfnis gegeben. Bei einer Aussprache habe ich mich leider nicht beherrschen können. Ob mein Mann mir das, was ich ihm zum Vorwurf machte, nämlich daß er sich wie alle Männer in der Not hinter seinem Ehrenwort zu verkriechen suche[5], je verzeihen wird, wage ich kaum zu hoffen.“
Frau Gundra lehnte sich tief in den Strandkorb zurück und betrachtete Agathe, die jetzt verstohlen zwei Tränen wegtupfte, mit einem seltsamen Ausdruck von ernstem Sinnen und geheimer Abneigung in den halb geschlossenen Augen.
„Der Eilbrief war – die Einsicht, – habe ich recht?“ fragte sie leise.
Aga Ullriegi nickte. „Ich bin gestern spät abends auf meinem Balkon sehr streng mit mir ins Gericht gegangen – sehr streng,“ erwiderte sie. „Dann – schrieb ich den Brief. – Manfred wähnt mich sonst ja auch bei meinen Eltern in Hamburg. – Oh – ich bin so furchtbar unglücklich, liebe Frau Gulbran.“
„Alles kann ja noch gut werden,“ tröstete Gundra, nicht gerade übermäßig mitfühlend dem Tonfall nach. Aber das lag wohl nur daran, weil ihre Gedanken andere Wege gingen, die freilich auch zum selben Ziele führten. „Und es wird auch gut werden, Frau Agathe,“ fügte sie hinzu, „wenn Sie sich endlich ganz freimachen von den Nachwirkungen einer Umwelt, die dem Fräulein Agathe Rautensen nicht schaden konnten, die aber der Gattin des Schriftstellers Manfred Ullriegi verderblich werden mußten. Freilich, den Eilbrief – den hätten Sie doch besser erst ein wenig später absenden sollen.“
„So? – Ich dachte gerade, daß Manfred durch eine sofortige Bitte um Nachsicht –“
„Gewiß, gewiß,“ unterbrach die rotblonde, rätselvolle Frau sie lebhafteren Tones als bisher. „Nur – Sie werden doch wohl Veranlassung haben, auch seinerseits Einsicht verlangen zu können. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist.“ Sie dehnte den Satz absichtlich. Und Agathe warf dann auch schnell ein:
„Doch – Sie kennen den Grund des Zwistes, Frau Gulbran. Sie waren es ja selbst, die einmal halb im Scherz mich fragten, ob Manfred mir auch bereits seine frühere Wirtin, bei der er jahrelang als Junggeselle wohnte, vorgestellt hätte; diese Frau Schmiedecke wäre ein so köstliches Original, und Sie hätten Manfred noch letztens aus dem Hause herauskommen sehen, wo die Schmiedecke jetzt wohnte. – Besinnen Sie sich, Frau Gulbran?“
„Ja.“ Es klang seltsam hart, dieses Ja, – so, als ob die Sprecherin betonen wollte, daß diese damalige Bemerkung sie keineswegs gereue.
„Eigentlich kam so durch Sie, liebe Frau Gulbran, der Stein ins Rollen,“ fuhr Agathe fort, indem sie sich vorbeugte und ihre Hand auf die im Schoße verschlungenen, klassisch schön geformten Hände Gundras legte. „Durch Sie. Aber doch ohne Ihre Schuld, denn ich war ja in letzter Zeit schon etwas mißtrauisch geworden, weil Manfred stets so sehr zerstreut und auch so oft von Hause abwesend war. Als ich ihn dann fragte, ob er eigentlich noch zu seiner früheren Vermieterin Beziehungen unterhalte, die doch nach dem, was ich gehört hätte, ein wahres Original sein müßte, da – ja, da verfärbte er sich so auffällig, daß ich stutzig wurde, und leugnete nachher rundweg ab, die Schmiedecke seit unserer Hochzeit wiedergesehen zu haben, meinte achselzuckend: „Wie kommst Du nur auf den Gedanken, ich könnte mich um die Frau noch irgendwie kümmern? Hat etwa Frau Gulbran Dir von der Schmiedecke erzählt?“ – Worauf ich bejahend antwortete und erklärte, Sie wären es allerdings gewesen, die seine ehemalige Wirtin als ein Original hingestellt hätten.“
„Ach – und was sagte Ihr Mann da?“
„Er ging ans Fenster, trommelte gegen die Scheiben und murmelte etwas, das wie „Natürlich“! klang.“
Gundra Gulbran preßte die vollen, leuchtend roten Lippen, die bei Tage fast nachgetuscht wirkten, einen Moment zusammen, daß ihr Mund nur noch wie ein Strich erschien, von dem zwei tiefe Falten zum Kinn herabliefen.
Und Agathe fuhr hastig und in unsicherem, entschuldigendem Tone fort: „Ich habe mir ja nichts dabei gedacht, als ich Ihren Namen in dieser Verbindung nannte – wirklich nicht. – Leider, leider war nun aber mein Mißtrauen so stark geworden, daß ich – daß ich mich herbeiließ, sowohl selbst Manfred ein wenig nachzuspionieren, als auch den Diener Karl unter dem Vorwand, mein Mann wäre auf der Straße jetzt einige Male von einem fragwürdigen Menschen arg belästigt worden, damit beauftragte, ihm heimlich bei seinen Ausgängen zu folgen und ihn nötigenfalls zu schützen. Ich fürchte, der Diener wird dann aber wohl an meinen Fragen gemerkt haben, daß es mir in Wahrheit auf etwas ganz anderes ankam als auf Manfreds Sicherheit. Ich schäme mich ja so sehr, daß ich dies alles getan habe, daß meine Eifersucht kein Mittel verschmähte, mir Gewißheit über die Ursache der seltsamen Unrast und Zerfahrenheit Manfreds zu verschaffen. Der Diener war es dann, der mir vor einer Woche mit jener plumpen Vertraulichkeit, die er sich jetzt herausnehmen zu dürfen glaubte[6], mitteilte, daß mein Mann täglich, oft vor- und nachmittags, die Schmiedecke in der Alsenstraße 16 besuchte. Grinsend fügte er hinzu, daß dort jetzt eine Tänzerin namens Gustava Olten das eine Vorderzimmer bewohne und daß er Manfred gerade am Fenster der Olten habe stehen sehen.“
„Schuft!“ sagte Frau Gundra laut.
Agathe fuhr mit dem Taschentuch über die Augen. „Oh – leider hatte Karl nicht gelogen, wie ich mich dann selbst überzeugte. Manfred ging in der Wohnung der Schmiedecke aus[7] und ein, – an einem Tage war er sogar vier Mal dort, als ob ihn etwas Besonderes dorthin zöge. Und dies – dies kann doch nur die Tänzerin gewesen sein. – Ich sah ihn oben an ihrem Fenster; es stand offen; er war erregt, sprach mit jemand, der sich hinter ihm im Zimmer befand. Und – und er hat ja auch allerlei Sachen zur Schmiedecke mitgenommen, – Geschenke: Blumen, Konfekt, Obst, teure Konserven –“
Frau Aga schluchzte leise auf. „Wie unglücklich bin ich nur! Ach, wenn man all diese Tatsachen sich vorhält, dann – dann kann man nur zu dem Schluß kommen, daß – daß er mich hintergangen hat. Und jetzt, wo diese häßlichen Dinge wieder so lebhaft vor meinem Geiste stehen, bereue ich es fast, den Eilbrief abgeschickt zu haben, der doch in einer Stimmung entstanden ist, in der ich nicht imstande war, seine und meine Schuld genau gegeneinander abzuwägen. Ich – ich habe ja nur aus Eifersucht ihn beobachtet und bin dann verletzend schroff bei der Aussprache geworden, er aber hat vielleicht mir die Treue gebrochen, das Heiligste verletzt, was es zwischen Weib und Mann gibt: die Ehe und die Pflichten, die man mit dem Jawort vor dem Altar auf sich nimmt.“
„Bereuen Sie nichts,“ sagte da Gundra Gulbran leise. „Weder den Brief noch das, was vorherging. – Ich hätte Ihnen nie eine so lebendige Eifersucht zugetraut, liebe Frau Doktor. Wenn ich das vorher gewußt hätte –“ Sie schwieg, führte den Satz nicht zu Ende, den sie gegen ihren Willen begonnen hatte und der nur für ihr Inneres bestimmt gewesen war.
Agathe schaute sie fragend an. „Was wollen Sie damit sagen? – Vorhergewußt? Was denn? Daß ich Manfred liebe und daß ich eifersüchtig sein kann bis – bis zur Unvernunft?“
Gundra lächelte ein wenig. „Ich weiß nicht mehr, was ich mir bei den Worten gedacht habe. Vergessen Sie sie! – Und nun mag dieser traurige Gegenstand heute nicht weiter erörtert werden. Freuen wir uns der köstlich erfrischenden Luft, des Wellenrauschens, des heiteren Himmels.“
7. Kapitel.
Am Abend desselben Tages war Agathes Brief bei Doktor Ullriegi in dessen Abwesenheit dem Diener Karl ausgehändigt worden.
Dieser erkannte sofort die Handschrift der gnädigen Frau, sah den Poststempel Müritz und schüttelte verwundert den Kopf. – In Müritz?! Nicht in Hamburg?! – Das hatte doch etwas Besonderes zu bedeuten! Jedenfalls war es ratsam, sich darüber zu unterrichten, weshalb die Gnädige ihr Reiseziel so plötzlich geändert hatte.
Die Briefklappe zu lösen war für einen so vielseitigen Menschen wie Karl Mühling ein leichtes. Als er den Brief dann las, murmelte er vor sich hin: „Ein Glück, daß der Brief gerade mir in die Finger geraten ist! Das hätte ja einen netten Tanz gegeben, wenn der Doktor dieses mich so arg bloßstellende[8] Geständnis zu sehen bekommen hätte! Na – ich will ihn damit nicht langweilen!“ Er steckte den Brief zu sich und dachte dabei wütend: „Auf Weiber ist wirklich kein Verlaß! Was brauchte sie ihm gleich beichten, daß sie mich ebenfalls als Spion benutzt hat! Das ist nun der Dank für meinen Eifer, den ich entwickelt habe, als ob es sich um meine eigene Angelegenheit gehandelt hätte!“
Dann ging er wieder in die Küche hinunter, wo nur die Köchin Marie anwesend war und in ihrem Erbauungsbuche las.
„Wer war denn da, Karl?“ fragte sie, ihn über den Brillenrand hinweg anblickend.
„Ach, bloß ein Mann mit so ’ner Sammelliste für den Missionsverein.“
„Was – jetzt abends nach achte! Nein – sind diese Kollekteure aber auch eifrig.“
„Und ob!! Sie kriegen ja auch Prozente ab! Umsonst ist nicht mal der Tod bekanntlich.“
Karl ging dann aus, angeblich in den nächsten Kino. Kaum war er fort, als die blonde Helene, die draußen mit ihrem neuesten Verehrer ein wenig geschäkert hatte, erschien und sich zu Marie an den Tisch setzte.
„Der Postbote brachte wohl ’ne Depesche für den Gnädigen?“ meinte sie.
Die Köchin schüttelte den Kopf. „Postbote?“
„Na ja – eben war doch einer bei uns.“
Marie tat, als ob die Sache sie nicht weiter interessiere.
„Karl hat ihn abgefertigt,“ meinte sie und blätterte in ihrem Lieblingsbuche. „Wird wohl eine Depesche gewesen sein.“
Am nächsten Vormittag hatte sie dann sehr bald dank ihrer guten Beziehungen zu den Briefträgern festgestellt, daß Karl offenbar einen an den Herrn Doktor gerichteten Eilbrief unterschlagen hatte. Sie ging lange mit sich zu Rate, was sie unter diesen Umständen tun sollte. Ganz sicher war sie sich ihrer Sache ja nicht. Vielleicht hatte Karl auch nur von dem Missionskollekteur gesprochen, um sie irgendwie zu verulken, und den Brief doch dem gnädigen Herrn abgegeben, – vielleicht! – Zu gern hätte sie den Herrn Doktor danach gefragt. Aber das wagte sie nicht. Er war ja jetzt immer in so gereizter Stimmung. Vielleicht faßte er es als bloße Neugier auf, wenn sie ihm die Geschichte vortrug. – Jedenfalls kam sie zu keinem Entschluß und hatte Karls Schwindelei dann auch sehr bald vergessen.
Der Diener war mit der Straßenbahn bis in die Nähe des Lietzensees gefahren, nicht aber in den Kino gegangen, wie er Marie gegenüber erklärt hatte. Er hatte an der Gartenpforte der Blockhausvilla sehr lange warten müssen, ehe der magere Podgorski erschien und ziemlich kurz angebunden erklärte, die gnädige Frau wäre verreist.
„Wirklich? Na, das hätte sie mir wohl auch mitteilen können,“ meinte Karl recht anmaßenden Tones. „Wohin denn? Ich muß es wissen. Wichtige Sache!“
Podgorski zuckte die Achseln. „Nach Norwegen. Mehr weiß ich auch nicht. Die gnädige Frau wollte depeschieren, wann und wohin ihre Briefe nachgeschickt werden sollten.“ Er log – aber auf Befehl Gundra Gulbrans, die nachmittags von Müritz aus Frau Weyl antelephoniert und ihr genaue Verhaltungsmaßregeln gegeben, darunter auch bestimmt hatte, Karl Mühling im unklaren über ihren Aufenthaltsort zu lassen.
Karl überlegte. Dann sagte er, er hätte Podgorski ein Schreiben für die Frau Geheimrat auszuhändigen, das er aber erst einsiegeln müßte; er würde daher mit ins Haus kommen.
Podgorski, der den Kollegen wenig schätzte, meinte darauf, jener sollte doch lieber morgen den fertigen Brief bringen. Es wäre doch heute schon so spät, und er wollte schlafen gehen.
„Das können Sie nachher auch noch. Ich bleibe ja nicht lange,“ erwiderte Karl. „Los – öffnen Sie! Ich will das wichtige Schreiben auch nicht länger bei mir herumschleppen.“
Podgorski ließ sich überreden. Er und Frau Weyl hatten im Erdgeschoß ein kleines Wohnzimmer zu ihrer Verfügung. Dort saß die weißhaarige, weit über ihre Jahre hinaus alt erscheinende Haushälterin über einer Flickarbeit am Mitteltisch. Bei Karl Mühlings Eintritt und lautem „Guten Abend“ fuhr sie so entsetzt hoch, daß der späte Besucher lachend sagte: „Ich bin weder ’n Geist noch ’n Mörder, Frau Weyl.“
Er setzte sich dann an den Tisch, siegelte den unterschlagenen Eilbrief in einen Umschlag ein, nachdem er noch einen Zettel hinzugefügt hatte, und bat Podgorski dann um eine kleine Wegstärkung, erhielt auch einen dänischen Korn und wollte sich nun gerade verabschieden, als irgendwoher aus dem Hause ein dumpfer Ruf bis in das kleine Zimmer drang.
„Was war denn das?“ meinte Karl gespannt lauschend, ob der undeutliche Schrei sich nicht wiederholen würde.
Podgorski und die Weyl hatten einen schnellen Blick ausgetauscht.
„Katzen,“ sagte die Wirtschafterin kurz. „Wir haben im Keller Mäuse, und deshalb –“
„Katzen?“ fiel ihr Karl ins Wort. „Na hören Sie, – wenn das ne Katze is, dann bin ich ’n Kater! Der Schrei klang verdammt menschlich! – Ach – wieder!“
Podgorski nahm jetzt von einem Bücherbrett eine Bibel und begann halblaut einen Psalm zu lesen.
Karl war starr. „Was soll das – he, Podgorski, – Sie scheinen’s ja mit der Angst zu kriegen?!“
Da flüsterte die Haushälterin scheu: „Im Vertrauen, Herr Mühling, – es spukt bei uns. – Sie hören ja, – eben zum dritten Male der unheimliche Ruf! Es klingt immer, als schreie einer um Hilfe.“
Karl Mühling lächelte etwas gezwungen.
„Netter Unsinn – – spukt! Wer glaubt denn heute noch an so was! Wirklich – wie ein Hilferuf klingt’s. Soeben habe ich’s ganz deutlich gehört. – Ich muß jetzt aber gehen. Habe noch was vor. – Gute Nacht allerseits.“
Er hatte es sehr eilig, die Villa zu verlassen. Mit seiner Erhabenheit über Gespenster schien es doch nicht weit her zu sein.
Als Podgorski das kleine Wohnzimmer wieder betrat, sagte er zu der Haushälterin:
„Na, da haben wir uns noch mal fein rausgeredet. Ein guter Gedanke von Ihnen, wahrhaftig!“
„Auf den Sie mich erst durch die Bibel gebracht haben,“ meinte Frau Weyl bescheiden. „Sie wollten doch auch offenbar darauf hinaus, als er an die Katzen nicht glaubte.“
„Freilich. Und Sie halfen so trefflich dabei, Berta, das uns jeder den Spuk geglaubt hätte. Jetzt will ich aber doch mal zusehen, ob ich ihn nicht zur Ruhe bekomme, unser Gespenst!“ –
Zu derselben Stunde saß Heinz Lüder daheim an seinem Schreibtisch und hatte einen langen Briefumschlag in der Hand, in dem der Monatsschau vor einiger Zeit von Manfred Ullriegi ein Artikel eingeschickt worden war.
Der Hüne Lüder verstand sich recht gut auf Handschriften. Als ihm vorhin dieser Umschlag in die Finger gekommen war, den er weggelegt hatte, um ihn aufzuschneiden und ihn dann wieder zu benutzen, hatte er sofort gestutzt. Die Handschrift kannte er, hatte er doch unlängst noch genauer betrachtet, da sie für ihn aus irgend einem Grunde besondere Bedeutung gehabt! Aber – wessen Schrift war’s?!
Ullriegi hatte die Aufschrift auf dem Umschlag nicht geschrieben. Diese Arbeit überließ er entweder seiner Frau oder öfters noch seinem Diener, um sich durch das Fertigmachen der Manuskripte zum Versand nicht aufzuhalten.
Hm – wo aber hatte er – Lüder – doch nur vor kurzem diese Schrift, den Umständen nach sicherlich die Karls, des Ullriegischen Dieners, zu Gesicht bekommen, – wo nur?!
Da – plötzlich die Erleuchtung! Richtig – bei Gundra Gulbran! Der Zettel in dem Buche des Staatsanwalts v. Linden, – und auch der Rest des verbrannten Zettels! Auf diesen beiden hatte er diese Schrift vor sich gehabt, – die Schrift des geschmeidigen überheblichen Karl!
Heinz Lüder pfiff leise durch die Zähne. – Donner noch eins – das war ja eine recht bedeutsame Feststellung. Berücksichtigte man nämlich den Inhalt des einen Zettels und die Worte auf dem Fragment des anderen, so mußte man notwendig zu dem geradezu unglaublichen Schluß kommen, daß die rotbraune Hexe diesen verd…… Lümmel, den Karl, als Spion benutzt hatte.
Lüder liebte die kräftigen Ausdrücke. Auch in Gedanken. Und so belegte er denn jetzt den Diener seines Freundes mit Schmeichelnamen, die im allgemeinen nur bei Auseinandersetzungen zwischen stark angeheiterten Kaschemmenbrüdern üblich sind.
Aber auch Gundra Gulbrans gedachte er in einer Weise, die zu ein paar Beleidigungsklagen gereicht hätten, falls diese Gedanken ihr zugänglich gemacht worden wären.
In seiner tiefen Empörung war er aufgesprungen und in dem großen Zimmer erregt auf und ab gegangen. So fand ihn Frau Mieze Worch, seine Hausdame, vor, der er nun, um seinem Herzen wenigstens etwas Luft zu machen, entgegenrief:
„Ich sage Ihnen, Frau Mieze, die Welt ist hundsgemein – Tatsache! Ich bin da eben wieder hinter ein Intrigenspiel gekommen – unerhört, unglaublich, schandbar!“
Frau Worch, die auf einem Tablett für Lüder das übliche Kännchen Kaffee brachte, ohne das er abends nie arbeitete, nickte und meinte:
„Da kann ich nur beipflichten, was die Schlechtigkeit der Welt anbetrifft.“ Sie stellte das Kännchen, die Tasse und den Sahnennapf auf den Schreibtisch, drehte sich dann langsam um, schaute nach Lüder hin und fuhr, den Kopf senkend, fort: „So leid es mir tut, aber – ich muß kündigen, Herr Lüder.“
„Na nu? Kündigen? Schon wieder mal?!“ polterte er und trat vor sie hin. „Weshalb denn, zum Donner? Behandele ich Sie schlecht? Wünschen Sie Gehalterhöhung? – So reden Sie doch!“
Sie war sehr rot geworden. Und er dachte jetzt an Ullriegis Worte: „Sie liebt Dich!“ dachte weiter, daß Frau Mieze Worch doch tatsächlich ein Prachtweib, auch äußerlich, wäre.
„Raus mit der Sprache! Und: Kopf hoch, Frau Mieze! Mich mal offen angeschaut! Weshalb also wollen Sie mir den Schmerz antun und hier abbauen?“
„Weil – weil ich zu jung für diese Stellung bin, weil es überall böse Zungen gibt.“
„Aha – ahnte ich’s doch!“ meinte er ingrimmig. „Die lieben Nächsten – das ist ne Bande!“
Er nahm ihr das Tablett aus der Hand, legte es beiseite und wies auf einen der Sessel am Mitteltisch.
„Setzen Sie sich. – So, und nun hören Sie mal zu, Mieze! Die ganze Situation hier ist nicht gerade neu. In Novellen und Romanen findet man genug ähnliche: Die Hausdame will böser Zungen wegen den noch nicht genügend mummelhaften Greis verlassen! – – Aber: dieser Greis sagt hier in unserem Falle jetzt: Gut – gehen Sie, – und kommen Sie bald wieder – – als Hausdame nicht mehr, nein, als Hausfrau!“
Er hatte ihre Hände in die seinen genommen und zog sie nun zu sich empor, bis sie beinahe an seiner Brust lehnte. Sie sträubte sich nur schwach, sagte nur leise: „Quälen Sie mich doch nicht …“
„Doch – ich will Dich quälen, martern, foltern, Mieze, – bis Du ja sagst“, flüsterte er mit liebem Lächeln. „Also – willst Du mein Weib werden …? Ja oder nein …“
Manfred Ullriegi behielt recht: Sie liebte Lüder und sagte: Ja! –
Nach einer halben Stunde waren sie dann wieder so weit, daß sie auch über ernsthafte Dinge sprechen konnten. Er erzählte ihr alles, was mit Gundra Gulbran und Agathe Ullriegi zusammenhing.
„Mir ist jetzt ein Licht aufgegangen“, sagte er unter anderem. „Die Gulbran hat Manfred geliebt. Als er sie verschmähte und Agathe Rautensen wählte – er hätte sich auch dies besser überlegen sollen! – hat die gefährliche Hexe sofort den Kampf gegen ihn aufgenommen: Fahrt nach Hamburg! – und jetzt wieder hat sie einen Keil in diese Ehe getrieben, hat glücklich erreicht, daß Manfred die geborene Rautensen wieder losgeworden ist … – Wie hat sie diesen Bruch nun fertig gebracht? Das lohnt genauer untersucht zu werden … – Von den beiden Zetteln und dem Schleicher, dem Diener Karl, sprach ich schon. Ich wette nun, daß die Angaben auf dem einen Zettel, den ich noch unversehrt erwischte, mit diesem Kladderadatsch bei Ullriegis zusammenhängen. Erst nachträglich ist mir eingefallen, daß ja Manfreds langjährige Wirtin Karoline Schmiedecke hieß, die mir sehr gut bekannt ist und bei der ich stets einen Stein im Brett gehabt habe – stets! Ich bin nun heute über mittag in dem Hause Alsenstraße 16 gewesen. Mutter Schmiedecke, deren Gesicht sich durch Schnurrbart und zwei Riesenwarzen am Kinn auszeichnet, empfing mich jedoch mit einer so eisigen Kälte, als wäre ich ein pfändungsbeschlußbewaffneter Gerichtsvollzieher, komplimentierte mich dann sehr bald wieder „nach außen“, da ich mich für ihren Geschmack offenbar zu eifrig nach Manfred erkundigte, erregte aber gerade durch diese übertriebene Unliebenswürdigkeit meinen Argwohn, – gerade dadurch! Ich bin also jetzt felsenfest davon überzeugt, daß die Ursache zu der Entzweiung des Ehepaares in der Alsenstraße zu suchen ist. Ob tatsächlich, wie man nach dem Zettel annehmen könnte, die Tänzerin Gustava Olten hier eine fragwürdige Rolle spielt, möchte ich bestreiten. Ich kenne Manfred! Er hat Agathe aus Liebe geheiratet. Ihn mag gerade ihre kühle Art gereizt haben. Und aus Liebe zu ihr hat er auch all das hingenommen, was ihm dieses letzte Jahr verbittert hat. Agathe paßt eben zur Gattin des Schriftstellers wie ein Stück Eis zum Feueranzünder. Trotzdem hat er sie sicher nicht betrogen. Nein – in der Alsenstraße 16 muß es etwas anderes geben, das den Störenfried abgibt. Etwas – aber was in aller Welt?! Ich habe seit gestern unter Anspannung des Restes meines Hirns darüber umsonst nachgegrübelt. Ich finde keine Erklärung. Die Sache bleibt dunkel, schleierhaft. – – So, Mieze – Lieb, liegen die Dinge! – Hast Du vielleicht einen göttlichen Gedanken, wie man dieses Rätsel lösen kann …?!“
Sie verneinte, sagte nachdenklich:
„Ich gebe Dir vollkommen recht, Heinz: Gerade weil Dich die Warzen-Karoline so kurzer Hand wieder weggeschickt hat, muß sie kein ganz reines Gewissen haben. Die Lösung des Rätsels ist ohne Frage in ihrer Wohnung zu suchen …“
Sie sprachen noch ein langes und breites über dieses Intrigenspiel der Gulbran und seine Einzelheiten, entdeckten aber trotzdem nicht die Fäden, die zwischen dem Hause Alsenstraße 16 und Manfred Ullriegis Ehetragödie sich hin und her woben, und konnten daher auch trotz bester Absichten dem Doktor in keiner Weise helfend beispringen, zumal dieser ja auch nach wie vor über denselben dunklen Punkt hartnäckig und sogar mit deutlich herauszumerkender Angst vor einer Enthüllung dieses Geheimnisses sich ausgeschwiegen und auch hatte durchblicken lassen, daß ihm eine Einmischung Lüders durchaus unerwünscht wäre.
8. Kapitel.
Der stille Förderer aller gleich ihm gescheiterten und bereits einem staatlichen Besserungsversuch unterworfen gewesenen Existenzen, Herr Amtsgerichtsrat a. D. Kunkel, erging sich an demselben Abend bei der häuslichen Mahlzeit in bewegten Anklagen gegen den undankbaren und unzuverlässigen schwedischen Baron, der sich bei ihm seit jenem vergnügten Zechgelage nebst anschließendem Nachtlogis und Katerfrühstück nicht wieder hatte blicken lassen.
Je länger er diesen Gegenstand vor seiner nicht minder enttäuschten und empörten Gattin behandelte, die ebenfalls gehofft hatte, den Baron noch gehörig schröpfen zu können, desto mehr fiel er dabei aus der Rolle des gebildeten, studierten Mannes und geriet in jene Tonart hinein, die bei bestimmten Gelegenheiten in jenen Kreisen üblich ist, aus denen sich die Klientel des Winkelkonsulenten und heimlichen Gegners der strafenden Gerechtigkeit zusammensetzte.
„Baron und Schwede will er sein – lächerlich!“ rief er, mit der Gabel herumfuchtelnd, auf der ein halber Hering aufgespießt war. „Dann bin ich ein japanischer Fürst – ganz mit demselben Recht! Gewiß – die nötigen Papiere besitzt er ja. Sind natürlich gefälscht oder gestohlen! Ein Erpresser ist er, der es auf die Geheimrätin Gulbran abgesehen hat, nach der ich mich in seinem Auftrage, was den goldenen Untergrund anbetrifft, erkundigen mußte. Wir sein doch helle! Wir wissen Bescheid! So wie er sich damals besoffen hatte, besäuft sich kein Baron, noch dazu in Schnaps! Er spricht ein Deutsch, mit dem er allerdings als deutscher Baron nirgends auftreten könnte, der Lump, der mir für meine Bemühungen 500 Mark versprochen und nur dreihundert bezahlt hat! Ja – ein Jammer ist’s, daß der Bursche noch bei alledem schlau genug war, mir zu verheimlichen, weswegen er bei der Gulbran jeden Tag in der Lage sei, die Daumschrauben so anzuziehen, daß anstatt Blutstropfen schöne echte Banknoten herausspritzen aus den seiner Schilderung nach plastisch schön geformten Fingern! Ein Jammer! Sonst nämlich hätten wir gleichfalls versucht, der Dame etwas näherzutreten!“
Wütend biß er in den Hering hinein und warf dann seiner Rosa einen vernichtenden Blick zu, als sie zu äußern wagte: „Du wirst Dein Leben lang ein Schafskopf bleiben, Kunkel, der einen fetten Happen nie auf den eigenen Teller zu bringen weiß!“
Nach einer Weile hielt er sich dann doch für verpflichtet, sich gegen diese Injurie zu verteidigen.
„Was sollte ich in dieser Sache wohl noch mehr tun?! Bin ich nicht in seiner möblierten Zweizimmerwohnung gewesen und habe ich dort nicht heimlich alles durchsucht, um vielleicht wichtige Papiere zu finden?! Habe ich mich dabei nicht der Gefahr ausgesetzt, mit der Polizei in Konflikt zu geraten?! So schlau wie Du bin ich noch alle Tage, liebe Rosa, und wenn Du glaubst, ich merke nicht, daß Du mir nachts aus dem Portemonnaie heimlich Geld mopst, so bist Du erheblich im Irrtum! Auch Deine Beziehungen zu unserem Mieter, dem Filmonkel, dürften …“
Draußen schrillte die Flurglocke. Der Besucher war ein Kriminalbeamter, der Herrn Kunkel höflich bat, mit auf das Polizeipräsidium zu kommen, um dort dabei behilflich zu sein, einen eifrig gesuchten Verbrecher zu entlarven.
Kunkel stand scheinbar mit der Polizei geradezu auf befreundetem Fuß. Er beeilte sich auch jetzt, seinen Hering zu vertilgen und dann den Beamten zu begleiten. Es war nicht das erstemal, daß die Sicherheitsbehörde dieses Mannes sich bediente, der, wenn keine Gefahr damit verknüpft war, gegen Geld seinen besten Freund verraten hätte.
* * *
Agathe Ullriegi wartete nun bereits zwei Tage vergebens auf eine Antwort Manfreds, der doch den Eilbrief, wie sie sich ausgerechnet hatte, spätestens am Donnerstag morgen erhalten haben mußte.
Der Donnerstag ging hin. Nichts …! – Er hätte ja telegraphieren können, wenn ihm etwas daran lag, sich schnell mit ihr in Verbindung zu setzen … – Der Freitag ebenso – nichts, kein Lebenszeichen!
In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend schlief Agathe sehr schlecht. Manfred mußte den Eilbrief erhalten haben. Daß er nichts daraufhin tat, sondern sich in Schweigen hüllte, bewies genügend, wie tief verletzt er war. – Agathe weinte die Kissen naß. Ach, sie hatte ja von dem Briefe so viel erhofft, hatte geglaubt, Manfred würde sich sofort auf die Bahn setzen und zu ihr eilen … – Und nun?! – Er liebte sie nicht mehr, – ohne Zweifel war bei ihm das, was er ihr noch nach diesem einen Ehejahr an wärmeren Gefühlen entgegengebracht hatte, bei jener Aussprache völlig erloschen.
Agathe schluchzte und sehnte sich nach ihm … Ihr Schmerz war ehrlich und tief. Sie fühlte jetzt abermals mit aller Deutlichkeit, was Manfred ihr gewesen, obwohl sie bei ihren verschrobenen Moralbegriffen und Vorstellungen von Sittsamkeit diesen Mann, um den unzählige sie beneideten und für dessen Berühmtheit sie auch hier wieder viele Beweise erhielt, als Gatten nie völlig ausgekostet hatte, woran sie allein schuld war.
Jeder Schmerz, der halb Enttäuschung ist, hat eine Grenze, bei der die kritische Betrachtung dessen einsetzt, dem er gilt. Agathe erreichte diese Grenze schneller als eine Frau, die sich ganz allein die Schuld an einem ernsten Zerwürfnis mit dem Gatten zumißt. Das tat sie nicht. Selbst in den Sekunden tiefsten Herzenswehs vergaß sie nie, daß auch Manfred doch zum mindesten Geheimnisse vor ihr gehabt hätte, die noch sehr der Aufklärung bedurften.
Dann begann sie, als die Tränenbäche die Enttäuschung bei ihr größtenteils weggewaschen und mehr verletzte Eitelkeit als Seelenschmerz zurückgelassen hatten, seinen Anteil an diesem jähen Auseinandergehn mit Gedanken zu umspielen, die nach einem Verschulden geradezu suchten. – Ja – hätte Manfred damals bei jener erregten Auseinandersetzung nicht die Pflicht gehabt, jeden Verdacht gegen sich sofort zu zerstreuen …?! Hätte er nicht sehr wohl auch Zeit genug hierzu gehabt, bevor sie halb und halb sein Ehrenwort anzweifelte, und mußte man ihm diese flaue Verteidigung durch allerlei Redensarten nicht als ein Eingeständnis seines schlechten Gewissens auslegen?! War sein ganzes Verhalten damals nicht geradezu ein Scheingefecht, um die eigene Schwäche zu verhüllen …?!
Agathe lag da mit offenen Augen. In ihrem Herzen keimte schon wieder jene heimliche, zügellose Eifersucht auf, die den Mann, den sie liebte, mit Gefühlen scheinbaren Hasses umgab. – Wenn sie nur nicht diesen Eilbrief abgeschickt hatte, der Manfred wieder zum Herrn der Situation machte …! Wenn sie nur nicht durch das jäh erwachte heiße Sehnen nach seinen Zärtlichkeiten ihre Urteilsfähigkeit hätte trüben lassen …! Wie war es nur möglich gewesen, daß sie so vollständig sich als die einzig Schuldige hingestellt und daß sie all der Tatsachen, die gegen ihn sprachen, so wenig gedacht hatte …?! War nicht das Haus Alsenstraße 16, in dem er aus und einging, als ob er dort zu Hause wäre, ein nicht wegzuleugnender Beweis gegen ihn …?! Wo – wo nur war ihr kühl abwägender Geist in jener Stunde, als sie die Feder über das Papier gleiten ließ und Manfred ihre zerrissene Seele vor die Füße legte, damit er sie wieder aufrichtete …?!
Die Sehnsucht war in ihr plötzlich erloschen. Die Demütigung, daß er nichts getan, ihre Seele wieder zu heilen, die sie ihm vertrauensvoll dargeboten, erstickte die hellen Flammen auflodernder Wünsche. Es war, als ob Agathe Ullriegi wieder gegen Agathe Rautensen ausgetauscht würde. Diese Agathe verlangte jetzt nach dem heuchlerischen Frieden des großen, alten Hauses in der Alsterstraße. Die Fahrt nach Müritz sollte nur eine Zwischenstation auf der Heimreise werden. Gleich morgen wollte sie fort von hier; ohne Abschied von Gundra Gulbran, deren Namen die Frau Senator stets komödienhaft und schon im Klange voller Sünden benannt hatte. Ohne Abschied; denn Gundra würde sie nicht reisen lassen.
Agathe, die erst beim Morgengrauen zu diesem Entschluß gelangt war, hatte dann bald, mit brennenden Augen freilich und gequält von leisen Zweifeln, ob sie auch wirklich nunmehr das richtige getroffen, im Schlafe geringe Erholung für ihre überreizten Nerven gefunden.
Morgens gegen neun Uhr war sie gerade beim Packen, als es klopfte und Frau Gulbran eintrat. Agathe wurde verlegen, erwiderte fast stotternd den Gruß.
„Sie stehen im Begriff, eine große Torheit zu begehen, kleine Frau“, sagte Gundra und setzte sich unaufgefordert in die Sofaecke. „Sie haben auf Ihren Mann gewartet, glaubten, er müßte auf den Brief hin sofort zu Ihnen eilen. Wenn er nun den Eilbrief gar nicht erhalten hat, vielleicht verreist ist …?! Was dann?! – Dann sitzen Sie in Hamburg, und er wähnt Sie noch in Müritz, kommt hierher, findet niemand, wird sich sagen: „Die Erziehung meiner Frau Schwiegermutter blieb also doch Siegerin …!““
Agathe stand da mit schlaff herabhängenden Armen.
„An diese Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht“, sagte sie tonlos.
„Packen Sie wieder aus, liebe kleine Frau, und kommen Sie mit an den Strand …“ –
Die Strandkörbe der beiden Damen waren bisher neben dem Seesteg ohne Nachbarschaft geblieben. Heute aber hatten Gundra und Agathe kaum eine halbe Stunde dagesessen und in schleppender Weise über dies und jenes gesprochen, wobei Frau Gulbran eine gewisse nervöse Unruhe nur schwer unterdrücken konnte, als eine junge Dame mit einem etwa siebenjährigen, auffallend hübschen und ein wenig kokett herausgeputzten Mädelchen an der Hand auftauchte und dem Strandkorbverleiher, der ihr mit einem seiner besten Strandkörbe auf dem Rücken durch den feinen, weißen Sand nachstapfte, dann befahl, seine Traglast kaum acht Schritt von dem Platze der Damen entfernt aufzustellen.
Agathe starrte das wirklich liebreizende, blonde Mädelchen ganz verzückt an und raunte nun ihrer Nachbarin zu:
„Oh, welch’ schönes Kind …! Sehen Sie nur, liebe Frau Gulbran, – dieses herrliche, lange Blondhaar …! Nur das Gesichtel ist sehr, sehr blaß …“
Gundra lächelte kaum merklich, nickte und erwiderte:
„Anscheinend neu zugezogene Badegäste; die Begleiterin scheint die Bonne der Kleinen zu sein.“
Diese Annahme wurde jedoch sehr bald durch das Kind selbst widerlegt.
Ein helles Stimmchen rief jetzt hinter dem neuen Strandkorb:
„Tantchen, darf ich nicht Schuhe und Strümpfe ausziehen?“
Die Antwort war nicht zu verstehen, da die offene Seite des Strandkorbes nach der See gerichtet war, mußte aber bejahend gelautet haben, da die Kleine gleich darauf mit nackten Füßen und vergnügt einen Spaten schwingend auftauchte und eifrig einen Wall aufzuschütten begann, wobei sie lebhaft mit der Tante plauderte und so allerlei verriet, was ihr eigenes Persönchen anging.
Unter anderem rief sie nach einer Weile, die blonden Locken aus dem erhitzten Gesicht streichend:
„Keine Sorge, Tante Tapp. Ich werde mich schon nicht überanstrengen. Ich bin jetzt ja wieder ganz gesund, und der Onkel Doktor hat ja auch gesagt, ich sollte mich tüchtig ausarbeiten.“
Die Entgegnung war wieder nicht zu verstehen. Dafür ließ sich die Kleine abermals vernehmen:
„Ja, herrlich ist’s hier, Tante Tapp, viel schöner als an der Nordsee, wo es nur Dünen und wieder Dünen, aber keinen Wald wie hier gibt und auch keinen Seesteg. Wenn nur der Pappi bald nachkäme. Ich freue mich ja schon so sehr darauf, ihn vierzehn Tage ganz für mich zu haben.“
Agathe ließ kein Auge von dem Kinde, das ihr so merkwürdig bekannt vorkam und das sie doch bisher nie gesehen hatte, wie sie ganz bestimmt wußte.
Daß die Kleine Hildegard hieß, erfuhren die Damen dann durch „Tante Tapp“, die nachher einmal den Strandkorb verließ und die bisher geleistete Arbeit ihrer Nichte begutachten mußte.
Tantchen, eine schlanke Blondine mit einem feinen, nur etwas ernsten Gesicht nahm von Agathe und Gundra keinerlei Notiz, erklärte dann, daß der Wall hier und da noch nachzubessern wäre und daß Hildegard jetzt erst frühstücken müßte. In ihren Bewegungen zeigte sich eine graziöse, gefällige Ausgeglichenheit, und besonders in den Gesten der schöngeformten Hände lag eine geradezu künstlerische Formvollendung.
Daß die beiden verwandt waren, sah man jedenfalls auf den ersten Blick. Dies betonte jetzt auch Agathe Frau Gundra gegenüber.
„Das Blondhaar hat genau dieselbe Farbe. Und auch die gerade, griechische Nase und die dunklen Augen haben sie gemeinsam. Nur der Mund ist anders.“
„Und die Kinnpartie“, fügte Gundra hinzu.
„Ja – auch die Kinnpartie …“, wiederholte Agathe langsam. „Ich weiß nicht, an wen mich dieses ein wenig stark vorspringende, energische Kinn erinnert. Vielleicht an einen Engelskopf von Murillo auf irgend einem seiner Gemälde.“
„Schon möglich, liebe Frau Doktor. – Doch – ich werde wohl bald diese neue Nachbarschaft ins Pfefferland wünschen müssen, wenn Sie mich jetzt so gänzlich vernachlässigen“, scherzte sie gutgelaunt. „Ja – wenn Sie nun abgereist wären, wie Sie es vorhatten, dann hätten Sie dieses liebliche Geschöpfchen nie kennengelernt … Ob wir die Kleine nicht einmal anrufen …? Ich denke, sie wird recht zugänglich sein. Lieben Sie eigentlich Kinder, kleines Frauchen?“
Aga antwortete nicht gleich. Sie schaute nachdenklich über die grünblaue, leicht bewegte See hin und sagte dann:
„Ich kann Ihnen hierauf nichts erwidern, liebe Frau Gulbran. Ich habe mich in dieser Beziehung selbst noch nie geprüft. Ich meine nämlich, eine solche Prüfung, wie wir uns mit unseren Gefühlen dem kleinen Nachwuchs gegenüber stellen, ist durchaus notwendig. Daß nicht jede Frau infolge ihrer natürlichen Bestimmung als Mutter die Eigenschaft ohne weiteres besitzt, die man „kinderlieb“ nennt, ist ja wohl längst erwiesen. Jedenfalls habe ich als junges Mädchen für die kleine Welt nicht sehr viel übrig gehabt. Das mag darauf zurückzuführen sein, daß in meinem Elternhause die Kinder unserer Verwandten nie so recht als gern gesehene Gäste behandelt wurden, da meiner Mutter stark übertriebener Reinlichkeits- und Ordnungssinn diesen Besuchern gegenüber stets noch mehr gesteigert wurde, insofern nämlich, als das kleine Volk ja nur zu leicht das oberste zu unterst kehrt und wenig Respekt vor kostbaren Nippsachen, gewachstem Stabfußboden und zarten Teppichen hat. Als ich mich dann mit Manfred verlobt hatte und sah, wie schnell er sich die Herzen aller Kinder gewann, wie nachsichtig er ihnen gegenüber war und wie ihn der Anblick eines hübschen, strammen Bübchens oder eines zierlichen Mädelchens förmlich begeisterte, empfand ich etwas wie Eifersucht, mehr noch, fühlte mich ihm auch in dieser Beziehung unterlegen, da es mir vollständig abging, so schnell und treffend auf die Interessen der Kleinen und Kleinsten einzugehen wie es ihm stets glückte. Zuweilen habe ich mich über ihn geradezu geärgert, da er mir bald auf diese, bald auf jene Weise das Verständnis für die Kinderseele beibringen wollte, wie er es nannte. Ich sah mich durchschaut, das heißt meine Gleichgültigkeit gegenüber dem kleinen Volke, und dies war mir unangenehm. Auch in der Ehe hat Manfred nie aufgehört, auf mich in dieser Beziehung einzuwirken, und ich gestehe ein, daß ich halb aus Trotz stets erwidert habe, erst die Zukunft würde lehren, ob ich eine gute Mutter sein könnte. Nun – bisher sind uns ja Kinder versagt geblieben. Ich glaube jetzt aber doch, daß ich in einem so kleinen Wesen völlig aufgehen könnte. Zum Beispiel beneide ich die Mutter der blonden, süßen Hildegard dort drüben glühend um ihren Liebling. Dieses Kind übt auf mich eine seltsame Anziehungskraft aus, ehrlich gestanden. Ja – wir wollen versuchen, uns mit Hildchen anzufreunden. Sicherlich wird es der Kleinen gelingen, mich schnell zur Kinderschwärmerin zu machen, worüber Manfred sehr glücklich wäre.“ Sie wollte noch mehr hinzufügen. Aber die Gedanken an das, was jetzt Schweres auf ihr lastete, an das Zerwürfnis mit ihrem Gatten und dessen unerklärliches Schweigen auf den reumütigen, entgegenkommenden Brief trieb ihr gerade jetzt wieder die Tränen in die Augen und ließ ihre Stimme unsicher und traurig werden. Sie mochte vor Frau Gulbran diese trostlose Stimmung, die so plötzlich sie befallen hatte, nicht verraten und schwieg daher.
Gundra lächelte fein. Ihr reizvolles Gesicht wurde durch diesen von innen herausstrahlenden Sonnenschein wunderbar verschönt. Wer sie so sah, hätte nie denen geglaubt, die ihr nachsagten, daß sie aus Machtgelüst in die Schicksale der Menschen einzugreifen suchte, daß es eine braunrote Hexe gäbe, vor der man sich inachtnehmen mußte.
9. Kapitel.
Manfred Ullriegi durchlebte Tage tiefen inneren Zwiespaltes wie nie zuvor. Daß Agathe ihn verlassen, empfand er zunächst wie eine Erlösung. Die letzte Zeit mit all ihren Sorgen und Ängsten hatte ihn zu sehr zermürbt um ihn sofort fähig zu machen, den neuen Zustand beginnender völliger Freiheit – denn daß seine Frau sich von ihm scheiden lassen würde, nahm er als gewiß an – richtig einzuschätzen. Diese Ehe hatte ihm ja von Anfang an nur Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten gebracht. Agathes Gefühlskälte und ihr mangelndes Verständnis für die Denkweise und Daseinsgestaltung eines freischaffenden Künstlers, den die Welle des Erfolges bis hinauf zur Höhe eines Ruhmes gehoben, der gefestigt und verteidigt werden mußte, ihre Unfähigkeit, sich in den Kreisen der Gesellschaft von Berlin W. zurechtzufinden und ihr trotziges Festhalten an einer geradezu kleinlichen Hausordnung nach dem Muster des Hamburger Senatorheims, aus dem sie zu ihm mit einem Ballast von veralteten, in vielem eine tiefe Verachtung persönlicher Eigenart und des Selbstbestimmungsrechtes moderner Menschen verratenden Anschauungen gekommen war, – all dies hatte mitgeholfen, während eines knappen Jahres nicht nur das Schaffen ihres Mannes ungünstig zu beeinflussen, sondern in ihm auch einen Zustand dauernder Gereiztheit hervorzurufen, der ihn sich ihr gegenüber immer mehr innerlich abschließen und so die Kluft noch erweitern ließ, die bei etwas mehr Geduld seinerseits vielleicht noch zu überbrücken gewesen wäre.
Doktor Ullriegi wagte sich nach Agathes Abreise kaum einen Schritt aus dem Hause. Er fürchtete[9] Bekannte und deren Fragen nach seiner Frau. Nur abends floh er aus den Räumen, wo er tagsüber die endlos langen Stunden in mehr und mehr sich steigernder, herber Selbstkritik zugebracht hatte. Er ging hierbei mit sich streng ins Gericht, schonte sich nicht. Er war auch sich selbst gegenüber stets rücksichtslos ehrlich gewesen.
Einmal hatte er Heinz Lüder besucht. Doch dessen eindringliche Bitten, ihm doch zu erklären, was es eigentlich mit dem Hause Alsenstraße 16 auf sich hätte, hatten ihn schnell wieder verscheucht. Er sah sein Geheimnis auch von dieser Seite bedroht, und er war noch nicht weit genug in dem Gefühl innerer Vereinsamung gelangt, um zu erkennen, daß er diese Bürde, diese Flecken von einst nicht noch länger vor denen, die seinem Herzen nahe standen, verbergen könnte.
Neben diesen inneren Kämpfen brachte der Alltag mit seinen prosaischen Anforderungen ebenfalls genügend Ärger und Unzulänglichkeiten mit, die ihm die Trennung von Agathe ebenfalls in einem besonderen Lichte zeigten. Der Diener Karl hatte am zweiten Tage nach Agathes Abreise erklärt, er fühle sich krank und bäte um seine Entlassung. Ullriegi, der den intelligenten Menschen viel mit schriftlichen Arbeiten nebenbei beschäftigt und ihn mühsam zu einer Art Buchhalter für sich erzogen hatte, merkte sehr wohl, daß den geschmeidigen Berliner ganz andere Gründe dazu bewogen, diesen angenehmen Posten aufzugeben. Er ließ ihn auch gehen, gab ihm noch ein gutes Zeugnis mit und war doch in seinem Herzen bitter enttäuscht, hier auf so offenbaren Undank gestoßen zu sein. Helene wieder, das Stubenmädchen, vernachlässigte ihre Pflichten aufs gröbste, ließ sich kleine Unredlichkeiten – Plündern der Zigarrenkisten für ihre Verehrer – und allerlei Freiheiten zu Schulden kommen, die zu rügen Ullriegi viel zu müde und gleichgültig war. Die brave, anhängliche Marie aber, die Agathe aus Hamburg mitgebracht hatte, behandelte den gnädigen Herrn unfreundlich und bewies, daß sie bei schlechter Laune ein recht unleidlicher Hausgenosse sein konnte und daß es für sie sehr wohl eine Möglichkeit gab, die geliebte junge Frau Doktor durch die Zusammensetzung der Mahlzeiten an dem Herrn Gemahl zu rächen. Es kamen nur Gerichte auf den Tisch, die Ullriegi als Hamburger Spezialkost verabscheute.
So standen die Dinge, als am Morgen des vierten Tages nach Agathes plötzlicher Rückkehr ins Elternhaus – denn der Doktor ahnte ja bisher nichts von ihrem Aufenthalt in Müritz – sich bei ihm das alte Faktotum Gundra Gulbrans, der hagere Podgorski, durch Helene anmelden ließ. Dieser hatte eine schlechte Zeit gewählt. Ullriegi war gerade von einem Neider niedrigster Sorte eine Besprechung seines schon von Lüder so abfällig beurteilten neuen Romans anonym zugeschickt worden, die, in einer der angesehensten Provinzzeitungen veröffentlicht, ihn als sinkenden Stern, als Eintagsfliege hinstellte.
„Was will der Mann?“ fuhr der Doktor die blasse Helene barsch an. „Ich habe keine Lust, mir Gleichgültiges vorerzählen zu lassen. Persönliche Angelegenheit? Vielleicht eine Bettelei! Der Podgorski soll mir schreiben.“
Doch der alte Mann ließ sich nicht so leicht wegschicken.
„Sagen Sie dem gnädigen Herrn,“ erklärte er der schnippischen Helene, „daß er ein gutes Werk an jemand täte, der ihm einst nahestand, wenn er mich anhören würde.“
Da wurde Ullriegi doch neugierig.
Podgorski saß in dem roten Saffianledersessel und drehte verlegen seinen steifen Hut hin und her.
„Nun, was gibt’s?“ mahnte der Doktor zum zweiten Male.
Der Alte, dessen Augen Fremden gegenüber meist so ängstlich und scheu waren und der als Gesamterscheinung keinen sehr günstigen Eindruck machte, raffte sich auf und sagte stockend:
„Gnädiger Herr, darf ich ohne Scheu sprechen? Ich muß nämlich Dinge berühren, die Ihnen gegenüber zu erwähnen als Taktlosigkeit ausgelegt werden könnte.“
„Reden Sie, Podgorski. Sie werden ja wohl Grund haben, Sachen vorzubringen, die nicht ganz passend für eine Aussprache sind.“ Ullriegis Spannung war nach dieser Einleitung berechtigt, und er fügte daher noch hinzu: „Einem Mann in Ihrem Alter ist vieles erlaubt, was bei einem Jüngeren aufdringlich und vielleicht unverschämt aussehen könnte.“
„Es handelt sich um meiner Herrin guten Ruf,“ begann Podgorski leise. „Ich komme als Ratsuchender gerade zu Ihnen, weil es doch vor Ihrer Heirat zwischen Frau Gulbran und Ihnen, wie uns, der Frau Weyl und mir, bekannt – Beziehungen gegeben hat, die unsere gütige gnädige Frau hoffen ließen, dereinst – hm, ja – dereinst Ihren Namen zu tragen, Herr Doktor.“
Ullriegi, der im Zimmer auf und ab gegangen war, blieb stehen.
„Mann, Sie – Sie phantasieren. Davon habe ich nie etwas gemerkt, daß Frau Gulbran anders an mich dachte als an einen – na sagen wir – guten Freund.“
Podgorski wiegte den grauen Kopf hin und her.
„Herr Doktor, ich bin vielleicht gebildeter, als Leute in meiner Stellung es für gewöhnlich sind. Und meine Menschenkenntnis und Welterfahrenheit mögen auch – teuer genug sind sie erkauft – weit über das Durchschnittsmaß hinaus ragen. Nicht viel anders steht es mit meiner Gefährtin Frau Weyl. Kurz: Wir beide haben für alles, was in der Holzvilla am Lietzensee vorgeht, sehr gute Augen. Unsere Herrin ist für andere wohl ein schwer zu lesendes Buch; nicht so für uns. Wir drei sind mit den Jahren doch sehr eng miteinander verwachsen. Nun – jedenfalls ist es Tatsache, Herr Doktor, daß Frau Gulbran eine zeitlang gehofft hat, Sie würden sie heiraten. Sie hat Sie sicherlich sehr, sehr lieb gehabt. Wie besorgt sie noch heute um Ihr Wohlergehen ist, ahnen Sie nicht.“
„Um mein Wohlergehen?“ Das klang so ironisch, daß der Alte kopfschüttelnd meinte:
„Ach – also vermute ich doch richtig! Auch Sie, Herr Doktor, beurteilen Frau Gulbran falsch, trauen ihr wohl gar häßliche Dinge, Intrigen und Ränke zu.“
„Na – wenn wir denn schon ehrlich sein wollen, – ja, ich traue ihr nicht und traue ihr vieles zu.“
Podgorski schaute auf den schwarzen Hut in seinem Schoß.
„Darf ich Ihnen zunächst mal so einiges aus meinem Leben beichten, Herr Doktor?“ meinte er dann mit einem traurigen Lächeln. „Aus dem Leben eines Zuchthäuslers, eines Banknotenfälschers, den erst die Hand einer Frau auf den Weg der Ehrlichkeit zurückgeführt hat?“ – Als der Doktor jetzt eifrig und voller Interesse bejahte, deckte Podgorski seinen Daseinsweg wie einen bisher vor der Welt ängstlich verhüllten Irrgarten auf.
„Die Zuchthauspforten öffneten sich dem zum dritten Male wegen Falschmünzerei verurteilt Gewesenen,“ fuhr er fort, als er nun bei dem helleren Teile seiner Lebensbahn angelangt war. „Fast zwölf Jahre hatte ich insgesamt hinter kahlen Mauern zugebracht, zuletzt sogar – sechs endlose Jahre. Ein völlig an Körper und Geist Gebrochener verließ damals die Strafanstalt, einer, in dem nur noch eins lebendig war: eine dumpfe Wut gegen die Menschheit, die sich angemaßt hatte, mich zu richten, – mich, der ich doch stets geglaubt hatte, an ursprünglicher Intelligenz hoch über allen zu stehen. Ja – ein namenloser Dünkel, ein krankhaftes Eingebildetsein auf meine geistigen Fähigkeiten war mein Unglück geworden, denn das, was ich in ehrlichem Streben erreicht hatte, stand zu dieser hohen Meinung von meinem eigenen Ich in keinerlei Verhältnis. – Da war es Frau Gulbran, die mich sofort in ihr Haus aufnahm, nachdem sie sich schon vorher mit dem Zuchthausgeistlichen in Verbindung gesetzt hatte, der mich noch nicht ganz verloren gab. Nur widerwillig ging ich auf ihre Vorschläge ein. Aber bereits die erste Stunde in der Villa draußen am Lietzensee machte aus mir einen anderen Menschen. Frau Gulbran redete mir in Gegenwart Frau Weyls, die sie genau wie mich von der Zuchthaustür fort in ihr Heim geholt hatte, ins Gewissen. Und wie tat sie das! Oh – ich habe doch in der Strafanstalt manche gute Predigt Sonntags gehört. Aber hier sprach der alles verstehende und verzeihende Mensch nicht zu dem Sträfling, sondern zu Seinesgleichen, eben zu einem Manne, der „nur zu wollen braucht, um wieder in die menschliche Gesellschaft als vollwertiges Mitglied aufgenommen zu werden.“ Ich habe geweint; Frau Weyl weinte, und Frau Gundra stand vor uns als guter Engel. – Ja, Herr Doktor, wenn ich heute als zufriedener, ich kann fast sagen: glücklicher Mann meine Pflicht tun darf, so danke ich dies ausschließlich Gundra Gulbran, die wir – die Weyl und ich – lieben und verehren wie eine Gottheit. – Oh – wir sind ja nicht die ersten und die letzten gewesen, die sie, nach vielen bitteren Enttäuschungen, auf den rechten Weg zurückgeführt hat. In aller Stille wirkt sie als Trösterin und Helferin der Gestrauchelten. Nicht etwa als Mitglied von Vereinen mit ähnlichen Bestrebungen. Nein, ganz allein verfolgt sie ihr Ziel. Niemand soll etwas davon wissen. Öffentlichen Dank verschmäht sie. Das Bewußtsein, Gutes zu tun, genügt ihr. – – So, Herr Doktor, – nun zur Gegenwart, zu den Ereignissen der letzten Zeit. Und zwar zuerst zu Ihrer eigenen Person. Sie wissen ja nun, daß meine Herrin Sie geliebt hat. Und diese Liebe mag, als Sie eine Andere wählten, nicht wie bei Durchschnittsweibern in Haß und Rachsucht, sondern vielmehr in warme Teilnahme, etwas wie mütterliche Fürsorge, sich gewandelt haben. Ich hörte einmal, wie Frau Gulbran zu der Weyl sagte: „Er geht zu Grunde an den Unzulänglichkeiten dieser Ehe. Ich muß ihn zu retten suchen.“ Und nach diesen Worten beurteilen Sie bitte das, was ich dann beobachtet habe. Meine Herrin setzte sich mit Ihrem Diener Karl Mühling ins Einvernehmen, benutzte ihn, um ein wenig schönes Wort zu gebrauchen, als Spion. Karl Mühling ging häufig seit etwa vier Wochen bei uns ein und aus, schickte auch schriftliche Botschaft. Was für Aufträge er erhalten, was er meiner Herrin zugetragen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls ist er dann, nachdem Frau Gulbran soeben abgereist war, mit einem Brief zu uns gekommen, der – der an Sie gerichtet war und den er wohl unterschlagen haben wird. Ich las die Adresse. Ich habe gute Augen. Er siegelte ihn in einen anderen Umschlag ein. Und Frau Weyl hat ihn dann der Herrin nachgeschickt.“
Ullriegi ließ sich in den Sessel an der anderen Tischseite fallen.
„Unglaublich!“ murmelte er. „Unglaublich! Mir schwirrt förmlich der Kopf.“
„Ja ja, Herr Doktor, das Leben, die Wirklichkeit baut Romane auf, wie sie jeder Phantasie zu spotten scheinen. – Aber – es kommt noch ärger. – Sie werden ja wohl wissen, daß bei Frau Gulbran seit kurzem ein Herr verkehrt, der sich Baron Löwengaart nennt. Dieser angebliche Baron wurde der Störenfried unseres stillen Hauses. Daß er einen großen Einfluß auf unsere Herrin besaß, merkten wir sehr bald, auch, wie unheilvoll dieser Einfluß war. Wenn Löwengaart dagewesen, dann war Frau Gulbran stets in trauriger Stimmung, dann sprach sie Todesahnungen aus, redete von Lebensmüdigkeit, von dem letzten Schritt einer Verzweifelten. Die Weyl und ich haßten diesen Baron daher auch mit jener tiefen Wut, die zu allem fähig ist. Seltsamerweise hat sich Frau Gundra nie über diesen Menschen zu ihrer Vertrauten, der Weyl, irgendwie geäußert – nie! Beweis genug, daß er stärker war als sie, daß er sie beherrschte, daß sie ihn fürchtete. Und dieser Mann erschien nun mittags an jenem Tage bei uns, an dem unsere Herrin in aller Frühe Berlin verlassen hatte. Sie hatte am Abend vorher zur Weyl gesagt – und dies war das einzige, was auf ihre Furcht vor Löwengaart klar hindeutete: „Ich muß fliehen!“ – – Er kam. Enttäuschung und versteckte Wut strahlte sein ganzes Benehmen aus. Und in dieser rachgierigen Enttäuschung hat er voller Hohn uns mitgeteilt, woher er Frau Gundra kennt. – Herr Doktor, erst nachher, wenn Sie alles erfahren haben, werden Sie begreifen, daß ich Ihnen dasselbe hier jetzt berichten muß, was ein Gestrauchelter, ein Verbrecher, aber ein bis in den tiefsten Seelenwinkel gemeiner Lump, voller Schadenfreude vor uns ausbreitete.“
10. Kapitel.
Podgorski schaute sich ängstlich um, bevor er weitersprach. Er fürchtete, daß jemand lauschen könnte. Und seine Stimme wurde daher leise und vorsichtig.
Der Doktor saß still da. Was er vernahm, war mehr, als die kühnste Phantasie dieser Frau zugetraut hätte, die die Zuchthäusler in ihr Heim nahm und Seelen umformte nach ihrer Art.
Des Alten Ton wurde schärfer, energischer.
„Jedes Wort dieses Elenden triefte vor Gemeinheit. Mit Behagen sah er unsere bleichen, bestürzten Gesichter; mit Beweisen, die nicht anzuzweifeln waren, zerstreute er erst unseren Unglauben, – malte er dann die Folgen aus, wenn erst alle Welt wüßte, woher Gundra Gulbran kam, als der Konsul, der feine, geistig so hochstehende Herr, sie kennenlernte, derselbe, dessen Namen sie nachher tragen durfte. – Als Löwengaart wie ein Teufel grinsend dasaß und seinen Lippen die ernstgemeinte Drohung entschlüpfte, meine Herrin öffentlich an den Pranger zu stellen, wenn sie nicht ihre Habe mit ihm teilte und zu diesem Zweck sofort zurückkehrte, da – da, Herr Doktor, erwachte in mir das Tier nochmals, – das Tier, das keine moralischen Bedenken, keine Angst vor den Folgen seines Tuns kennt, das blindlings vernichtet, tötet, den Gegner unschädlich macht. – Ich sprang dem Lump an die Kehle. Wenn er noch lebt, – er dankt es nur der Weyl, die mich zurückriß. Er lag bewußtlos vor uns. Und wir – wir Gestrauchelten sahen uns an, verstanden uns. Wir wollten Zeit gewinnen. Und nun birgt die Villa im Keller einen Gefangenen. – Wir haben dann beraten, was wir weiter tun müßten, um das Unheil von unserer Herrin abzuwenden. Erst sollte die Weyl ihr alles schreiben. Wir verwarfen dies wieder. Wir überlegten täglich: Was soll werden?! Ewig kann der da unten in dem dunklen Kellergelaß doch nicht bleiben. Und – wenn ihr ihn freigebt, dann wird er, selbst wenn er vorher geschworen hat zu schweigen, nicht nur die Herrin, sondern euch mit verderben. Freiheitsberaubung, Körperverletzung! Man hätte uns ja verurteilen müssen deswegen. – Ja, Herr Doktor, nun wissen wir weder ein noch aus. Nun – nun bin ich in unserer Unentschlossenheit und wachsenden Angst, hier eine böse Unüberlegtheit begangen zu haben, zu Ihnen gekommen. Ich kenne Sie als einen Mann, der für jeden ein gutes Wort, der volles Verstehen für menschliche Unzulänglichkeit hat. Raten Sie uns. Was sollen wir tun?“
Ullriegi fuhr sich mit der Hand über die Stirn hin.
„Ich muß mich erst sammeln, Podgorski. Lassen Sie mir ein wenig Zeit zum Nachdenken. Sie haben meine Gedanken völlig aus der Bahn gewohnten Arbeitens gebracht.“
Der Doktor blickte vor sich hin. Die Sonne schien durch die Fenster. Die hellen, schiefen Vierecke auf dem Fußboden, leere, leuchtende Flächen, zogen die Augen des Nachsinnenden an, hielten sie fest, und diese Flächen füllte nun das lebhafte Denken eines, der mit Menschenschicksalen in seinen Romanen zu spielen gewohnt war, mit allerlei Bildern, als ob auf die weiße Wand ein Lichtbilderapparat eine Folge buntbewegter Szenen hervorruft.
Ullriegi sah seinen ungetreuen Diener mit dem Eilbrief in der Hand in der Villa draußen am Lietzensee. Von wem war der Brief? Von Agathe?
Er wollte diese Frage klären, die sich störend immer wieder in seine Gedanken eindrängte. Er sprang auf, holte einen Brief Agathes herbei, zeigte Podgorski die Anschrift auf dem Umschlag.
Der Alte nickte. „Ja – die Schrift ist wohl dieselbe.“
Also doch Agathe! Und ein Eilbrief! Was mochte er enthalten? Weshalb stellte Gundra Gulbran ihm dieses Schreiben nicht wieder zu? Weshalb nur?! – Er mußte es sehen – so schnell als möglich! Aber – wo war Gundra jetzt?
Podgorski sagte auf diese Frage hin sehr zögernd und verlegen: „Ich darf eigentlich nicht antworten. Nein, – und doch, wenn auch die Herrin ihren Aufenthaltsort geheim gehalten haben will, – Sie, Herr Doktor, haben ein Recht, das bessere Recht auf den Brief.“
So erfuhr Ullriegi, daß Gundra in Müritz sich aufhielt. –
Gleich darauf brach er mit Podgorski nach der Villa am Lietzensee auf, ließ sich dort den angeblichen Baron vorführen, dem der Alte ein Paar sichere Handfesseln um die Gelenke gelegt hatte und der jetzt nach den wenigen Tagen einer durchaus nicht überstrengen Haft bereits mit dem Stoppelbart, dem verwilderten Haar und der ohnmächtigen Wut in den tückischen Augen mehr einem rohen Banditen als einem vornehmen Herrn glich.
Ullriegi schickte Podgorski aus dem Zimmer.
„Ihren wahren Namen haben Sie verschwiegen,“ begann er. „Wir wissen nur, daß Sie im Zuchthaus Mewe gleichfalls einmal gesessen haben müssen, wenn Sie dies auch ableugnen.“
Der angebliche Schwede schaute Ullriegi drohend an.
„Sorgen Sie dafür, daß man mich sofort freiläßt. Sofort! Oder – auch Sie werden sich ernste Unannehmlichkeiten durch die Begünstigung dieser Freiheitsberaubung zuziehen. Ich warne Sie!“
Das war die freche, sichere Sprache eines, der eine böse Waffe in Händen hat. – Ullriegi glaubte, nun sofort mit seinem Vorschlag hervortreten zu können.
„Sie sind weiter nichts als ein gemeiner Erpresser,“ sagte er kalt. „Ihretwegen wird man niemanden einsperren. Eine Geldstrafe genügt für die Festsetzung eines Burschen wie Sie. – Um aber eine Dame, die Sie jetzt öffentlich bloßzustellen drohen, zu schützen, sollen Sie sofort zehntausend Mark erhalten, wenn Sie ein Schriftstück unterzeichnen, in dem Sie zugeben, von Frau Gulbran die Hälfte ihres Vermögens erpreßt haben zu wollen.“
Der falsche Baron lachte höhnisch auf. „Das, was ich von dieser – „Dame“ weiß, ist etwas mehr wert. Legen Sie noch 15 000 zu, und – wir sind einig.“
„Nein,“ erklärte Ullriegi fest. „Entweder zehntausend oder – nichts und verlängerte Haft unten im Keller. Sie werden schon mürbe werden.“
„Meinen Sie?! – Vielleicht werde ich auch nicht so leicht mürbe. Vielleicht –“
Er verstummte, da Podgorski eilig eintrat, den Doktor nach der Tür winkte und eifrig auf ihn einflüsterte.
„Draußen im Garten steht ein Herr, der sich Amtsgerichtsrat a. D. Kunkel nennt. Er erklärte mir, er wüßte, daß der Baron Löwengaart hier verkehrt hat. Ob ich ihm vielleicht sagen könnte, wann dieser zum letzten Mal bei Frau Gulbran gewesen? Es gäbe dabei viel Geld zu verdienen. Der Baron wäre nämlich verschwunden, die Polizei aber hinter ihm her, da es sich um einen berüchtigten Einbrecher namens Lohart handele, der aus einem schlesischen Zuchthaus unlängst ausgebrochen wäre, nachdem er zwei Wärter niedergeschlagen hätte.“
So berichtete Podgorski erregt und ängstlich, fügte hinzu: „Was tun wir nun? Dieser Amtsgerichtsrat macht auf mich den Eindruck, als ob er selbst nicht viel besser als Lohart ist, mit dem er bekannt zu sein behauptet – infolge geschäftlicher Beziehungen. Womöglich hat er Verdacht geschöpft, hofft den Lohart hier zu finden. Er tritt recht unverschämt auf, so wie einer, der in trüben zu fischen gewöhnt ist.“
Ullriegi sann nach. „Kunkel? – Es gibt einen üblen Winkelkonsulenten dieses Namens. Ja – er wird’s wohl sein. – Bleiben Sie hier, ich werde mit dem Herrn sprechen.“
Kunkel stand mit Frau Weyl vor der Haustür. Ullriegi stellte sich als ein Freund der abwesenden Frau Gulbran vor.
Der Winkelkonsulent katzbuckelte. „Große Ehre, Herr Doktor! Einen berühmten Schriftsteller wie Sie lernt man nicht alle Tage kennen. – Ob vielleicht der angebliche Baron zusammen mit Frau Gulbran verreist ist? Der Diener wird Ihnen wohl über den Mann Bescheid gesagt haben. Man hatte mich als Vertrauten der Polizei auf das Präsidium gebeten und mich um Beistand bei der Wiederergreifung Loharts ersucht, der von einem anderen früheren Zuchthäusler hier in Berlin vor einer Woche erkannt und „verpfiffen“ worden ist. Ich stehe mich mit der Polizei sehr gut. Sie weiß, was sie an mir hat. In meiner Rechtsauskunftei verkehren ja auch leider viel zweifelhafte Elemente. Man muß leben, Herr Doktor, – da darf man nicht wählerisch sein.“
„Welcher Kommissar bearbeitet diese Sache?“ fragte Ullriegi nach kurzem Nachdenken.
„Ankermann – der berühmte Ankermann.“
„Das trifft sich sehr gut – sehr,“ meinte Ullriegi aufatmend. Er kannte diesen Herrn persönlich. „Wollen Sie mich begleiten,“ fragte er Kunkel dann. „Sie sollen nicht um Ihre Belohnung kommen, nein! Sie haben auch mir einen Dienst erwiesen.“
Mehr erfuhr Kunkel nicht. Auch auf dem Polizeipräsidium mußte er im Flur bleiben, während Ullriegi mit Ankermann verhandelte, dem der Doktor in dieser Angelegenheit völlig reinen Wein einschenkte und dann bat, zu verhindern, daß der entsprungene Zuchthäusler Frau Gulbran irgendwie schaden könnte.
Der Kommissar erwiderte, die Freiheitsberaubung ließe sich den ganzen Umständen nach leicht vertuschen und, was Frau Gulbran anbeträfe, so könnte der Doktor ganz außer Sorge sein. Der angebliche Baron würde fortan nur mit Leuten in Berührung kommen, die zu schweigen wüßten, was er ihnen auch erzählte. –
Eine halbe Stunde darauf wurde Baron Löwengaart in aller Stille aus der Villa abgeholt und im Polizeigefängnis sicherer untergebracht. Seine Verhaftung kam ihm so überraschend, daß er vor Schreck seine sonstige Frechheit ganz vergaß und sich stumm abführen ließ. Er wußte, was ihm bevorstand. Einer der Aufseher, die er niedergeschlagen hatte, war an den Folgen der Schädelverletzung gestorben. Das kostete zum mindesten wieder eine lange Reihe von Jahren Zuchthaus …
Kunkel kam freudestrahlend nach Hause. Von den tausend Mark Belohnung, die auf die Wiederergreifung Loharts ausgesetzt waren, gebührte ihm gut die Hälfte. Das hatte auch der Kommissar Ankermann schon anerkannt. Triumphierend berichtete er Frau Rosa von dem glänzenden, mühelosen Geschäft.
„Erst hat er mir dreihundert Emchen für die Auskunft über die Vermögenslage der Gulbran bezahlt, nun gibt’s so etwa fünfhundert als netten Judaslohn, – fein, was, Rosa?“
Die üppige Frau Rat kniff die listigen Augen nachdenklich zusammen und sagte dann:
„Du wirst wirklich stets ein Schafskopf bleiben! Wäre ich nur mit in der Villa gewesen! Ich hätte gleich gemerkt, daß dieser alte Diener den Lohart doch offenbar dort gefangenhielt! Und hätte daraus weiter geschlossen, daß der feine Baron der Gulbran doch recht gefährlich sein müßte, wenn der Diener zu solchen Mitteln greift, um ihn unschädlich zu machen! Daran hast Du natürlich nicht im entferntesten gedacht! Was für ein besseres Geschäft wäre es geworden, wenn wir diese Sachlage schlau ausgenutzt und vorher noch die Gulbran um ein wenig Schweigegeld gebeten hätten, bevor wir Deinen hochadligen, schwedischen Duzfreund der Polizei auslieferten! Das wäre schlau gewesen! So aber …! Wieder nur was Halbes, wieder eine verpaßte Gelegenheit …! Du bleibst eben …, na, was – das weißt Du ja!“
11. Kapitel.
Nachmittags fuhr Doktor Ullriegi nach Müritz. Er wollte von Gundra Gulbran den Brief Agathes einfordern, dann aber auch feststellen, ob es lediglich ein Zufall wäre, daß Frau Gundra gerade das kleine Bad gewählt hatte, oder ob sie dort noch andere Zwecke verfolgte, die ihm vorläufig freilich ganz unklar waren, die aber doch vielleicht mit Dingen zusammenhingen, die er oft genug in stillen Stunden vor sich selbst als „seine Flecken von einst …“ bezeichnet hatte.
Der Zug war wenig besetzt, und Ullriegi blieb in seinem Abteil Erster allein. Nichts störte ihn also, seinen Gedanken nachzuhängen. Er fühlte sich müde und wie zerschlagen. Das Geräusch der unermüdlich rollenden Räder, die ganze Fülle gleichmäßigen Lärms des dahinjagenden Zuges bewirkte bei ihm eine Art Halbschlaf, in dem die wachen Gedanken wie von selbst hinübergleiten von diesem zu jenem, in dem lose Zusammenhänge von seltsamen Einfällen eine Brücke zu anderen, noch ferner liegenden Geschehnissen bilden.
Gundra hatte ihn geliebt … Und Gundra hatte Karl als Spion benutzt … Was mochte Karl, doch ein heller Kopf, wohl ermittelt haben, und – was sollte er überhaupt ermitteln …? – Ob etwa Gundra etwas von dem Geheimnis des Hauses Alsenstraße 16 geahnt hatte …? Und ob sie dann, nachdem sie einiges, nicht alles wohl, durch Karl festgestellt hatte, vielleicht Agathe lediglich zu dem Zweck das Ergebnis dieser Ermittlungen in seinen Andeutungen beigebracht hatte, damit es zwischen ihm, den sie durch diese Ehe zermürbt zu sehen fürchtete, und Agathe zum Bruche käme …?! Möglich war dies schon – sehr gut möglich! Eine Frau wie Gundra ließ sich durch Bedenken moralischer Art, die vielen in ähnlichem Falle wohl aufgestiegen wären, nicht beirren. Wenn sie Retterin spielen wollte, setzte sie sich auch hierfür ein, ohne Rücksicht auf sich selbst und das Urteil der Welt, das vielleicht laut werden konnte, genau so wie sie es auch bei ihrer Fürsorge für die entlassenen Zuchthäusler getan hatte. Jetzt erst kannte er sie ja, jetzt erst wußte er, weshalb diese seltene Frau stets selbst im großen Kreise einsam geblieben, weshalb man ihr gesuchte Eigenart und Herrschergelüste nachgesagt hatte – auch nachsagen konnte, da das Verständnis für ihre besondere Wesensart niemandem so leicht aufgehen konnte.
Er dachte nun plötzlich wieder an Heinz Lüder, den er heute mittag nach der Verhaftung des falschen Barons besucht und den er in aufgeräumtester Stimmung angetroffen hatte. Lüder hatte ihm nach der Begrüßung beide Hände auf die Achseln gelegt und gesagt: „Schau mich an – sehe ich nicht ganz anders als früher aus?“ – Das mußte er zugeben. – „Glücklich siehst Du aus, und Dein Bart ist gepflegter, die Krawatte neu und mal ausnahmsweise geschmackvoll.“ Worauf Lüder gelacht und laut gerufen hatte: „Alter Junge – verlobt habe ich mich – verlobt! Nun rate mal mit wem?“ – „Wenn’s Frau Mieze ist, hast Du die rechte erwählt.“ – „Sie ist’s – und Dir verdanke ich dieses Glück zum Teil. Hab’ Dank für Deinen weisen Rat: Sieh – das Gute liegt so nah! – Nein, nicht das Gute, – das Beste!“ – Dann kamen sie auf Frau Gundra zu sprechen. Und Lüder hatte, nachdem er ihm das, was der heutige Vormittag an Offenbarungen gebracht, anvertraut hatte, wieder in seiner bedächtigen, alle Dinge so ernst nehmenden Art gesagt: „Arme, arme Gundra! Wie bitter Unrecht taten wir Dir! Freilich: der Chor der Philister würde auch jetzt noch heulen: An’s Kreuz mit ihr, die sich anmaßte, eine Ehe zu zerstören, also etwas, das heilig bleiben muß, selbst wenn beide Sklaven dieses Ehejochs dabei langsam zugrunde gehen, – heilig, das heißt unantastbar, den Eingriffen anderer entrückt. – Und Du selbst nun, Manfred, – wie stellst Du Dich zu der Erkenntnis, daß sie Dich retten wollte?“ – Da hatte er mit der Antwort eine Weile gezögert und dann erklärt: „Ich sehe es ihr nach, daß sie in guter Absicht weit über die Grenzen des Zulässigen hinausgegangen ist, Heinz. Der Chor der Philister heult nicht ganz sinnlos … Ein Fernstehender vermag nie zu beurteilen, ob sich eine für die Außenwelt scheinbar gänzlich unmögliche Ehe nicht doch noch ins rechte Geleise bringen läßt.“ – Heinz Lüders Gesicht hatte auf diese Entgegnung hin einen Ausdruck halb ungläubigen Staunens angenommen. „So hoffst Du selbst also noch, daß …“ – Und da hatte er ihn unterbrochen: „Ein Menschenherz ist ein wunderlich Ding. Ich habe mich selbst in dem meinen nicht recht ausgekannt. Und die noch härtere Einsicht ist die, daß ich es wohl an der nötigen Geduld habe fehlen lassen, Agathe für mich allein zu erziehen. Ich bin zu hastig vorgegangen, die störenden Geister, die sie aus dem Patrizierhause mitgebracht hatte, auszuräuchern.“ – „Also liebst Du sie noch …?“ – Und da hatte er leise geantwortet: „Ich glaube ja …“ und war nach hastigem Händedruck gegangen.
Jetzt dachte er wieder über diese Antwort nach. „Ich glaube ja …“ Hatte er damit vorschnell etwas hingesprochen? – Er schaute abermals tief in sein Inneres. Was kettete ihn eigentlich so fest an Agathe, daß er trotz der nun einmal nicht wegzuleugnenden Enttäuschungen dieses Ehejahres sich doch einsam gefühlt hatte, als sie von ihm gegangen, – was nur, was? – Es war jetzt wieder ein Spüren und Graben in der Seele seines Weibes, das er vornahm, um in seinem eigenen Herzen Klarheit zu schaffen. Langsam kam er der Wahrheit nahe. Und diese Wahrheit entlastete auch die Frau Senator Rautensen beträchtlich, anerkannte ihre Erziehungsmethode in manchem, da nur diese wohl Agathe diesen Hauch von jungfräulicher Unberührtheit gegeben, den jeder in ihrer Nähe spüren mußte und der selbst der verheirateten Frau geblieben. Und neben dieser Reinheit der Seele waren es wohl auch die strenge Rechtlichkeit und die Lauterkeit in Wort und Tat gewesen, die Agathe gerade hier in Berlin inmitten einer zum Teil doch moralisch stark angekränkelten Menge von Frauen stets wie ein fremdes Wesen hatten erscheinen lassen, eben als etwas Besonderes, das gerade durch das unverrückbare Sichgleichbleiben in allem ihn gereizt hatte …
Und von diesen Gedanken kam er wieder auf den unterschlagenen Brief. Agathe hatte an ihn geschrieben, so sehr bald geschrieben … Alltägliches konnte der Brief nicht enthalten …! Wenn er ihn doch erst in Händen hätte …! –
Aber er mußte sich gedulden. Als er abends um ½9 in Müritz eintraf, regnete es. Ein schlechter Empfang. Wie trostlos da die Dorfstraße und die Häuschen wirkten …!
Er suchte nicht lange nach einem Quartier. Las das große Schild „Pension Parkschloß“ und nahm dort ein Zimmer. Wie stets auf Reisen trug er sich in das Fremdenbuch mit seinem Pseudonym Friedrich Ulli ein. Hätte er nur eine Seite zurückgeblättert, wäre ihm sicher der Name aufgefallen, den er hier niemals zu finden erwarten konnte. Aber er überflog nur das, was über der Zeile, die er selbst ausgefüllt hatte, stand.
Nachdem er auf seinem Zimmer schnell noch einen Imbiß eingenommen hatte, hing er die Lodenpelerine um und wanderte zum nahen Strande. Ein scharfer Nordost jagte Woge auf Woge gegen das Ufer; brüllend tobte die Brandung. Er stand über ihr auf dem hohen Seesteg und ließ den Wind sein mattes Gesicht mit scharfen Stößen peitschen; lauschte auf die Stimmen, die aus dem Brausen und Donnern der sich überstürzenden Wellen hervorzutönen schienen wie Schreien und Rufen kämpfender, ringender Menschen oder spielender Meerjungfrauen. Dann ging er langsam wieder durch den vom Winde geschüttelten Wald zurück, suchte in der Dunkelheit nach Pension Parkschloß, stutzte plötzlich, starrte empor zu einem Balkon, in dessen offener, erleuchteter Tür eine Frau einen Augenblick sichtbar geworden …
Nein – er mußte sich getäuscht haben! Wie sollte Agathe hierherkommen …?! Agathe war in Hamburg. Eine Ähnlichkeit hatte ihn genarrt … Hierher – und auch ins Parkschloß! Er mußte lächeln … Vielleicht war seine Sehnsucht nach ihr doch groß genug, sogar Sinnestäuschungen hervorzurufen …
Trotzdem stand er nun unten auf der anderen Seite der Straße, wo gleich der Tannenwald begann und schaute zu dem Balkon nach oben. Aber die Tür blieb geschlossen … Und nur ein Schatten glitt hin und wieder über den weißen Vorhang hin, als ob jemand dort im Zimmer ruhelos auf und ab wanderte.
Friedrich Ulli schlief schlecht in dieser Nacht; schlief Wand an Wand mit der, die er in Hamburg im Senatorhause vermutete.
12. Kapitel.
Agathe saß im Sande und spielte mit der kleinen Hildegard. Die Freundschaft mit dem blonden, liebreizenden Mädchen war bereits am Nachmittag desselben Tages geschlossen worden, an dem der dritte Strandkorb neben dem Stege aufgestellt wurde.
Die Strandkörbe selbst waren leer. Frau Gundra und Fräulein Nolte, die Tante Hildegards, benutzten stets die ersten Vormittagsstunden zum Baden.
Das Blondchen hielt die neue Tante Aga heute ordentlich in Atem. Es sollten mit Hilfe von Sandformen Kuchen gebacken werden, aber sie fielen für Hildchens Ansprüche nie schön genug aus. Stets zerstörte die Kleine sie wieder und sagte ganz ernsthaft: „Du mußt Dir mehr Mühe geben, Tante Aga. Wenn der Pappi kommt, müssen wir ihm doch zeigen, wie gut wir’s schon verstehen.“
Mit diesem Pappi war’s eine eigene Sache. Das hatte Agathe sehr bald gemerkt. Hildegard wußte nicht, wie er mit Vornamen hieß. Er war eben „der Pappi“. Und Fräulein Gusti Nolte wieder wich jeder Frage nach dem Schwager sehr geschickt aus. Jedenfalls führte er aber denselben Namen wie seine Schwägerin, denn das Mädelchen erklärte jedem, der es hören wollte: „Ich bin Hildegard Nolte. Und ich war lange, lange sehr krank, und der Pappi hat sich so sehr um mich geängstigt, sagt Tante Tapp.“
Als Agathe die Kleine gelegentlich gefragt hatte, wie sie denn eigentlich auf den Namen „Tante Tapp“ gekommen wäre, hatte Hildchen wichtig und ernst erwidert:
„Oh, die Tante heißt auch noch anders, nicht bloß Gusti, aber den anderen Namen konnte ich nicht behalten, nur etwas davon, ein Stück, und das ist „Tapp“.“ –
Hildegard kam jetzt gerade vom Ufer mit einem Eimerchen feuchten Sandes zurück.
„Tante Aga, nun aber fix neue Kuchen“, rief sie schon von weitem. „Ganz fix! Der Sand ist so schön naß …“
Plötzlich blieb sie dann wie angewurzelt stehen. Der Eimer entfiel ihrer Hand. Sie starrte geradeaus nach der Stelle hin, wo ein Plankensteg über die niedrige Vordüne führte.
„Der Pappi!“ Wie eine jubelnde Fanfare war’s. Und nun setzten sich flinke Beinchen in Bewegung, liefen an Agathe vorüber, die sich nicht gern nach dem Manne umsehen mochte, auf den sie ein wenig eifersüchtig war.
Doch – die Neugier siegte … Sie tat, als wollte sie sich in den Strandkorb setzen, erhob sich, wandte den Kopf, bog mit einem Male den Oberkörper weit vor, streckte die Arme wie abwehrend aus und starrte dann wie versteinert in dieser Stellung auf den Mann und das Kind, die sich da umschlungen hielten und für nichts anderes Augen hatten als füreinander, – auf den Mann, der Hildegard emporgehoben hatte an seine Brust und der sie küßte und dabei vor Glück und Wiedersehensfreude förmlich strahlte.
Dann aber ein helles Stimmchen …
„Pappi, eine neue, liebe Tante, – die Tante Aga, – komm’ zu ihr …“
Da sah auch er die regungslose Gestalt, fuhr zurück, errötete, drückte Hildegard noch fester an sich, als müßte er sie schützen vor irgend etwas, und trug sie vorwärts auf Agathe zu.
Die fand nun endlich Worte, fragte halb unbewußt:
„Dein … Dein Kind, Manfred?“ Und er nickte stolz, wenn auch etwas verlegen, – mit trotzigem Stolz …
„Mein Kind, Agathe, – mein Kind, das in den letzten Wochen, schwer erkrankt, zwischen Leben und Tod schwebte, das ich in der Alsenstraße täglich besuchte …“
Agathes Gedanken griffen sofort voll jäh aufflammender Eifersucht etwas anderes auf.
„Und – und die Mutter …“
Da setzte er Hilde in den Sand, gab ihr ein paar Geldstücke …
„Lauf’, Madli, hol’ Dir aus dem nächsten Automaten was Süßes …“
So brachte er sie fort. Stand nun seiner Frau gegenüber, sagte leise:
„Die Mutter ist tot, Agathe. Ich habe sie einst sehr geliebt. Aber sie war nur eine Künstlerin vom Varietee gleich ihrer Schwester, die Du vielleicht in der Alsenstraße am Fenster gesehen …“
Agathe schüttelte langsam, geistesabwesend den Kopf …
„Nicht ich, Karl, unser Diener …“ Und da fiel ihr ein, daß Karl ihr Beauftragter gewesen, daß er hatte helfen sollen, ihres Gatten geheime Wege aufzuspüren. Auch sie errötete nun …
Da sprach der Mann schon weiter …: „Niemand wußte von dieser Liebe, oder doch nur ganz wenige, – die Schwester, die Schmiedecke … Und als Hildegards Geburt der blonden Irmela Olten, oder Irmela Nolte im bürgerlichen Leben, den Würger Tod ans Bett brachte, als man zu mir schickte, da sie mir Lebewohl sagen und mich anflehen wollte, sie noch zu meinem ehelichen Weibe zu machen, bevor sie starb, kam ich um Minuten zu spät, sonst hieße mein blondes Madli heute Hildegard Ullriegi … – Das, Agathe, ist mein Geheimnis …“ Er schaute sie an und forschte in ihren Zügen. Und sie fuhr sich nun mit der Hand über die Augen, als wollte sie etwas völlig beseitigen, das wie ein schlechtes Linsenpaar ihr die Dinge in häßlicher Verzerrung gezeigt hatte. Diese Augen füllten sich langsam mit Tränen. Ach – es war so schwer, sich damit abzufinden, daß er ein Weib vor ihr so geliebt hatte, daß diese Irmela ihm einen Teil ihres Ichs in Gestalt eines Kindes zurückgelassen hatte …! Aber – dieses Kind war Hildegard, war dasselbe blonde Mädelchen, das sie sofort geliebt, zu dem sie sich in seltsamer Zuneigung hingezogen gefühlt hatte …
Da sagte sie tapfer und streckte ihm die Hand hin:
„Ich liebe Dein Kind, Manfred. Und wenn Du willst, soll es fortan das unsrige sein …“
„Agathe …?!“ rief er da, „Agathe – Du könntest wirklich …? Oh, das ist ja mein geheimer Wunsch seit langem gewesen! Agathe, nun wird alles – alles gut werden zwischen uns …“
„Wir haben eines dem andern viel nachzusehen, Manfred! – Setzen wir uns dort in den Strandkorb, sprechen wir uns aus …“
Und jetzt erfuhr er auch, was der Eilbrief enthalten hatte, erfuhr sie, weshalb keine Antwort darauf gekommen … Hand in Hand, dicht beieinander, wiederholten sie hier nun das Gelöbnis treuer Liebe, nachdem alles fortgeräumt war, was zwischen ihnen gestanden hatte als Scheidewand von Unduldsamkeit, erkünstelter Kälte und allzu dringlichem Begehren.
Die Küsse, die sie jetzt tauschten, waren wie erfüllt von dankbarer Andacht, waren die ersten Zärtlichkeiten der neuen Zeit.
Dann kehrte Hildegard zurück. Manfred nahm sie auf den Schoß …
„Hier, Madli, schenke ich Dir eine neue Mama. Magst Du sie haben, wirst Du recht lieb zu ihr sein …?“
„Oh, Pappi, – sehr, sehr lieb …!“ Und sie umschlang Agathes Hals und schmiegte sich an sie … –
Madli spielte im Sande mit den Kuchenformen. Im Strandkorb sprachen Madlis Eltern über Gundra Gulbran.
„Jetzt erst begreife ich sie ganz – jetzt erst!“ sagte Manfred sinnend. „Sie hat ein ganzes Komplott geschmiedet, nicht um uns zu trennen, sondern damit wir uns fest für immer zueinander finden sollten … So muß es sein! Wir werden sie ja selbst darüber hören.“
Und Agathe meinte dazu: „Sie ist so von Herzen gut …“
„Und hat so unsagbar Schweres durchgemacht“, ergänzte er. „Etwas, das wir uns kaum ausdenken können! Dunkle Flecken lagern auf den Bildern ihrer Vergangenheit. Mit kaum achtzehn Jahren beteiligte sie sich, schon damals wohl geistig über ihr Alter weit hinausragend und verführt durch einen gewissenlosen Stiefvater, der ihren Hang für Luxus und Wohlleben schlau zu steigern wußte, an großangelegten Schwindeleien, bei denen sie später, als die Gerichte sich mit der Sache beschäftigten, als eine der Hauptschuldigen erschien und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde …“
„Mein Gott!“ entfuhr es Agathe entsetzt.
„Ja – zwei Jahre! – Und wieder zwei Jahre später, nach Verbüßung ihrer Strafe, hatte die Mitleidslosigkeit der Menschen, die der Vorbestraften jede Möglichkeit zu ehrlichem Erwerbe verschlossen, sie bis zur Blumenverkäuferin in Hamburgs übelberüchtigsten Nachtlokalen herabsinken lassen, wo sie unter dem Namen „die stolze Gudrun“ als völlig unnahbar bekannt und fast berühmt war. Dort lernte sie ihr späterer Gatte kennen, von dort nahm er sie mit sich in sein Berliner Heim. Und er hat es nie bereut, die einmal Gestrauchelte zu sich emporgehoben zu haben. Sie war ihm ein treues, aufopferndes Weib, mehr noch, sie machte sein Haus zu einer Stätte geistiger und künstlerischer Anregung, verstand es, erste Gelehrte und Künstler herbeizuziehen und in diesem Kreise die Rolle der schöngeistigen Frau zu spielen, ohne sich irgendwie vorzudrängen. – Dies alles habe ich zum Teil von dem Kriminalkommissar Ankermann erfahren, zum Teil handelt es sich um allgemein bekannte Tatsachen. Auch als Witwe wußte Gundra Gulbran ihre Stellung in der Gesellschaft zu behaupten, betätigte sich heimlich aber noch auf einem anderen Gebiet, – dem der Fürsorge für strafentlassene Gefangene …“
Nachdem Manfred auch diesen so sehr für Gundras vortrefflichen Charakter sprechenden Herzenszug genügend gewürdigt hatte, berichtete er all das, was über den falschen Baron Löwengaart zu seiner Kenntnis gelangt war.
Agathe hörte voller Interesse und Teilnahme zu. Als er nun schwieg, drückte sie zärtlich seine Hand und begann ihrerseits zu beichten; besonders eingehend ließ sie sich über den Diener Karl aus, der, wie jetzt feststand, auch Gundra Gulbran gleichzeitig mit Nachrichten über Ullriegi versorgt hatte. Bevor Agathe jedoch mit ihren Bekenntnissen und den wiederholten Beteuerungen ihrer tiefen Reue über diese ihrer ganzen Natur widersprechenden Beziehungen zu einem Bedienten zu Ende gekommen war, erschienen Gundra und Gustava Olten, von Hildegard schon von weitem mit dem Jubelrufe begrüßt: „Die Tante Aga wird meine liebe Mammi …! Dort – dort sitzt sie mit dem Pappi – und sie küssen sich gerade …“
Nachdem die vier Menschen, die sämtlich von des Lebens bitterem Ernst und Schattenseiten genugsam gesehen, etwas verlegen die ersten Begrüßungsworte ausgetauscht hatten, setzten sich Gustava und Gundra in den zweiten Strandkorb, und letztere war es dann, die ohne Scheu sofort das Gespräch auf das brachte, was ihr nur zu leicht hätte als heimtückisches Intrigenspiel ausgelegt werden können.
„Ich weiß nur zu gut“, leitete sie diese Verteidigung ihres Verhaltens ein, „daß man in unserem Verkehrskreis in Berlin mich geradezu eines stark ausgeprägten Herrschgelüstes bezichtigt. Man begreift nicht, wie ich manchem Kunstjünger, der mit übertriebenen Vorstellungen von seinem Können mich um meine Fürsprache bei einflußreichen Leuten bat, offenbar das Weiterkommen geradezu erschweren konnte, anstatt diese Strebsamen zu fördern. Nun – stets hat es sich dann um Menschen gehandelt, die es in dem erwählten Berufe nicht einmal bis zu mittelmäßigen Leistungen gebracht hätten, die unglücklich geworden wären, wenn sie zu spät erkannt hätten, wo ihre wahren Fähigkeiten lagen. Ich stiftete nur ein gutes Werk damit, ihnen Steine in den Weg zu rollen und sie zu zwingen, einen anderen Beruf zu ergreifen. Nicht das Streben, Schicksalsgöttin zu spielen, hat mein Tun und Lassen in dieser Beziehung geleitet, sondern lediglich der Wunsch, diese Einsichtslosen vor Unheil zu bewahren. Ähnlich verhält es sich auch mit alledem, was ich unternahm, um die Ehe zweier Menschen vor einem völligen Zusammenbruch zu bewahren. Leider hat dann der Diener Karl, den ich für meine Zwecke benutzte, gegen meinen Willen Ihnen, liebe Agathe, auch zugetragen, was geheim bleiben sollte: daß bei der braven Frau Schmiedecke eine junge Dame wohnte, an deren Zimmerfenster unser Doktor hier verschiedentlich auftauchte. – Meine Absicht war folgende. Ich wußte, daß Sie, lieber Ullriegi, in der kleinen Hildegard ein Andenken an eine geliebte Tote zurückbehalten hatten, das Ihnen überaus teuer war. Daß es ein blondes Madli gab, erfuhr ich selbst erst vor ungefähr sechs Wochen durch einen Zufall. Dann beauftragte ich den Diener Karl damit, festzustellen, wie Ihr Verhältnis zu dem Kinde war. Bald erkannte ich, daß Sie die Kleine über alles liebten. Ich habe dann mit Gustava – unsere Bekanntschaft ist bereits gut drei Wochen alt – so manches Mal beratschlagt, ob es nicht möglich wäre, Agathe auf irgend eine Weise zu bestimmen, Hildegard in ihr Haus als eigenes Kind aufzunehmen, denn dies war ja unseres Doktors heißester Wunsch, wie er Gustava gegenüber häufig durchblicken ließ. Wir mußten jedoch, um Agathe nicht gegen die Kleine womöglich einzunehmen, sehr vorsichtig zu Werke gehen. Daher sollte Karl auch ihre Aufmerksamkeit auf das Haus in der Alsenstraße lenken, in das leider damals gerade Sorge und Angst eingezogen waren, da Hilde an einer bösen Lungenentzündung erkrankte. Wir rechneten damit, daß Agathe doch sehr wahrscheinlich selbst einmal feststellen würde, wem ihres Gatten häufige Besuche in jenem Hause galten, hatten Frau Schmiedecke mit ins Vertrauen gezogen, die Ihnen, liebe Aga, dann Hildchen zunächst als Ihres Mannes Mündel vorstellen sollte, und hofften auf das, was dann ja auch hier in Müritz eingetreten ist: auf eine schnell aufkeimende Zuneigung für die reizende Kleine. Der Diener Karl aber, ein heimtückischer, schadenfroher Mensch, wie ich zu spät einsehen mußte, verstand es, Ihre Eifersucht durch die Erwähnung Gustavas zu erregen und ständig zu vergrößern, bis es zwischen Ihnen und Ihrem Gatten dann zum Bruch kam. An demselben Abend, als mir Karl Mühling Ihre plötzliche Abreise mitteilte, mußte ich auch, um einem elenden Erpresser zunächst zu entgehen, mich gleichfalls zum Verlassen Berlins entschließen, befahl dem Diener, auf alles, was weiter im Hause seines Herrn geschah, zu achten und Frau Weyl, meiner Vertrauten, darüber zu berichten, und war auch mit mir einig geworden, Ihnen, liebe Aga, von Warnemünde aus, also bevor ich das Trajektschiff nach Dänemark benutzte, in einem ausführlichen Brief genau zu schildern, welche Rolle ich bei dem Zerwürfnis mit Ihrem Manne gespielt hätte und was meine wahren Absichten gewesen wären. Ich traute es mir sehr wohl zu, schriftlich auf Sie so weit einwirken zu können, daß Sie bei Ihrer großen Liebe zu Ihrem Gatten und wenn Sie Hildegard erst gesehen hätten, schnell zur Versöhnung sich bereitfinden würden. Einen ähnlichen Brief sollte unser Doktor erhalten. – Alles kam anders. Ich sah Sie unterwegs, folgte Ihnen nach Müritz, bestellte Gustava mit der inzwischen wiedergenesenen Kleinen hierher und behielt dann auch Ihren an Ihren Gatten gerichteten Eilbrief weiter zurück, damit Sie erst Zeit fänden, unser Madli näher kennenzulernen, bevor unser Doktor Sie wiedersah. Ja, es war ein richtiges Komplott, das wir, Gustava und ich, geschmiedet hatten, und ich bin der Vorsehung von Herzen dankbar, daß nun doch meine guten Absichten nicht zu Schanden geworden sind. Ich habe aber anderseits auch durch diese letzten Ereignisse die Einsicht gewonnen, wie gefährlich es ist, so ein wenig dem Schicksalsrade in die Speichen zu greifen. Zum Besten der Menschheit möchte ich mich weiter betätigen. Aber jetzt in anderer Weise. Soeben erst ist mir der Gedanke gekommen, irgendwo an der Ostseeküste ein Kindererholungsheim zu gründen und dann auch zu leiten. So schaffe ich mir einen Wirkungskreis, der mich voll befriedigen wird. Berlin wird mich nur noch, mich die so großstadtmüde geworden, wiedersehen, um dort meinen Hausstand aufzulösen. Dies ist mein fester Entschluß. – Was meinen Sie dazu, liebe Gustava, wenn Sie mir helfen wollten, den Kindern der Armen eine Stätte zu bereiten, wo sie, umgeben von Liebe und Fürsorge, erkennen lernen, daß auch die Reichen für sie ein warmes, mitfühlendes Herz haben? Wollen Sie, Gustava?“
„Oh, Frau Gulbran, liebe Frau Gundra, – ob ich will? – Nur zu gern!“ rief die blonde Gustava mit leuchtenden Augen. „Jetzt wo unser Madli ein Elternhaus gefunden, bin ich selbst ja so überflüssig geworden.“
Auch Agathe streckte Gundra jetzt, sich schnell erhebend, beide Hände hin.
„Wie gut Sie sind,“ sagte sie in tiefer Ergriffenheit. „Und wie danke ich Ihnen, daß es Ihnen gelungen ist, mir jetzt ein ungetrübtes Glück zu schaffen.“
Über Gundra Gulbrans Gesicht flog der Schein eines eigenen Lächelns hin, – eines Lächelns, halb schwermütig, halb herzensfroh. Und sie flüsterte leise, daß nur Agathe sie verstehen konnte, die sie nun zärtlich an sich zog:
„Danken Sie mir dadurch, daß Sie den Mann glücklich machen, den auch andere geliebt haben und der gerade Sie zu seiner Lebensgefährtin erkor. – Ja, machen Sie ihn glücklich. Aga, – restlos glücklich!“
„Das will ich!“ Und diese Worte waren wie ein feierlicher Schwur.
Ende.
Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin S. 14.
Verlagswerbung:
|
Vergißmeinnicht-Bibliothek. Bisher sind folgende Bände erschienen: |
|
|
|
|
Verlag moderner Lektüre Gelbsternbücher. |
|
Band 1: Die Lahore-Vase Band 2: Der hüpfende Teufel Band 3: Der Tempel der Liebe Band 4: Das Haus am Mühlengraben Band 5: Der Mutter Name |
|
Preis pro Band 1 Mark und 25 Pf. Teuerungs-Zuschlag Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie vom Verlag |
Anmerkungen:
- ↑ In der Vorlage steht: „Somowars“.
- ↑ In der Vorlage steht: „bließ“.
- ↑ In der Vorlage steht: „noch“.
- ↑ In der Vorlage steht: „der“.
- ↑ In der Vorlage steht: „suchen“.
- ↑ In der Vorlage steht: „glaurbte“.
- ↑ In der Vorlage steht: „ans“.
- ↑ In der Vorlage steht: „bloßstellenden“.
- ↑ In der Vorlage steht: „fürchte“.
