Hauptmenü
Sie sind hier
Die grüne Wand
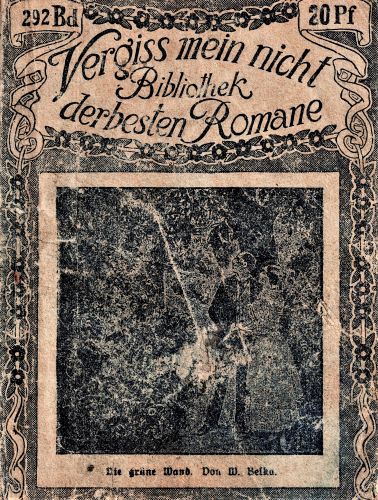
Vergiß mein nicht
Bibliothek der besten Romane
Band 292
Die grüne Wand.
Roman von
W. Belka.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.
Dresdenerstraße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.
1. Kapitel.
„So, und nun will ich dir den Garten zeigen, Edgar.“
Traude Karsten schob den schweren Eichenstuhl etwas zurück und erhob sich.
Nein – sie wollte sich erheben.
Fräulein Berta Karsten, die der jungen Schwägerin gegenüber an dem reichgedeckten Speisetische saß, hatte nämlich mit einem „Bitte – einen Augenblick noch!“ den Arm wie befehlend ausgestreckt.
Traude ließ sich wieder in ihren Stuhl zurücksinken, und Berta Karsten fügte salbungsvoll hinzu:
„Wir wollen doch, auch wenn wir Gäste zu Tisch haben, nicht die schöne Sitte des Schlußgebets unterlassen, liebe Gertraud. Du scheinst infolge der Freude über das Wiedersehen mit deinem Bruder unsere althergebrachte Hausordnung gänzlich zu vergessen, was ich allerdings verzeihlich finde.“
Dann faltete sie die mageren Hände, senkte demutsvoll den Kopf und sprach ein längeres Gebet.
Edgar und Traude tauschten einen schnellen Blick aus. Der sonnegebräunte Oberleutnant lächelte sogar ein wenig spöttisch, während seine Schwester nur die Achseln zuckte. Sie wußten eben, daß die Frömmigkeit Bertas nur rein äußerlich war.
Um aber die scheinheilige alte Jungfer nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen, hatten die Geschwister gleichfalls die Hände gefaltet.
Das Tischgebet war zu Ende.
Aber mit der Besichtigung des Gartens schien es auch jetzt nichts werden zu wollen.
„Max wird es sehr vermissen, wenn du ihm nicht wie sonst auch noch eine halbe Stunde nach der Mittagsmahlzeit etwas vorliest,“ sagte das magere Fräulein Karsten, indem sie nach der von der Gaskrone herabhängenden Birne der elektrischen Klingel griff. „Ich bin sehr gern bereit, deinen lieben Bruder durch den Garten zu führen. Mich rufen ja keine Pflichten zu einem kranken Gatten.“
Der hochgewachsene Offizier wäre am liebsten grob geworden. Nein, – Traude hatte in den wenigen Briefen, die sie ihm in die Einsamkeit seiner westafrikanischen kleinen Garnison geschickt hatte, wirklich nicht übertrieben. Diese Schwägerin war ein richtiges spitzzüngiges Scheusal.
Doch Edgar Presterloh beherrschte sich und sagte nur mit einer leichten Verbeugung zu Fräulein Karsten:
„Wir, Traude und ich, haben uns zwei lange Jahre nicht gesehen, gnädiges Fräulein. Da ist es wohl verständlich, daß wir recht bald uns gegenseitig die Herzen ausschütten wollen. Mein Schwager wird ohne Frage gern heute auf die übliche halbe Stunde vorlesen verzichten.“
Berta Karsten lächelte säuerlich.
„Gewiß, Herr Graf, gewiß. Aber – er ist ein Kranker, einer, den Gott in seiner Unerforschlichkeit schwer heimgesucht hat und dem wir alle Rücksichten schuldig sein dürften, die …“
„… auch ihre Grenzen haben,“ vollendete Presterloh beinahe unhöflich.
Dann schob er seinen Arm in den Traudes und verließ mit ihr das prunkvoll ausgestattete Speisezimmer.
Berta Karsten schaute den beiden schönen Gestalten mit giftigen Blicken nach.
„Flegel!“ murmelte sie vernehmlich vor sich hin. „Anmaßendes Bettelvolk …! Und in eine solche Familie hat Max hineingeheiratet …!!“
Die Geschwister waren inzwischen über die im hellen Mittagssonnenschein daliegende Terrasse in den langgestreckten Garten gelangt, der sich hinter der Villa ein Stück in die noch unbebauten, aber bereits von asphaltierten Straßen durchzogenen früheren Felder hinein erstreckte.
Kaum hatte ein dichtes Fliedergebüsch, das gerade in voller Blüte stand und die Luft weithin mit zarten Düften erfüllte, die beiden gegen Sicht vom Hause her gedeckt, als Edgar auch schon stehen blieb, beide Hände Traudes ergriff, einen Schritt zurücktrat und seine einzige Schwester von oben bis unten prüfend musterte.
„Mein armes Hascherl, glücklich siehst du gerade nicht aus!“ sagte er mitleidig.
Dann zog er sie an sich und küßte sie auf die Stirn.
„Endlich allein!“ seufzte er darauf wie befreit. „Diese Berta ist ja wie Fliegenleim! Sie klebte an uns fest und war nicht abzuwimmeln – gräßlich! Diese zwei Stunden in ihrer Gesellschaft waren gerade kein Vorgeschmack der Seligkeit, weiß der liebe Himmel! Kein vernünftiges Wort konnte man miteinander sprechen! Kein Wunder, daß mir vorhin der dicke Geduldsfaden riß. – Hier wird es ja wohl irgend ein stilles Plätzchen geben, wo wir ungestört sind.“
„Oh ja, Edgar, das gibt es schon. Ich werde dich führen. – Sag’, – ist dieser Garten nicht wunderhübsch?! Vermutet man ein solches kleines Paradies hier draußen zwischen den sandigen Bauterrains?! – Wohl kaum! – Ach, Edgar, wenn ich diese grünen Bäume, die Blumen und die Erinnerung an dich nicht gehabt hätte, ich wäre hier umgekommen, dahingewelkt …!“
Presterloh hatte den rechten Arm um ihre Schulter gelegt, und so gingen sie eng aneinandergeschmiegt über die sauber gepflegten Wege, bis sie eine von kurz geschnittenen Buchen gebildete, halbkreisförmige Laube erreicht hatten, in der bequeme Gartenmöbel aus Bambusrohr, ein Tisch und drei Stühle standen.
Sie setzten sich an eine Tischecke, um sich recht nahe zu sein. Presterloh holte sein Zigarettenetui hervor und hielt es zunächst Traude hin. Aber die schüttelte den Kopf.
„Berta könnte kommen …!“ meinte sie zögernd. „Sie würde es gleich meinem Manne weiter erzählen, daß ich wieder … in das alte Laster zurückgefallen bin. Bei der Familie Karsten stehen Damen, die rauchen, etwa auf einer Stufe mit Raubmördern.“
Edgar klopfte die Schwester leicht auf die Schulter.
„Brav so, Kleines! Nur nicht den Humor verlieren! Raubmörder ist gut gesagt! Im übrigen aber, – hier, los! – zünde dir eine Zigarette an! So lange ich hier bin, werde ich schon dafür sorgen, daß die magere Berta dich in Ruhe läßt!“
Die Zigaretten glimmten. Schweigend genossen die Geschwister die ersten Züge.
Dann sagte Presterloh:
„Kind, – war’s denn wirklich nötig, daß du Karsten heiratetest?! Wußtest du keinen anderen Ausweg mehr?“
Traude schüttelte den Kopf.
„Du ahnst nicht, was es heißt, sich als Erzieherin in reichgewordenen bürgerlichen Familien herumstoßen zu lassen! Und eine Stellung bei unseresgleichen anzunehmen, – nein, da sträubte sich doch der angeborene Stolz dagegen. – Jedenfalls hatte ich all die kleinen Demütigungen, all die Widerwärtigkeiten meines aus Not selbstgewählten Berufes so satt, daß ich wie eine Ertrinkende zugriff, als Karsten um mich anhielt.“
Edgar blickte die Schwester wieder so prüfend an.
„Und gerade am Hochzeitstage bekam er dann den schweren Schlaganfall?“ fragte er leise.
„Während der Tafel. Es war furchtbar. Nie werde ich das Bild vergessen, wie er plötzlich, als er gerade mit einem Gast anstieß, vornüber auf den Tisch fiel – mit dem Gesicht in die Sektschalen hinein, deren Scherben ihm die Haut tief zerschnitten.“
Wie ein Frostschauer ging es über ihren Leib hin.
Da nahm Presterloh der Schwester Rechte zwischen seine beiden Hände und bat:
„Rege dich nicht auf, Kleines. – Sprechen wir von etwas anderem. – Ich bleibe also zunächst vier Wochen in Berlin. Ich muß mal wieder Großstadttreiben genießen. Dann gehe ich nach Rauheim und werde eine Brunnenkur durchmachen. Auf höheren ärztlichen Befehl! Im Herbste bin ich dann wieder hier.“
„Und dann ist dein sechsmonatiger Urlaub auch bald um, dann gehst du wieder fort und …“
Zwei Tränen fielen auf des langen Oberleutnants schmale, muskulöse Hand.
„Kleines – nicht weinen!“ meinte er innig. „Wie wär’s, wenn ich deinen Mann bitten würde, daß ihr mit nach Rauheim kommt? Dann hätten wir uns jeden Tag …“
Traude seufzte.
„Mein Mann wäre vielleicht dazu zu bewegen. Aber Berta …“
„Schon wieder dieses Scheusal – pardon –, aber sie ist wirklich ein Scheusal! Spielt die denn hier im Hause derart die erste Flöte, daß alles nach ihrem Willen tanzen muß?! – Zum Henker, Kleines, – ich würde an deiner Stelle mal recht energisch ihr gegenüber werden! Du warst doch früher ein ganz resolutes Persönchen! Außerdem – du bist die Hausfrau!!“
Traude lachte bitter auf.
„Früher – früher! – Man ändert sich halt. Ich habe in diesem halben Jahre meiner Ehe einsehen gelernt, daß sie mir überlegen ist. Es gibt eben Frauen, die ein ausgesprochenes Talent dazu besitzen, andere zu beherrschen. Gegen Berta ist nicht aufzukommen, oder aber – man müßte mit denselben Mitteln arbeiten wie sie.“
Der Oberleutnant, dem jeder sofort trotz des allerdings tadellos sitzenden Zivilanzuges den Offizier ansehen mußte, hatte schon vorher einige Male aufgehorcht. Jetzt fragte er etwas nervös:
„Was ist das eigentlich für ein ewiges Klopfen und Hämmern?! Eine Schlosserei oder eine Schmiede gibt es doch hier draußen bei euch wohl kaum.“
Traude beugte sich vor und zeigte mit der Linken auf eine hohe, grüne Wand von wildem Wein, die den Abschluß des Gartens bildete.
„Das da ist die Rückseite einer alten Scheune, eines Überrestes aus jener Zeit, wo man hier noch armseligen Roggen erntete. Die Scheune ist zum Teil zu Wohnungen umgebaut. Eine Gärtnerfamilie und noch ein paar Leute hausen dort hinter der grünen Wand, von denen ich jedoch nie etwas sehe; nur allerlei Geräusche verraten mir, daß so in unserer nächsten Nähe Menschen wohnen. Zu diesen Geräuschen gehört auch das Hämmern und Klopfen. Ein Erfinder soll es sein, der an irgend einem Modell hier in der Einsamkeit arbeitet. Früher, bevor mein Mann dieses Grundstück erwarb, gingen auch Fenster nach dieser Seite hinaus. Aber Max Karsten kaufte den zu der Villa gehörenden Grund und Boden dem Besitzer der Riesenscheune nur unter der Bedingung ab, daß die Fenster entfernt würden. Er wollte nicht, daß so und so viele neugierige Augen der Scheunenbewohner ihn ständig beobachten konnten. So wurden die Fenster vernagelt, und der wilde Wein überrankte schnell die Stellen, wo sie sich einst befunden hatten. – Für mich hat diese grüne Wand etwas Poetisches, leise Geheimnisvolles an sich. – Einmal, weil ich weiß, daß es dahinter Leute gibt, die ich nie zu Gesicht bekomme und die meine Phantasie daher vielleicht mehr beschäftigen, als sie es wert sind. Ich stelle mir diese Menschen sämtlich als Originale vor – wahrscheinlich sehr überflüssiger Weise. Dann aber hat zweitens auch die jetzt in leuchtendem Grün schimmernde Wand selbst etwas Merkwürdiges an sich. Als ich vor einem halben Jahre als Gattin Max Karstens hier meinen Einzug hielt, war es Herbst. Da leuchtete die Wand in prächtigen rotbraunen Farben. Die Blätter des wilden Weines hatte die Jahreszeit entsprechend verfärbt. Und im Winter wieder sieht sie, völlig der Blätter beraubt, mit ihrem Rankengewirr wie ein riesiges, aufgespanntes Netz aus, das den Garten absperrt. Und schließlich – wenn du gegen Abend zu ihr hinwanderst, dann scheint sie lebendig geworden zu sein. Unzählige Sperlinge nisten in der warmen Jahreszeit unter ihrem Blattgewirr, flattern hin und her und erfüllen die Luft weithin mit ihrem Gezwitscher. Siehst du, Edgar, – aus all diesen Gründen liebe ich meine grüne Wand. Sie regt meine Phantasie an, sie verleitet mich zum Träumen. Und ich träume noch ebenso gern wie früher, als wir noch unser Stammgut besaßen und das alte Schloß mit seinen winkligen Gängen und den vielen, vielen Zimmern, die zumeist nur von Mäusen bewohnt wurden.“
Der Oberleutnant preßte die Lippen wie in plötzlichem körperlichen Schmerz zusammen. Daß das Stammgut damals vor vier Jahren notgedrungen verkauft werden mußte, hatte er noch immer nicht verwunden, – damals, als es sich nach dem kurz hintereinander erfolgten Tode seiner Eltern herausstelle, daß die beiden letzten Presterlohs nichts mehr ihr eigen nannten, nichts mehr – nur den alten Namen und die den Vermögensverhältnissen in keiner Weise entsprechenden, durch falsche Erziehung ihnen eingeimpften Standesvorurteile.
Nun – das Leben mit seinem harten Daseinskampf, in dem heutzutage der Name, selbst der noch so uralter Geschlechter, nichts mehr gilt, vielmehr lediglich die Persönlichkeit des einzelnen als solche bewertet wird, hatte den Geschwistern schnell klar gemacht, daß es dringend nötig war, schleunigst den Ballast alter Überlieferungen als hinderliche Last über Bord zu werfen. So war Edgar, um sparen und seine Schulden bezahlen zu können, in die Schutztruppe eingetreten, während die Komtesse Traude Presterloh, bald als schlichte Traude Presterloh, sich nach einer Stelle als Erzieherin umsah, bis sie dann diese stete Abhängigkeit gegen einen vergoldeten Käfig halb aus Verzweiflung vertauschte, – gegen einen Käfig, in dem sie mit einem häßlichen, zänkischen und listigen Geschöpf, mit ihrer Schwägerin Berta, zusammenzuleben, gezwungen war.
2. Kapitel.
Berta Karsten hatte zunächst noch im Speisezimmer das Abräumen durch das Stubenmädchen überwacht und war dann hinüber in die drei nach der Straße hinaus gelegenen Räume gegangen, die ihr Bruder unter der steten Obhut eines Krankenpflegers bewohnte.
Der frühere Großkaufmann, der notgedrungen nach dem schweren Schlaganfall, durch den er völlig gelähmt worden war, aus der uralten Berliner Holzfirma Karsten & Petersen hatte ausscheiden müssen, saß, durch Kissen gestützt, in seinem fahrbaren Stuhl am Fenster der zu seinem Wohnzimmer gehörigen Veranda und schaute seine um einige Jahre jüngere, einzige Schwester jetzt fragend an, als sie einen leichten Korbsessel herbeizog und sich neben ihn setzte.
Max Karsten stand Mitte der Vierziger, hatte ein etwas nichtssagendes, von einem graumelierten Bart umrahmtes Gesicht, in dem die dunklen, großen Augen das anziehendste waren. Ein Ausdruck von Güte und stiller Ergebung in sein Schicksal lag zumeist in ihnen. Vielleicht war seine Krankheit, die ihm für Monate sogar die Sprache geraubt hatte, der Grund, weswegen diese Augen auch jede andere Seelenregung des bedauernswerten Mannes so deutlich wiederspiegelten. Mittlerweile hatte sich ja die Lähmung etwas gegeben, aber trotzdem vermochte er nur mit Anstrengung längere Sätze zusammenzufügen.
„Wo … ist … meine … Frau?“ sagte er jetzt, nachdem Berta den Pfleger durch einen Wink hinausgeschickt hatte.
„Mit ihrem Bruder im Garten. Der Besuch des Oberleutnants hat ihr Pflichtbewußtsein völlig ausgelöscht. Obwohl ich sie daran erinnerte, wie gern du dir nach Tisch etwas von ihr vorlesen läßt, zog sie es doch vor, dem Grafen den Garten zu zeigen, was doch auch später hätte geschehen können.“
Karsten erwiderte nichts. Nur den Kopf wandte er zur Seite und blickte auf die Straße hinaus, hinweg über die Drahtzäune, die die einzelnen Bauterrains einschlossen, in die Ferne, wo sich das Häusermeer Berlins mit scharfen Umrissen gegen den blauen Himmel abzeichnete.
Seine Schwester beobachtete ihn unausgesetzt. In ihrem schwarzen Tuchkleide, das sie stets trug und das ihre dürre Figur noch magerer erscheinen ließ, sah sie wie die ernste, weltfremde Priorin eines Nonnenklosters aus. Ihr blasses, faltiges Gesicht, die schmalen Lippen und die stets von den Lidern halb bedeckten Augen, besonders aber ein Zug von unnachsichtiger Strenge um den Mund gaben ihr ein Etwas, das von vornherein kalt wirkte und jede Vertraulichkeit ausschloß.
„Jedenfalls hätte sie dir doch gesegnete Mahlzeit wünschen müssen,“ fuhr sie hartnäckig fort, um den Bruder möglichst gegen die Frau aufzustacheln. „Aber sie dachte auch nicht im entferntesten daran – bewahre! Wo wird sie auch! Das ist der Dank dafür, daß du sie in diese behagliche Umgebung versetzt hast, daß sie jetzt aller Sorgen bar und ledig ist und sich jeden Wunsch erfüllen kann, da du ihr gegenüber in dieser Beziehung nur zu nachgiebig bist.“
Der Kranke drehte schwerfällig den Kopf nach der neben ihm Sitzenden hin. In seinen Augen standen Qual und stumme Abwehr deutlich zu lesen.
„Jeden … Wunsch …?!“ sagte er bitter. „Vergiß nicht, daß Traude mit ihren einundzwanzig Jahren an einen lebenden Leichnam gekettet ist …! Für ihre Jugend muß das fast unerträglich sein. Man muß auch gerecht denken!“
Berta Karsten kniff die Lippen fest zusammen. Eine ohnmächtige Wut kochte in ihr hoch. – Daß es ihr auch nie gelingen wollte, den Bruder gegen seine Frau einzunehmen, daß sie auch nie eine Veranlassung fand, ihm zu beweisen, wie herzlos und wie selbstsüchtig Traude sei …!
„Oh – ich bin schon gerecht,“ meinte sie etwas verletzt. „Und ich wünschte nur, du würdest die Dinge um dich her mit denselben kühlkritischen Augen überblicken können, wie ich es tue. Aber dir trübt stets die Liebe für Gertraud den Blick, eine Liebe, die sie nicht im geringsten erwidert.“
Karsten verzog das Gesicht zu einem schmerzlichen Lächeln.
„Liebe – Liebe! – Ach, sie hätte mich vielleicht lieben gelernt, wenn ich nicht so kurz nach der Trauung ein hilfloser Klumpen Fleisch geworden wäre! Sie ist doch nur dem Namen nach meine Frau. Und das wird immer so bleiben – immer. Die Hoffnung, daß bei mir noch eine Besserung eintreten könnte, habe ich längst aufgegeben …“
Sein Kopf sank auf die Brust herab, ganz tief. Er wollte seine Schwester die Tränen nicht sehen lassen, die in seinen Augen schimmerten. –
Was ging in diesen Minuten nicht alles in der Seele dieses stillen Dulders vor sich. Gedanken, Erwägungen, Wünsche und Begierden durchzitterten sein Hirn und brachten alle von der Lähmung nicht betroffenen Nervenstränge in krankhafte Erregung. –
Eine Szene an seinem Hochzeits- und Unglückstage war es, die sich stets aufs neue mit greifbarer Deutlichkeit in seine Erinnerung eindrängte.
Nach der Eheschließung auf dem Standesamt war das junge Paar einige Minuten allein gewesen. Da hatte Max Karsten Traude mit jener ängstlichen Zärtlichkeit, die er ihr gegenüber nur zum Ausdruck zu bringen wagte, in seine Arme genommen und sie auf die Stirn geküßt, hatte mit vor innerer Bewegung zitternder Stimme gesagt: „Nun bist du mein! Auf den Händen will ich dich tragen, jeden Wunsch dir von den Augen ablesen, – nur – habe mich ein wenig lieb!“ –
Und sie, die vielleicht erst in diesem Augenblick begriff, was sie ihm war, hatte sich zu seiner jubelnden Freude fester an seine Brust geschmiegt und leise geantwortet: „Etwas Geduld mußt du mit mir haben, du Guter …! Ich habe dich ja jetzt erst so recht kennen gelernt, dich und dein gütiges Herz, und deine vornehme Denkungsart. Habe Geduld – es wird die Zeit kommen, wo ich Gleiches mit Gleichem zu vergelten vermag …!“ Und dann hatte sie ihn auf die Lippen geküßt, scheu und doch voll Innigkeit. –
Er hatte sie nur zu gut verstanden. „Warte geduldig, ich werde dich lieben lernen, wie du mich liebst!“ hatten ihre Worte besagen wollen. –
Wie unendlich zufrieden war er mit dieser Verheißung gewesen …! Niemals hatte er sich ja der Selbsttäuschung hingegeben, daß sie seinen Antrag aus Neigung angenommen habe. Und nun erstand wie ein glänzendes, fernes Gebilde von beglückender Schönheit die zuversichtliche Hoffnung in ihm, daß diese Ehe ihm doch noch restlose Erfüllung seines Wunsches nach einem trauten Familienleben bringen würde … Und damals waren ihm die Augen feucht geworden vor Rührung … –
Das war der glücklichste Moment seines bisher nur der Arbeit gewidmeten Lebens gewesen …! Von dieser Erinnerung zehrte er in den trostlosen Tagen seiner Krankheit, zehrte er noch heute. Und diese Erinnerung machte ihn auch stark gegen all die versteckten und offenen Verleumdungen und Anfeindungen, die gegen sein junges Weib gerichtet waren und die ihm ein häßliches Bild ihres wahren Wesens geben sollten. – –
Berta Karsten sah ein, daß sie mit den Mitteln, die sie bisher zur Erreichung ihrer dunklen Pläne angewandt hatte, nicht zum Ziele gelangen würde. Sie stellte daher für heute alle weiteren Versuche, den Bruder gegen Traude aufzuhetzen, ein und begann nun, nachdem sie dem Kranken die Kissen zurechtgerückt hatte, ihm aus demselben Buche vorzulesen, das ihre Schwägerin letztens eigens für diesen Zweck gekauft hatte. Es war Kellermanns „Tunnel“[1], jenes Werk, das mit Recht Weltberühmtheit erlangt hat.
Aber der Gelähmte hörte kaum hin. – Morgen sollte ihm Traude diese Seiten noch einmal vorlesen. Die harte, scharfe Stimme seiner Schwester, die alles so gleichmäßig aussprach, kein Wort, keinen Satz hervorhob, war ihm beinahe unangenehm. Es war eben nicht Traude, die neben ihm saß und der er, so lange sich ihre frischen, roten Lippen bewegten, unverwandt in das geliebte Antlitz zu schauen pflegte, es war nicht ihr weiches Organ, nicht ihre fast künstlerische Art des Vortrags.
Max Karsten sehnte sich nach seinem Weibe … Und mit der Sehnsucht, die ständig wuchs, die förmlich nach Erfüllung dürstete wie das Kind, das der stillenden Mutterbrust entgegenstrebt, kroch in sein Herz immer tiefer die trostlose Hoffnungslosigkeit hinein, wurde zur Bitterkeit, zum Hadern mit Gott und den Menschen.
Aber seine starke Seele hatte kaum das arme Herz über diesem mutlosen Aufbegehren gegen etwas Unabwendbares ertappt, als sie auch schon den Kampf wider die störenden Eindringlinge begann. Und schließlich war es nur noch ein tiefer Seufzer, der von der innerlichen Verzweiflung zurückblieb. Max Karsten hatte sich wieder einmal durchgekämpft zu jenem stillen Duldertum, das ihn mit Recht zu einem seltenen Charakter stempelte.
Berta vernahm den wehen Laut von den Lippen des Bruders, sah, daß sein Gesicht einen völlig geistesabwesenden Ausdruck hatte, und hörte mit stets leiser werdender Stimme zu lesen auf. Er merkte es nicht. Da klappte sie das Buch lautlos zu, schloß dann das Fenster, zog die Vorhänge vor und sagte:
„So, nun versuche zu schlafen. – Auf Wiedersehen!“
Noch einmal strich sie ihm liebkosend über die Wange. Dann ging sie.
Und er dachte in der Güte und Nachsicht seines Herzens:
„Sie hat ihre Fehler, und wahrscheinlich ist es nur die Eifersucht auf Traude, die sie dieser gegenüber ungerecht macht. Aber sonst – sonst, – nein, schlecht ist sie nicht…!“ –
Berta war inzwischen nach der Küche gegangen.
Dort hauste die grauhaarige Amanda, von der Berta schon als Kind betreut worden war. Als Kindermädchen war Amanda einst in das Haus des reichen Holzkaufmannes August Karsten gekommen, hatte dann später, nachdem sie als zuverlässig anerkannt war, auf dessen Kosten eine Kochschule besucht und herrschte nun schon gegen dreißig Jahre in der Region der Töpfe und Schüsseln.
Sie war ein sauberes, rundliches Wesen mit rotem Vollmondgesicht, spärlichen grauen Haarsträhnen, auf denen stets ein blendend weißes Häubchen thronte, und einem Paar pfiffiger Augen, die die Welt und die Menschen auf ihre besondere Art betrachteten.
Dem Hause Karsten war sie blindlings ergeben. Und diese Ergebenheit ging so weit, daß sie der jungen Hausfrau lediglich deswegen etwas wie Haß entgegenbrachte, weil sie glaubte, diese allein sei an der Krankheit Max Karstens schuld.
Dieser Überzeugung hatte sie auch Berta gegenüber sehr bald nach dem unglückseligen Hochzeitstage mit den Worten Ausdruck gegeben:
„Das mußte ja alles so kommen! War das ein Verstand von einem fünfundvierzigjährigen Mann, sich mit einem so jungen Ding zu verloben, das ihn völlig aus seiner gewohnten Ruhe brachte und ihn beinahe zum Gespött der Leute machte, weil er stets wie ein verliebter Märzkater um sie herum strich! Nein – das war die größte Dummheit, die der Herr je begehen konnte, Fräulein Berta! Aber natürlich – ‘ne nette Fratze, eine Stimme so süß wie ‘ne Flöte und dunkle Augen, die wie die Feuerräder blinkten, – da mußte der Herr ja drauf reinfallen!“
Amanda konnte sich eine so wenig respektvolle Sprache schon erlauben, zumal sie genau wußte, wie Fräulein Berta selbst über die neue Schwägerin dachte.
So kam es, daß Kastens Schwester in der Köchin eine treue Verbündete gefunden hatte, mit der sie alles durchsprach, was Traude irgendwie betraf.
Auch jetzt setzte sie sich an den Küchentisch und begann eine Unterhaltung mit Amanda, während diese das Geschirr von der Mittagsmahlzeit her säuberte.
Auf eine Frage der Köchin erwiderte sie mit höhnischem Auflachen:
„Wo die beiden sind? – Im Garten gehen der Herr Graf mit dem gnädigen Fräulein Schwester spazieren! Aussprechen wollten sie sich nach der langen Trennung – aussprechen …! Man kann sich ja vorstellen, was da verhandelt wird. Dieser Edgar, der seiner Schulden wegen in die Tropen ging, wird sicherlich fragen, ob sein Schwager denn nicht bald daran denkt, dieses irdische Jammertal für immer zu verlassen. Das wäre für die Geschwister ein Geschäft! Dann würde die schöne Traude meinen Bruder beerben und sich später wieder mit einem Grafen verheiraten, damit der unfeine bürgerliche Name Karsten verschwindet, – dann könnte der Herr Oberleutnant wieder zur Garde zurück – und alles löste sich in Wohlgefallen auf – für unser Geld, für das Geld, das die Familie Karsten in langer Arbeit ehrlich verdient hat!“
Amanda stellte einen Aluminiumtopf so energisch auf den Herd, daß es dröhnte.
„Recht haben Sie, Fräulein Berta, nur zu recht! Es ist ein wahrer Skandal, daß die Gesetze bestimmen, daß die Frau den Mann vollständig beerbt, falls keine Kinder vorhanden und die Eltern des Verstorbenen auch nicht mehr am Leben sind – ein Skandal! Der Herr müßte ein Testament machen – auf jeden Fall! An hunderttausend Mark hätte die junge Gnädige doch auch genug!“
Berta zuckte die Achseln.
„Richtig wär’s natürlich! Ich habe ja mein Erbteil von den Eltern, ich brauche nichts! Aber trotzdem – wenn man denkt, daß nahezu eine halbe Million an eigentlich weltfremde Menschen fallen soll, – da empört sich einem das Herz! Max müßte meine Schwägerin durch Testament auf den Pflichtteil setzen, das heißt auf die Hälfte des ihr ohne Testament zustehenden Betrages. Doch – wie ihm das beibringen?! Er ist ja noch immer rein vernarrt in sie, entschuldigt alles, was sie tut, hält sie für eine Heilige … Da wird schwer etwas bei ihm zu erreichen sein.“
Amanda kniff die listigen Äuglein noch mehr zusammen und sagte leise:
„Na – wenn wir gut aufpassen, Fräulein Berta, einmal wird sich schon wohl was finden, wodurch man dem Herrn beweisen kann, daß nicht er, sondern allein sein Geld geheiratet werden sollte …!“
Berta Karsten nickte.
„Ja, wir müssen zusammenhalten, Amanda. Es soll Ihr Schaden nicht sein! Sie gehören ja längst mit zur Familie Karsten und haben deren Interessen stets wahrgenommen.“
„Das stimmt! Eigentlich müßte ich nicht Amanda Bierzholz, sondern Amanda Karsten heißen! Und deswegen – die junge Gnädige mag sich in acht nehmen! Hier kämpfen zwei Karstens gegen eine Erbschleicherin …“
Die Köchin hatte sich in eine Erregung hineingeredet, die Berta höchst willkommen war.
Das Testament – das war ja der mageren Schwester Max Karstens einziger Gedanke …!
3. Kapitel.
Hildegard Palzow kam die zwischen endlosen Drahtzäunen dahinlaufende asphaltierte Straße, auf die die Mittagssonne unbarmherzig heiß herniederbrannte, ziemlich erschöpft entlang. Erst eine halbe Stunde Fahrt mit der Elektrischen, dann bei der Hitze fünfzehn Minuten zu Fuß auf diesem schattenlosen Wege, – das war selbst für ihren kräftigen, gertenschlanken Körper etwas zu viel.
An solchen Tagen verwünschte Hildegard es stets, daß sie vor einem Vierteljahre sich damit einverstanden erklärt hatte, hier in die Einsamkeit hinauszuziehen, wo es freilich frische Luft genug, dafür aber auch manche Unbequemlichkeiten gab, die mit in Kauf genommen werden mußten. Aber Fritz hatte damals so dringend gebeten und der Mutter alles so wunderschön hinzustellen gewußt, daß Hildegards Bedenken ganz unbeachtet gelassen wurden.
Jetzt hatte sie die Wangenheimstraße erreicht, bog in diese ein und eilte etwas schneller weiter.
Die Wangenheimstraße besaß zur Zeit nur eine einzige bebaute Parzelle, – die, auf der die Scheune stand, deren Rückwand die Grenze nach dem Grundstück Max Karstens bildete.
Wie eine grüne Oase hob sie sich von der öden, sandigen Fläche ab. Die zum Wohnhaus umgebaute Scheune lag ein beträchtliches Stück von der Straße entfernt, und diesen Vorplatz hatte der Gärtner Viezkorn gepachtet und zog dort in sauberen Beeten und niedrigen Treibhäusern eine Unmenge Blumen, die er stets mit großem Verdienst an bestimmte Berliner Geschäfte losschlug.
Hildegard Palzow durchschritt jetzt die Eingangstür der Gärtnerei. Zwischen einer farbenfrohen, duftenden Pflanzenpracht lief der Hauptweg auf die Scheunenvilla zu, wie das junge Mädchen das graugestrichene Gebäude stets nannte.
Sonne und Hitze waren vergessen. Ganz langsam ging Hildegard inmitten dieser Farbenorgie entlang, die von den bunten Blüten all der verschiedenen Blumen gebildet wurde.
Der bucklige Viezkorn, ein Mann schwer bestimmbaren Alters, hatte gerade die Gartenspritze in der Hand und ließ einen feinen Sprühregen über ein Rosenbeet hinstäuben. Hildegard rief ihm einen Gruß zu und schwenkte dann nach rechts ab, um auf ein an der rechten Seite der früheren Scheune noch übrig gelassenes hohes und breites Holztor zuzusteuern, welches den Eingang zu einem sehr geräumigen Gelaß darstellte, in dem der Mechaniker Fritz Palzow sich eine Werkstatt eingerichtet hatte.
In dem einen Flügel des mächtigen Holztores gab es eine niedrige, schmale Pforte, gegen die das junge Mädchen nun mit der Faust kräftig trommelte, nachdem es einen Augenblick auf das innen vernehmbare Hämmern und Klopfen und den vollen Ton einer schönen Männerstimme gelauscht hatte, die gerade irgend ein Wanderlied sang.
Das Geräusch regsamer Hände und das Lied verstummten plötzlich. Gleich darauf fragte jemand von drinnen:
„Wer da …?!“
„Guten Tag, Fritz. Ich bin’s. Ich wollte dir nur sagen, daß du zu Tisch kommen kannst.“
Die Pforte öffnete sich weit, und ein jugendlicher, schlanker Mensch in blauem Leinenarbeitsanzug erschien auf der Schwelle.
„‘n Tag, Hilde. – Die Hand kann ich dir nicht geben, die ist zu schmutzig. – Bestelle der Mutter doch, daß ich etwas später zum Essen erscheine. Ich muß erst eine begonnene Arbeit fertig machen.“
Fritz Palzow glich seiner um fünf Jahre jüngeren Schwester auffallend. Beides waren tadellos gewachsene Gestalten mit regelmäßigen, fast vornehm zu nennenden Gesichtern, beide hatten aschblondes Haar und dazu braune, lebhafte Augen mit langen Wimpern.
Wie sehr der junge Mechaniker auf sein Äußeres hielt, sah man schon daran, daß er zu der hochschließenden Leinenjacke einen weißen Stehkragen trug und sein blondes Bärtchen tadellos gepflegt hielt. –
Hildegard erklärte, sie würde die Mutter in der gewünschten Weise verständigen. – „Bitte – komm’ aber nicht zu spät,“ meinte sie noch und eilte dann am Hause entlang auf den Haupteingang zu.
Durch diesen gelangte man zunächst auf einen Vorflur mit je einer Tür rechts und links, die in die beiden Erdgeschoßwohnungen führten. Im Hintergrunde lief eine breite Holztreppe in das einzige Stockwerk hinauf, in dem sich ebenfalls auf jeder Seite des Flures je eine Dreizimmerwohnung befand. Der noch verbleibende Raum der langgestreckten Scheune war zu Vorratskammern, zu einer gemeinsamen Waschküche, einem Trockenboden und anderen notwendigen Gelassen benutzt worden.
Die Palzowsche Behausung lag zum Teil über der Werkstatt des jungen Mechanikers. Die Fenster zweier Stuben gingen nach der Gärtnerei hinaus, während die dritte und die Küche ihr Licht durch dicke, matte Scheiben empfingen, die in das schräg nach der Wangenheimstraße abfallende Pappdach eingelassen waren, eine Einrichtung, die erst durch das Entfernen der auf den Karstenschen Garten mündenden Fenster notwendig geworden war. In den Erdgeschoßräumen war dem hierdurch entstandenen Mangel an Tageslicht auf recht ungenügende Art durch breite Glastüren abgeholfen worden. –
Frau Palzow war noch in der Küche mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt. Sie war ein unbedeutendes, kleines, aber blitzsauberes Persönchen, mit einem noch fischen, heiteren Gesicht und einer Beweglichkeit, um die sie ein Backfisch hätte beneiden können. Nach dem vor sechs Jahren erfolgten Tode ihres Mannes, eines Steueraufsehers, mit dem sie in selten glücklicher Ehe gelebt hatte, schien sie zunächst völlig zusammenbrechen zu wollen. Dann hatte sie den schweren Schlag aber doch dank der Liebe und Zärtlichkeit ihrer beiden Kinder langsam überwunden.
Hilde machte es sich zunächst etwas bequem und ging dann in die Küche hinüber. Die Begrüßung zwischen Mutter und Tochter war äußerst herzlich.
„Fritz wird schon noch zur Zeit zu Tisch kommen,“ meinte Frau Palzow. „Die Kartoffeln kochen noch nicht. – Na, wie sieht’s bei euch im Geschäft aus? Und was macht Herr Schubert?“
Für letzteren interessierte sich Mutter Palzow aus dem sehr einfachen Grunde besonders, weil er offenbar relle Absichten auf Hilde hatte. Er war Kassierer bei derselben Firma, bei der Hildegard als Korrespondentin angestellt war.
Das junge Mädchen nahm diese Nachfrage nach ihrem Verehrer ohne jede Spur von Verlegenheit hin.
„Was soll er machen?! – Er rechnet und entwickelt sich bei dem ewigen Umgang mit langen Zahlenreihen immer mehr zum Pedanten. Ich glaube fast, Mutter, du denkst häufiger an ihn als ich.“
„Kind – Kind, ich begreife dich nicht! Noch immer bist du so gleichgültig ihm gegenüber?! Willst du denn ewig vor deiner Schreibmaschine hocken?!“
„Warum nicht?! Ich gehöre nicht zu den Mädchen, die um jeden Preis heiraten müssen. Ohne wahre Liebe schließe ich keine Ehe.“
Frau Palzow goß das Wasser von den Kartoffeln ab und setzte den Topf nun mit einem Seufzer zum Abdämpfen auf den Gasherd zurück. Hilde hatte schließlich nicht ganz unrecht. Aber – schade war es doch! Herr Schubert war ein so solider Mensch und hatte ein so hübsches Einkommen.
Nach einer Weile erschien dann auch Fritz, gerade zur rechten Zeit, und die kleine Familie setzte sich an den sauber gedeckten Tisch im Wohnzimmer.
Bei Palzows sah es sehr behaglich aus. Alles war peinlich sauber, und überall merkte man das Bestreben der Bewohner dieser hell tapezierten Räume nach einer gemütlichen Umgebung heraus. –
Hilde klagte ein wenig über die Hitze und den sonnigen Weg, worauf Fritz erklärte:
„Dafür wohnen wir hier aber auch sehr billig und sozusagen in der Sommerfrische. Bisher hat uns noch jeder unserer Bekannten um dieses Heim beneidet.“
„Mit Recht!“ pflichtete Mutter Palzow dem Sohne bei. „Ich jedenfalls möchte nicht wieder in die dumpfen Straßen Berlins zurück.“
Hilde schaute den Bruder schon eine Weile nachdenklich an.
„Du, Fritz, heute früh traf ich auf dem Wege nach dem Geschäft deinen Kollegen Schirmer,“ sagte sie nun. „Denk’ dir, der wußte gar nicht, daß du noch bei der A.E.G. beschäftigt bist. Er wollte bestimmt wissen, du hättest dort schon vor sechs Wochen die Arbeit niedergelegt.“
Sie musterte dabei den Bruder auffallend prüfend.
Fritz war merklich verlegen geworden. Dann erwiderte er jedoch, möglichst den Unbefangenen spielend:
„Schirmer arbeitet in einer anderen Abteilung, und wir haben uns lange nicht gesehen. Da ist ein solcher Irrtum schon möglich, besonders weil ich doch nur noch auf meinen Wunsch den Nachmittag über bei der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft tätig bin, um Zeit für meine eigenen Angelegenheiten zu haben.“
Hilde sagte nichts weiter. Aber in ihrem Gesicht waren noch deutlich allerhand Zweifel zu lesen.
Das Mittagessen war vorüber. Der Regulator an der Wand schlug gerade ein Uhr.
Fritz stand auf, reichte Mutter und Schwester mit einem „gesegnete Mahlzeit“ die Hand erklärte dann:
„Ich werde doch trotz eurer Bedenken versuchen, wenigstens den unteren Teil des früheren Fensters in meiner Stube so herzurichten, daß man es nach innen öffnen kann. Gerade jetzt im Sommer will ich Licht und Luft haben. Die von drüben“ – damit waren Karstens gemeint – „dürften von dieser Veränderung kaum etwas merken. Die Hinterwand ist ja so dicht mit wildem Wein bedeckt, daß es kaum auffallen wird, wenn ich die Sache nur geschickt anfange.“
Ohne eine Antwort der Seinen abzuwarten ging er in die neben der Küche liegende Stube hinüber.
Das auf Wunsch Max Karstens entfernte Fenster war seiner Zeit durch eine doppelte Holzfüllung verschlossen worden. Fritz hatte die Fuge, wo die Bretter, die innen mit Tapeten beklebt waren, mit der Mauer zusammenstießen, bald gefunden. Eifrig arbeitete er nun mit allerlei Werkzeugen wohl eine halbe Stunde lang, wobei er möglichst geräuschlos verfuhr. Dann hatte er die innere Füllung entfernt und aus der äußeren mit einer scharfen Stichsäge ein quadratmetergroßes Viereck ausgeschnitten, das er nun heraushob und zunächst beiseite stellte.
Wie ein Netzwerk zogen sich über die so entstandene Öffnung die Ranken des wilden Weines hin, und nur hier und da befand sich in dem grünen Blattschmuck eine freie Stelle, durch die jetzt ein grünliches Licht in die Stube strömte.
Fritz war mit dem Erfolg seiner Arbeit sehr zufrieden, rief Mutter und Schwester herbei und erklärte, wie er das ausgeschnittene Stück nun mit Scharnieren versehen wollte, damit es sich bequem öffnen ließe.
Die Neugier trieb Hilde dazu, den Kopf durch das Blattgewirr vorsichtig hindurch zu stecken. Und auch Fritz tat dasselbe, um einmal einen Blick in den Karstenschen Garten zu werfen. Von des reichen, aber dauernd an den Krankenstuhl gefesselten Kaufmannes junger, schöner Frau und auch von dessen tyrannischer Schwester hatten sie ja schon so allerlei gehört, aber nie etwas von den Nachbarsleuten gesehen.
Es war, als ob alle diese Menschen, die in den beiden einsamen, aneinander stoßenden Grundstücken hausten, in zwei verschiedenen Welten lebten. Die grüne Wand trennte sie wie eine richtige, unübersteigbare Scheidewand.
Nun hatte Fritz Palzow mit kecker Hand im Bestreben nach Luft und Licht eine Bresche in diese Mauer gelegt, ahnungslos, daß er damit zwischen diesen beiden Welten eine Verbindung schuf, durch die die Lebenswege ihrer Bewohner aufs wunderbarste beeinflußt werden sollten.
4. Kapitel.
Traude und Edgar hatten noch eine Weile in der Laube gesessen und in ernstem Gespräch alle die Dinge behandelt, die seit ihrer Trennung als ein Neues in ihr Dasein getreten waren.
Dann hatte der Oberleutnant die Schwester gebeten, ein wenig mit ihm im Garten auf und ab zu gehen.
„Das Stillsitzen gleich nach Tisch bekommt mir nicht,“ hatte er erklärt.
Und nun schritten sie Arm in Arm durch die Wege, blieben hin und wieder stehen und betrachteten die seltenen Pflanzen und Sträucher, die Max Karsten, der ein großer Blumenliebhaber war, teilweise selbst aufgezogen hatte.
So gelangten sie schließlich wieder bis dicht vor die grüne Wand, die einen so passenden Abschluß für den Garten bildete. Unter einer Kastanie mit dichtem Blätterdach, deren äußerste Zweige sich mit dem Laub des wilden Weines vermischten, tat Edgar dann die Frage, die er bisher auszusprechen sich geschenkt hatte. Er faßte beide Hände der Schwester, schaute diese recht lieb an und sagte:
„Kleines, wie stehst du nun eigentlich mit deinem Manne?“
Sie wich seinem Blick nicht aus.
„Max ist herzensgut, Edgar. Ich habe über ihn wahrlich nicht zu klagen. Wir leben miteinander wie … wie Bruder und Schwester, die ungefähr dieselben Interessen haben.“
Jetzt senkte sie doch den Kopf und errötete.
Da war’s, als ob über den Geschwistern aus der Krone der alten Kastanie eine Stimme hervorschallte, eine angenehm klingende Männerstimme, die halblaut sagte:
„Armer Mensch! Ein hübsches Weib und ein kleines Paradies als Heim besitzt er, über Reichtümer verfügt er, und doch …! Was hilft ihm alles! Es muß ein furchtbares Schicksal sein, in noch so jungen Jahren auf all die Freuden verzichten zu müssen, die das Leben uns Sterblichen bietet.“
Dann wieder eine andere Stimme, nicht minder angenehm, ohne Frage die eines jungen Mädchens:
„Sprich leise, Fritz. Vielleicht ist doch jemand im Garten.“
Edgar Presterloh trat neugierig möglichst geräuschlos ein paar Schritte vor und schaute sich nach den beiden um, die doch offenbar zu dem Nachbargrundstück gehörten.
Emporblickend, aber selbst noch durch die Äste der Kastanie verdeckt, ward ihm ein eigenartiges Bild zuteil. Aus den großen Blättern des wilden Weines der grünen Wand ragten zwei Köpfe heraus, die eines jüngeren Mannes und eines Mädchens mit auffallend feinem Gesicht.
Es sah aus, als ob diese beiden Köpfe hoch über dem Erdboden wie ein seltsamer Schmuck inmitten der grünen Fläche angebracht waren.
Der mit Fritz Angeredete erwiderte jetzt auf die warnenden Worte des jungen Mädchens:
„Sei ohne Sorge, Hilde, – kein Mensch ist dort unten. – Wirklich ein schöner Garten!“ fügte er eifrig hinzu. „Sieh dort nur das geschmackvolle Teppichbeet links von dem Springbrunnen.“
Die Gesichtszüge des männlichen Kopfes, nicht minder auch die volle, wohlklingende Stimme, riefen plötzlich in dem Oberleutnant irgend eine Erinnerung wach. – Er mußte diesen jungen Menschen ohne Frage kennen …! – Aber woher nur, woher?! Dann lichtete sich mit einem Mal das Dunkel. Vor Presterlohs geistigem Auge tauchte eine wildbewegte Nachtszene auf. Im Manöver war’s gewesen, als die Scheune, in der Presterlohs Zug gerade untergebracht war, in Flammen aufging. Bei dieser Gelegenheit hatte sich der Gefreite Palzow besonders ausgezeichnet, indem er ein paar Kameraden, die sich oben auf den Heuboden verkrochen hatten, mit höchster eigener Lebensgefahr rettete. Und Edgar hatte dann dafür gesorgt, daß jener Fritz Palzow, der auch sonst einer der tüchtigsten Leute der Kompagnie war, nicht nur die Rettungsmedaille erhielt, sondern auch später zum Unteroffizier befördert wurde.
Der Oberleutnant besann sich nicht lange. Unter der Kastanie hervortretend rief er seinem einstigen Untergebenen munter zu, indem er grüßend hinaufwinkte:
„Palzow – sind Sie’s wirklich?! Wie geht’s Ihnen denn …?!“
Edgar Presterloh richtete jedoch nur die Worte an den früheren Gardegefreiten, seine Blicke aber voller Bewunderung auf Hilde, die mit leisem Schreckensruf den Kopf hinter das schützende Blattgewirr hatte zurückziehen wollen, dabei aber mit einer Strähne des Haupthaares ihrer etwas koketten Frisur in einer Ranke hängen blieb und sich nun errötend abmühte, mit Hilfe beider Hände sich wieder zu befreien.
Fritz Palzow erschrak gleichfalls, als er so unvermutet angerufen wurde. Dann hatte er aber auch schon seinen einstigen Zugführer erkannt.
„Herr Graf – oh, das nenne ich eine Überraschung! Ich denke, Herr Graf sind in Südwest …?!“
Presterloh hatte ein eigenes, sofort für ihn einnehmendes Lächeln an sich.
„Zunächst, lieber Palzow, helfen Sie mal der jungen Dame da neben sich, die offenbar auf einen Zweig des wilden Weines eine zu starke Anziehungskraft ausgeübt hat,“ meinte er mit seinem sonnigen Lächeln. „Spielen Sie etwas den Kavalier, und zwar schnell, sonst hole ich eine Leiter und steige Ihnen … aufs Dach!“
Hilde hatte die Strähne inzwischen glücklich freibekommen.
„Nicht nötig!“ rief sie mit unbefangener Heiterkeit. „Alles schon erledigt. Mein Bruder braucht Sie nicht mehr zu bemühen. Und auch die Leiter wäre mithin überflüssig.“
Presterloh verbeugte sich nach Hilde hin.
„Ah, Sie sind die Schwester meines wackeren Fritz Palzow, mein Fräulein. – Gestatten: Oberleutnant Graf Presterloh …“
Mittlerweile war auch Traude neben dem Bruder erschienen. Diese ganze Szene hatte einen so komischen Anstrich, daß auch um ihre Lippen ein leises Lächeln spielte.
Edgar, der selbst hier seine gesellschaftliche Sicherheit nicht verlor, stellte Traude jetzt den beiden Köpfen da oben in aller Form mit einer scherzhaften Redewendung vor.
Kaum hatte der junge Mechaniker gehört, wer die Dame war, als er sich auch schon wortreich entschuldigte, daß er es gewagt habe, in der grünen Wand ohne Erlaubnis des Besitzers des Nachbargrundstückes eine Öffnung herzustellen.
Traude beruhigte ihn schnell.
„Mein Mann wird kaum etwas dagegen haben,“ meinte sie. „Ich werde mit ihm sprechen.“
Im Laufe der nun folgenden Unterhaltung erfuhr Presterloh, daß Palzow zur Zeit an dem Modell einer Flugmaschine arbeite, die er später der Heeresverwaltung zum Ankauf anbieten wollte, nachdem seine Verbesserungen an der Steuerung und die neuartige Anordnung der Sitze für den Führer und den Beobachter patentiert worden wären.
„So sind Sie also unter die Erfinder gegangen, Palzow,“ meinte der Graf überrascht. „Hören Sie – für Flugmaschinen interessiere ich mich außerordentlich. Kann ich mir das Modell nicht mal ansehen?“
„Gewiß, Ihnen zeige ich es sehr gern, Herr Graf. Sie werden meine Konstruktionsgeheimnisse nicht verraten. Vielleicht darf ich Sie übermorgen Vormittag erwarten. Da haben wir Sonntag, und ich bin ganz frei und stehe gern zu Ihrer Verfügung. Jetzt muß ich nämlich sofort nach der Stadt hinein.“
„Gut – also Sonntag vormittag, lieber Palzow. – Auf Wiedersehen …!“
Die beiden Köpfe oben zogen sich zurück, und auch Traude und Edgar schritten langsam dem Hause zu.
„Welch merkwürdiger Zufall!“ meinte Traude. „Vorhin sagte ich dir noch, daß in meiner Phantasie die Einwohner dort hinter der grünen Wand alle etwas Besonderes an sich hätten, daß ich sie mir stets als ganz seltsame Wesen vorgestellt habe. Und nun hat meine grüne Wand sich ganz plötzlich ihres geheimnisvollen Reizes entkleidet.“
„Mit einem Wort – du bist enttäuscht, Kleines, nicht wahr? Du hast festgestellt, daß es ganz gewöhnliche Sterbliche sind, die in dem Scheunenpalast hausen, und das geht dir wider den Strich. – Hm, – vielleicht sind es aber doch nicht so poesielose Gestalten, die du da eben als Vertreter jener hinter der grünen Wand verborgenen Welt kennen gelernt hast. Von Fritz Palzow weiß ich zum Beispiel genau, daß er, wenn auch einfacher Mechaniker, in vielfacher Beziehung ein seltener Mensch ist. Ich besinne mich zum Beispiel ganz genau, daß er bei einem Kaisersgeburtstagsfest der Kompagnie mit seiner wunderbaren Baritonstimme unter den Herzen der anwesenden Damen – und es waren damals so ziemlich alle Gesellschaftsschichten vertreten – arge Verheerungen anrichtete und daß die damals sechzehnjährige Tochter unseres Bataillonskommandeurs noch wochenlang von dem „entzückenden, angehenden Caruso“ schwärmte. – Na, und was Fritz Palzows Schwester anbetrifft, so birgt meines Erachtens jedes schöne Weib ein Stückchen Poesie in sich. Und schön ist diese Hilde! Das sage ich nicht etwa als Schutztruppler, der jahrelang nur schwarzhäutige Vertreterinnen des schönen Geschlechts um sich gesehen hat und der dabei vielleicht in jeder einigermaßen passablen Weißen eine Schönheit vor sich zu haben glaubt, – nein, – das wird mir jeder andere auch bestätigen müssen. Du etwa nicht, Kleines?“
„Gewiß, gewiß …!“
„Na also! Und – gewährten diese beiden Köpfe da oben zwischen dem Weinlaub nicht wirklich einen poetischen Anblick?! Wäre es dir lieber gewesen, wenn dort plötzlich das Gesicht einer hakennasigen triefäugigen Hexe sichtbar geworden wäre, die jeder Theaterdirektor sofort für Humperdincks „Hänsel und Gretel“[2] mit Freuden engagiert hätte …! – Kleines sei zufrieden! Die Welt da hinter der grünen Wand erscheint mir durchaus nicht reizlos. Bedenke – ein Erfinder hämmert und bastelt dort an einem künstlichen Riesenvogel herum, den Kopf voller Ideen, das Herz voller Hoffnungen! – Ja, Schwesterlein, betrachte dir jene Menschen nur genauer, und du wirst sagen: „Meine Phantasie hat mich nicht betrogen!“.“
Traude war stehen geblieben und schaute den Bruder kopfschüttelnd an.
„Afrika hat aus dir einen Träumer gemacht!“ sagte sie mit ehrlichem Staunen. „Du siehst die Welt und die Menschen jetzt mit anderen Augen wie früher an.“
Edgar Presterloh nickte ernst.
„Afrika hat mich geläutert,“ meinte er. „Dort draußen in den Kolonien fällt so manches von einem ab, was uns in der Heimat wie etwas Hemmendes anhaftete: Vorurteile, Leichtsinn, Überschätzung des eigenen Ichs und jene Blasiertheit, die bei vielen allerdings auch Mache ist. Nur eines bleibt in jedem lebendig, der sonst gesund an Körper und Geist ist: die Sehnsucht nach der deutschen Frau, nach einem eigenen Heim, nach friedlichen Ruhestunden inmitten einer glücklichen Familie. Nein, bleibt ist zu wenig gesagt! Diese Sehnsucht wächst vielmehr, nimmt zu mit jedem Monat, den man da draußen auf einem verlassenen Posten zubringen muß. Insofern mag ich jetzt wirklich ein Träumer sein. Auch ich denke oft an die, die noch nicht gefunden ist, an meine spätere Lebensgefährtin, male mir aus, wie ich mir ein ganzes Glück an der Seite eines geliebten Weibes aufbaue, ja, ein ganzes Glück! Und um diese Träume der Erfüllung möglichst nahe zu bringen, wünschte ich, daß ich keine Verstandesehe einzugehen brauchte.“
Traude senkte jetzt den Kopf, als lege sich eine schwere Faust auf ihren Scheitel. Sie dachte an ihre Ehe, sie dachte an vergangene Zeiten, wo auch sie in törichter Mädchenschwärmerei von dem großen Geheimnis der Liebe sich zauberhaft schöne Vorstellungen gemacht und sich vorgenommen hatte, daß einst nur das Herz sprechen sollte, wenn sie sich einem Manne zu eigen gab.
Törichte Mädchenschwärmerei!! – Mit bitterem Lächeln raunte sie sich’s jetzt selber zu. – Der Mann, dessen Namen sie führte, war ein bedauernswerter Kranker, ein gütiger, ein guter Mensch, aber nie derjenige, der selbst bei blühender Gesundheit das Sehnen nach dem Mädchenglück hätte stillen können.
Edgar Presterloh bemerkte die Veränderung in dem Gesichtsausdruck der Schwester. Er ahnte, was in ihr vorging, welche Gedanken seine Worte in ihr geweckt haben mußten. Und er zog sie sanft an sich und sagte leise:
„Armes Kleines, es kommt im Leben ja stets anders als man wünscht und denkt. Wer weiß, wie bitter auch mich die Zukunft enttäuschen wird!“
5. Kapitel.
Am nächsten Tage war’s gegen vier Uhr nachmittags.
Edgar Presterloh stand am geöffneten Fenster seines Wohnzimmers und schaute in den geräumigen, mit einigen Bäumen, Fliedersträuchern und blühenden Tulpen, die in einem großen Mittelbeet vereinigt waren, bepflanzten Hof hinab, wo der Hauswart gerade mit einem der Dienstmädchen aus dem Gartenhause herumzankte, weil sie angeblich aus dem Küchenfenster Apfelschalen herausgeworfen hatte, was sie energisch bestritt.
Presterloh hatte sein stilles Vergnügen an diesem Wortgefecht. Die feindlichen Parteien waren ohne Zweifel waschechte Berliner, was sowohl aus dem Dialekt als auch der Schlagfertigkeit bei Angriff und Verteidigung hervorging.
Der Hauswart wurde bisweilen recht gehörig grob, aber hiermit kam er gegen die zungenfertige Küchenfee nicht auf, die ihm mit witzigem Spott diente und besonders eine bei dem Portier vorhandene und nur allzubekannte Neigung für alkoholische Getränke weidlich ausnutzte.
Diese echte Großstadtszene, die ein andächtig lauschendes und hin und wieder für die Beschuldigte Partei ergreifendes Publikum an sämtlichen in den Hof mündenden Küchenfenstern gefunden hatte, endete erst, und wahrscheinlich zur großen Erleichterung des arg in die Enge getriebenen Hauswartes, durch das Auftauchen eines von einem Knaben geführten älteren Mannes, der mitten im Hofraum vor dem Tulpenbeet Aufstellung genommen hatte und nun eine Mandoline aus einem Ganzlederüberzug auszupacken begann.
Der Hauswart, gereizt durch das für ihn wenig ruhmreiche Wortgeplänkel mit der Köchin aus dem Gartenhause, hatte kaum den Musikanten erblickt, als er auch schon das resolute Mädchen stehen ließ und auf den Alten zuschoß.
„Sind Sie schon wieder da?! In der vorigen Woche habe ich Ihnen bereits gesagt, daß ich die Singerei nicht dulde – verstehen Sie mich! Runter vom Hof! Aber ’n bißchen beschleunigt …!“
Wie ein Kampfhahn stand der Hauswart vor dem Blinden, der ängstlich sofort wieder seine Mandoline einzuhüllen sich beeilte.
„Bettelvolk! Nur Schmutz trägt die Gesellschaft einem auf die Fliesen hier. Den ganzen Tag kann man nichts als scheuern Euretwegen. – Vorwärts – raus aus dem Hause …!“ –
Aber es sollte anders kommen.
In sämtlichen Küchenfenstern erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Und besonders die Köchin aus dem Gartenhause, mit der der Portier einen für ihn wenig ruhmvollen Strauß ausgefochten hatte, trat sehr energisch für den Alten ein.
„Das ist kein Bettler, Sie alter Grobsack, Sie, – das ist ein Künstler! Wir alle wollen, daß er uns was vorsingt …! Und wenn Sie den Mann wirklich fortweisen, so werde ich ihn zu mir in die Küche nehmen, wo er dann am offenen Fenster singen kann. Meine gnädige Frau hat auch gesagt, sein Gesang ist ’n Genuß. Was verstehen Sie schon von Gesang … Ihnen ist die Hauptsache, daß nischt aus Ihrer Kehle raus, sondern möglichst viel reinkommt – Sie Gegenstück für ’n Temperenzlervereinsmitglied!“
Aber der Hauswart ließ sich nicht einschüchtern, so viel Zurufe ihn auch belehrten, daß jedenfalls das gesamte Dienstpersonal der verschiedenen Wohnungen den Sänger zu hören wünsche.
„Hier habe ich zu bestimmen – ich allein!“ brüllte er krebsrot, faßte den Alten beim Ärmel und wollte ihn wegführen.
Da erschien eine stärkere Macht auf dem Schauplatz.
Aus einem der Fenster der Nachbarwohnungen des zweiten Stockwerks, an deren Flurtür Presterloh gleich am ersten Tage seines Einzugs in das Fremdenheim der verwitweten Frau Major von Krusius ein Schild mit der Aufschrift „Dr. Oppener, Wirklicher Geheimer Rat“ bemerkt hatte, beugte sich eine weishaarige, sehr vornehm aussehende Dame heraus und rief den Hauswart an.
„Pachmeike – einen Augenblick!“
Pachmeike riß die Mütze herab und eilte dienstfertig bis unter das betreffende Fenster hin.
„Exzellenz befehlen?“ fragte er mit tiefem Bückling.
Im Hofe war es jetzt mäuschenstill geworden.
„Ihre Pflicht ist es doch nur, ruhestörenden Lärm hier im Hause zu verbieten, nicht wahr?! Hiervon kann aber bei den Vorträgen des armen Blinden dort keine Rede sein. Im Gegenteil, die Mädchen haben ganz recht, wenn sie den alten Mann einen Künstler nennen. Ich werde jedenfalls noch heute an den Hausbesitzer schreiben und ihn bitten Ihnen Anweisung zu geben, daß dieser Blinde hier musizieren darf. Ich selbst höre seine Lieder sehr gern, und für die Dienstboten stellen diese eine ihnen sehr wohl zu gönnende Abwechslung dar. Kranke haben wir doch nicht im Hause?!“
Pachmeike trat jetzt sofort den Rückzug auf der ganzen Linie an. Exzellenz Oppener hatte letzte Weihnachten ihm wieder im Umschlag einen Fünfzigmarkschein als Festgabe heruntergeschickt. Mit denen durfte er es also nicht verderben, zumal Oppeners auch die teuerste Wohnung im Hause inne hatten und der Besitzer dieses modernen Mietspalastes auf die Exzellenz-Einwohner besonders stolz war.
„Exzellenz – das ist ja natürlich dann ganz was anderes, wenn auch die Herrschaften den Mann zu hören wünschen. Ich konnte das nicht wissen, werde mich aber in Zukunft danach richten, Exzellenz, – davon können Exzellenz überzeugt sein.“
„Oller Kriecher! Nu gibt er klein bei!“ ließ sich eine der Küchenfeen sehr deutlich vernehmen. –
Presterloh hatte sich etwas zum Fenster hinausgebeugt, um die Dame besser in Augenschein nehmen zu können, die dergestalt für den blinden Musikanten eingetreten war.
Da erschien neben dem hochfrisierten, weißhaarigen Kopf der Exzellenz ein zweiter, der einer jungen Dame, die nach der Ähnlichkeit des Gesichtsschnittes zu schließen, nur eine Tochter Ihrer Exzellenz sein konnte. Und jetzt drehte sich Fräulein Oppener nach rechts, ließ ihre Augen über die Fensterreihen hinschweifen und wurde so auch Presterloh gewahr, der nun in dem jungen Mädchen zu seiner nicht geringen Überraschung seine Logennachbarin vom Abend vorher wieder erkannte, die, wie auch er, gestern der Aufführung einer neuen Operette im Theater am Schiffbauerdamm beigewohnt hatte und deren elegante Erscheinung und trotz aller Unregelmäßigkeit selten anziehendes Gesicht ihn veranlaßt hatte, sie mehr als einmal verstohlen zu mustern.
Inzwischen hatte Pachmeike dem blinden Sänger ein paar Worte zugerufen und sich dann ins Haus zurückgezogen.
Der Alte packte seine Mandoline wieder aus, nahm sie in den Arm und strich prüfend über die Saiten hin. Dann hob er den Kopf etwas und begann nach ein paar Eingangstakten das Lied „An der Weser“ zu singen.
Nach dem Vorangegangenen war Presterloh auf die Darbietungen des ärmlich gekleideten Blinden, der einen grauen Vollbart und vor den erloschenen Augen eine große, blaue Brille trug und seine Zugehörigkeit zur Künstlerzunft äußerlich nur durch einen arg zerknüllten, breitrandigen, grauen Schlapphut verriet, ehrlich neugierig geworden.
Nun, er merkte sehr bald, daß Ihre Exzellenz nicht ohne Grund sich für den Alten ins Mittel gelegt hatte. Der Mann war auch nicht im entferntesten mit jenen verkappten Bettlern zu vergleichen, die sich musizierend in den Höfen der Großstadt hören lassen und die ihnen zugeworfenen Geldstücke dann für gewöhnlich in der nächsten Kneipe in Flüssigkeiten umzusetzen pflegen. Nein – dieser Blinde verfügte über eine prachtvolle, wenn auch nicht sehr geschulte Baritonstimme, und die Art seines Vortrages entsprach vollkommen diesen reichen Stimmitteln.
Es gab jetzt in dem großen Hofraum kaum noch ein unbesetztes Fenster. Alles lauschte andächtig dem blinden Sänger, der dem ersten Liede zwei heitere, aber in keiner Weise anstößige Walzergesänge folgen ließ.
Mittlerweile sammelte der ebenso ärmlich angezogene Knabe die herabgeworfenen, in Papier gewickelten Münzen ein. Die Ernte war nicht schlecht. Jeder spendete etwas, und auch Presterloh schloß sich nicht aus. Frau Oppener hatte wirklich nicht zu viel gesagt, als sie Pachmeike klar machte, daß die Kunst des Alten auch verwöhnte Ohren vollauf befriedigen könne.
Jetzt zog der Blinde wieder den Überzug über seine Mandoline, nahm dann den Schlapphut ab und verbeugte sich rundum dankend.
Bisher war noch kein Zeichen des Beifalls laut geworden. Nun aber setzte ein begeistertes Händeklatschen ein, in das sich Zurufe wie „Wiederkommen!“ – „Auf Wiedersehen!“ mischten.
Langsam verließ der Alte dann, von der Hand des vielleicht achtjährigen Jungen geleitet, den Hof und das Haus, um sofort im Nachbargebäude zu verschwinden, wo er mit seinen Darbietungen nicht weniger Beifall als in Pachmeikes streng, aber leider ungerecht regiertem Reiche fand. So ging es von Haus zu Haus, von Hof zu Hof. Selten, daß ein Hauswart den Blinden fortwies. Und schwerer und schwerer wurde die rechte Tasche des abgeschabten, schwarzen Beinkleides des Musikanten, in die dieser all die vereinnahmten Münzen steckte, meist Nickelstücke, aber auch so manchen kleinen Silberling.
Erst als es gegen sechs Uhr nachmittags war, beendete der blinde Sänger seinen Rundgang durch die Straßen des vornehmen Berliner Westens, die er sich in verschiedene Reviere eingeteilt hatte, so daß er nur jede Woche einmal dieselben Häuser besuchte.
Er und der Knabe fuhren nun mit der Straßenbahn in das Zentrum der Weltstadt bis zu einer alten Gasse in der Nähe des Königlichen Schlosses. Hier machten sie vor einem hohen, schmalen Gebäude mit kleinen, bereits grün angelaufenen Scheiben halt. Der Blinde drückte dem Jungen ein Einmarkstück in die Hand, indem er sagte:
„So, nun kannst du gehen. Die Treppen finde ich mich schon allein hinauf. Und morgen, falls schönes Wetter ist, wieder um drei Uhr nachmittags wie gewöhnlich.“ –
Das Haus, in dem der Blinde jetzt langsam die Stufen emporklomm, wurde nur von älteren, still für sich lebenden Ehepaaren bewohnt. Auf dem zweiten Treppenabsatz staubte gerade eine gebückte Matrone mit freundlichem Gesicht einen altmodischen Damenmantel aus.
„Na, Herr Riemann, wie geht’s? Wieder mal fleißig gewesen?“ meinte sie, dem Musikanten vertraut zunickend.
„Danke für gütige Nachfrage. Man schlägt sich so durch. Nur die Augen – die Augen!! Die werden von Tag zu Tag schlechter, so sehr ich sie auch schone. – Guten Abend, Frau Göttke.“
Und weiter stieg der Musikant, bis hinauf unter das Dach, wo er eine der beiden Giebelstuben gemietet hatte.
Nachdem er die Tür hinter sich abgeschossen hatte, legte er seine Mandoline auf das einfache Bett und nahm dann die Brille mit den dunklen Gläsern ab. Kluge, lebhafte Augen kamen dahinter jetzt zum Vorschein, Augen, die alles andere nur nicht erblindet oder auch nur in ihrer Sehkraft geschwächt waren.
Dann setzte er sich an den wackligen Tisch ans Fenster und machte Kaffee. Mit großer Fingerfertigkeit zählte er das Geld in sauber ausgerichteten Reihen auf.
„Elf Mark fünfundsechzig Pfennig! Der Verdienst wird schlechter,“ murmelte er vor sich hin. „Man merkt, daß viele reiche Leute schon in die Bäder gereist sind. Aber trotzdem – jeder Tag bringt mich meinem Ziele näher. Nur vorsichtig muß ich sein, sehr vorsichtig! – Das gab mir heute förmlich einen Ruck durch den Körper, als ich „ihn“ erkannte! Man sieht, selbst in der Millionenstadt Berlin ist man nicht sicher, daß der „blinde Sänger“ einmal ertappt wird.“
Hierauf tat er das Geld in eine Lederbörse und begann sich umzuziehen.
6. Kapitel.
Sonntag morgen war’s, derselbe Sonntag, an dem Edgar Presterloh dem jungen Mechaniker einen Besuch hatte abstatten wollen, um sich dessen Flugmaschinenmodell anzusehen, – angeblich! – In Wirklichkeit, um mit Hilde Palzow wieder zusammen zu treffen.
Max Karsten saß in seinem Fahrstuhl am offenen Fenster der Veranda, und neben ihm sein junges, blühendes Weib, von der er sich soeben einiges aus der Morgenzeitung hatte vorlesen lassen.
Jetzt tastete seine Rechte schwerfällig nach der ihren, und seine Finger umschlossen diese lebenswarme Hand in scheuer Zärtlichkeit.
„Ich … danke … dir, Gertraud. – Genug … für jetzt. Dich strengt das viele Sprechen an, ich merke es.“
Sie wußte kaum, was sie gelesen hatte. Ihre Gedanken waren nicht bei all diesen Tagesereignissen gewesen, die ihr Mund ihrem Manne vermittelt hatte.
Seit Tagen regte eine seltsame Unruhe ihr Blut auf. War vielleicht das warme Wetter daran schuld, vielleicht all das knospende, erfüllungsfrohe Leben, das jetzt so eindringlich durch die duftende Blütenpracht des Gartens, die nistenden Vögel und besonders durch die sonntäglich geputzten Menschen zu ihr sprach, die heute in Scharen an dem einsamen Hause vorbei ins Freie pilgerten mit gefüllten Rucksäcken und genusfrohen Augen, oft nur zu zweien, und dann stets Arm in Arm, dicht aneinander geschmiegt und den Abglanz des wunderschönen Sommertages auf den jungen Gesichtern.
Traude wußte nicht, was in ihr vorging. Aber sie fühlte diese Unrast, dieses Unstäte in ihrem ganzen Sichgeben, in ihrem Denken nur zu gut. Und noch nie war ihr das Dasein in ihrem vergoldeten Käfig so sehr als etwas Drückendes, Lästiges erschienen wie jetzt.
Ob’s vielleicht daran lag, daß Edgars Auftauchen unendlich viele Erinnerungen an die Vergangenheit in ihr wachgerufen, daß seine frische Männlichkeit sie zu Vergleichen herausgefordert hatte, indem sie in Gedanken ihren Gatten neben den Bruder stellte und so erst gewahr wurde, an welchen siechen Körper ihre erwartungsvolle Jugend gekettet war?! – Bisher war ihr neues Leben, diese Ehe mit einem herzensguten, aber schwerkranken Manne, ohne jede Störung von außen dahingeflossen. Nur selten erschien ein Besucher in dem entlegenen Heim des unglücklichen Gelähmten. Still wie in einem Kloster waren die Stunden, Tage und Wochen davon geglitten in das Meer der Vergangenheit.
Mit einem Schlage fast war dies nun anders geworden. Edgar erschien, und er brachte einen Hauch jenes emsig pulsierenden Großstadttreibens mit in diese Abgeschiedenheit hinein, der auf Traude wie ein ferner, nur zu sehr lockender Wohlgeruch wirkte.
Ja – Edgar war schuld daran, daß sie so jäh aus diesem trägen Hindämmern erwacht war. Darüber war sie sich klar geworden, während ihr Mund Worte formte und ihre Augen über die gedruckten Zeilen hinwegeilten, ohne daß ihr das Gelesene zum Bewußtsein kam.
Und auch die grüne Wand, die in ihrer Phantasie mit so viel Eigenartigem und Geheimnisvollem als die verschlossene Pforte zu einer unbekannten Welt ausgestaltet gewesen war, hatte sich nun geöffnet und ihr zwei lachende Menschenkinder gezeigt, die hinter der von Ranken übersponnenen grünen Mauer hausten in einem alten, unschönen Gebäude und die doch jeder Zeit in die Freiheit hinaus konnten, um sich ihr Schicksal selbst zurechtzuzimmern …
Und sie …?! Ihr Schicksal hatte sich schon erfüllt, ihre Freiheit war für immer dahin! – Unzufriedenheit quoll in ihr hoch, Bitterkeit und Neid …
Da fühlte sie plötzlich diese vorsichtige, halb ängstliche Berührung, fühlte ihres Gatten Hand die ihre umspannen …
Sie schaute auf. Ihr weltfremder Blick fand sich langsam in die Wirklichkeit wieder hinein, kehrte aus den Tiefen ihrer eigenen Seele zurück, wo er die Ursache dieser seltsamen Unruhe, dieses Zerrens und Reißens an allen Nervensträngen hatte erforschen wollen. Sie merkte, daß die Hand ihres Mannes, dieses stillen Dulders, wie nach einer leisen Zärtlichkeit schmachtend sich ihr genähert hatte, sie sah seine Augen, aus denen ihr eine ganze Welt von Liebe und Sehnsucht entgegenstrahlte, auf sich gerichtet.
Und mit einem Mal fühlte sie sich so köstlich geborgen, erwiderte den Druck seiner Hand, nickte ihm herzlich zu und sagte ohne zu wissen, daß sie ihren innersten Gedanken lauten Ausdruck gab:
„… die Pflicht über alles! – Das ist der Wahlspruch der Presterlohs seit den Kreuzzügen her. – Die Pflicht …!! Und das eigene Ich zuletzt …!“
Max Karsten hörte sehr wohl aus dem Ton ihrer Stimme heraus, daß diese Worte nicht für ihn bestimmt, daß sie ihr ungewollt über die Lippen gekommen waren.
Und wie er nun gütig und sanft wie immer fragte: „Bedrückt dich etwas, Gertraud?“ da drängte sich all das, was sie bewegte, in sich überstürzenden Sätzen wie in heißer Seelenangst aus ihrem Herzen hervor.
Es war, als ob sie eine Beichte anlegte. Sie sprach von all den wirren Empfindungen, über die sie sich nicht klar wurde und die sie so ruhelos machten, und fügte schließlich hinzu:
„Hilf mir, Max … Du hast ja weit, weit mehr Lebenserfahrungen als ich. Du kannst mir vielleicht sagen, warum das Wiedersehen mit meinem Bruder eine so auffällige Wirkung auf mich ausgeübt hat und was eigentlich in mir vorgeht …“
Er senkte den Kopf, schloß die Augen. Schreck und Angst waren’s, die sich seiner bemächtigt hatten. Er wußte ja nur zu gut, was diese wechselnden Stimmungen bei ihr zu bedeuten hatten. Ja, er kannte das Leben … Und deshalb merkte er sofort, daß Traudes frische, kraftvolle Jugend sich nach Freiheit sehnte, nach einem anderen Dasein, als er ihr zu bieten vermochte. –
In dieser Annahme konnte er sich kaum täuschen. Was sollten sonst wohl ihre Worte, dieser Wahlspruch, den sie wie eine Mahnung an sich selbst vor sich hingeflüstert hatte …?!
„Die Pflicht über alles…!“ – Ja, nur die Pflicht hielt sie an seiner Seite, das Pflichtgefühl … Aber wie lange noch …?! –
Er ahnte, daß er sie verlieren würde, daß es das Sehnen nach einem vollen Glück, daß es der Lebenshunger des gesunden Weibes war, die ihr Inneres jetzt zerwühlten …
Und doch lag in seinem Gesicht, als er wieder den Kopf hob, sein gütiges Lächeln.
„Quäle dich nicht unnötig, Gertraud,“ sagte er. „Solche Stunden, wo wir selbst nicht wissen, was in uns vorgeht, hat gelegentlich ein jeder zu überstehen. Warte ab. Deine Empfindungen werden sich klären …“ Und ohne Zusammenhang scheinbar fügte er hinzu:
„Vergiß nicht, dem jungen Palzow heute zu bestellen, daß ich nichts gegen diese Fensteröffnung in der Rückwand des Scheunengebäudes einzuwenden habe. Du wirst deinen Bruder doch sicherlich gern begleiten wollen, um Palzows Erfinderwerkstatt dir anzusehen. Dann kannst du die Sache ja gleich erledigen. – Ja, Gertraud, geh’ nur mit. Vielleicht bekommt ihr ganz Interessantes zu sehen. – Hat der Mechaniker denn gar nicht angedeutet, womit er sich beschäftigt?“
„Doch – aber es soll Geheimnis bleiben. Deshalb erwähnte ich nichts davon. Du hast ja allerdings ein Anrecht, es zu erfahren, und du wirst darüber ebensowenig zu anderen sprechen wie ich. Er baute ein Flugmaschinenmodell, durch das er reich zu werden hofft.“ –
* * *
Vor einigen Minuten hatte Berta Karsten lautlos das an die Veranda anstoßende Zimmer betreten. So war ihr keines der Worte entgangen, die das Ehepaar wechselte.
Und ebenso lautlos verließ sie jetzt wieder den Raum. – –
Eine halbe Stunde später kam Edgar Presterloh. Traude eilte ihm bis an die Pforte des Vorgartens entgegen.
„Ich begleitet dich zu Fritz Presterloh,“ sagte sie froh. „Mein Mann hat es selbst angeboten.“ –
Der Oberleutnant begrüßte den Schwager mit warmer Herzlichkeit. Bald darauf brachen die Geschwister auf, gingen die Straße hinunter, bis sie deren Kreuzungspunkt mit der Wangenheimstraße erreicht hatten, wo sie in diese einbogen.
„Der Weg in die Neue Welt, die von uns doch nur durch eine Mauer getrennt ist, ist etwas weit,“ meinte Traude.
Presterloh ging auf diese Worte nicht weiter ein, da er gerade der Schwester von seiner neuen Bekanntschaft hatte Mitteilung machen wollen.
„Denk’ dir, Kleines, ich habe gestern nachmittag durch Rutterheims im Zoologischen Garten eine Familie Oppener kennen gelernt, Vater, Mutter und Tochter, – sehr nette Menschen. Der alte Herr ist Ministerialdirektor und Exzellenz. Das Merkwürdige aber – wir wohnen auf demselben Flur. Rechts hause ich in dem vorzüglichen Fremdenheim der Frau Major von Krusius, links Oppeners. Fräulein Oppener – sie heißt Edith mit Vornamen – war mir keine Fremde mehr. Ich hatte sie bereits an einem Abend in der Nebenloge im Theater gesehen. Sie ist ein rassiges Geschöpf. Wir haben uns sehr gut miteinander unterhalten.“
Traude hob jetzt die Hand und deutete nach vorwärts.
„Die Geschwister Palzow erwarten uns schon an der Zauntür, Edgar. – Sieh nur, – all die Beete voller Blumen …! Wie freundlich das wirkt …!“
„Die Neue Welt zeigt sich von einer ganz annehmbaren Seite,“ lächelte Presterloh. „Schau – der Fritz Palzow plündert noch schnell einen Frührosenstrauch. Ob er dich etwa mit Blumen empfangen will? – Das wäre etwas unangebracht, doch jedenfalls gut gemeint.“
Aber der Oberleutnant hatte sich geirrt. Der junge Mechaniker wußte sehr wohl, daß es ihm leicht als Aufdringlichkeit und zu große Vertraulichkeit hätte ausgelegt werden können, wenn er die Rosen überreichte. Er war gesellschaftlich durchaus nicht so ungewandt, wie Presterloh anzunehmen geneigt schien. Im Gegenteil, er besaß neben einem stark ausgeprägten Bildungstrieb auch jenes natürliche Taktgefühl, welches das Sichaneignen von guten Umgangsformen so sehr erleichtert. Und hierzu hatte er reichlich Gelegenheit in allerlei Vereinen gehabt, bei denen er Mitglied geworden war, um seine Allgemeinbildung zu erweitern.
Als Traude und Edgar daher die Zaunpforte der Gärtnerei erreicht hatten, war es Hildegard Palzow, die bei der Begrüßung Presterlohs Schwester die Blumen mit ein paar passenden Worten übergab.
Zunächst suchten die vier Menschen, die ein Zufall vor wenigen Tagen zusammengeführt hatte, die Werkstatt des jungen Mechanikers auf, wo dieser ganz eingehend das mitten in dem großen Raum stehende halbfertige Modell der Flugmaschine, das über zwei Meter breite Tragflächen hatte, erläuterte.
Presterloh war äußerst überrascht über die geradezu peinlich saubere Arbeit und die vielfachen Abweichungen, die das Modell gegenüber den bisherigen Flugzeugen aufwies.
Auch Traude gewann sehr schnell Interesse an diesen rein technischen Erklärungen. Bisher hatte sie dem Flugsport, der in wenigen Jahren so glänzende Fortschritte gemacht hatte, keinerlei Teilnahme entgegengebracht. Jetzt erfuhr sie in einem sehr übersichtlichen, kurzen Vortrag aus dem Munde Fritz Palzows nicht nur das Notwendigste aus der Geschichte der Flugmaschinen, sondern auch in leicht faßlicher Form die wesentlichen Einzelheiten über die verschiedenen physikalischen und mechanischen Gesetze, die ein Aeroplankonstrukteur zu berücksichtigen hatte. Sie war ehrlich erstaunt über die vielseitigen Kenntnisse, die der Mechaniker besaß, nicht minder über seine gewandte Ausdrucksweise und sein sicheres, wenn auch bescheidenes Auftreten.
Man merkte sofort, daß dieser Palzow, der zu alldem noch über eine so ansprechende äußere Erscheinung verfügte, ein Mann war, der wußte, was er wollte und der mit eiserner Energie sich vorwärts zu bringen suchte. In seinem blauen, gut sitzenden Jackenanzug, den braunen Schuhen und der tadellos weißen Wäsche unterschied er sich in nichts von den Angehörigen jener Gesellschaftsklassen, die nur zu oft mit einer ganz unangebrachten Überhebung über den durch seiner Hände Arbeit sich sein Brot Verdienenden hinwegsehen.
Nachher, als Presterloh bei der Besichtigung der Blumenschätze der Gärtnerei Hilde ganz mit Beschlag belegt hatte, erfuhr Traude dann auch, daß Fritz Palzow das Gymnasium bis Untersekunda besucht, beim Einjährigen-Examen aber zweimal schmähliche „durchgeplumpst“ war, wie er lächelnd sich ausdrückte.
„Ich habe dies nie bedauert, gnädige Frau, nie!“ fügte er eifrig hinzu. „Mein Vater hätte mich sicherlich in irgend eine Beamtenlaufbahn hineingezwängt, wenn ich die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst gehabt hätte. Und zum Beamten würde ich nie getaugt haben, nie! Schon als Knabe habe ich mir allerlei mechanisches Spielzeug angefertigt. Dies war doch eigentlich schon ein genügender Hinweis, welcher Beruf am geeignetsten für mich erschien. Aber mein seliger Vater hatte, wie er sagte, höhere Pläne mit mir. Nun – als Bureaumensch wäre ich sicherlich nicht über die übliche Laufbahn hinausgekommen, als Erfinder dagegen hoffe ich zuversichtlich, mir eine angesehene Stellung im Leben zu schaffen.“
Traude mußte unwillkürlich mehr als einmal verstohlen den Mann an ihrer Seite mustern. Mit seinem regelmäßigen, frischen Gesicht, das besonders in dem Bau der Kinnpartie und dem lebhaften Blick, der zuweilen etwas geradezu Bezwingendes hatte, soviel zielbewußte, wohl auch etwas rücksichtslose Energie verriet, und mit diesem klangvollen, schmiegsamen Organ stellte er eine Persönlichkeit dar, die in jedem Kreise schnell Beachtung finden mußte. –
Jetzt waren Traude und Fritz Palzow vor einer Spalierobstreihe stehen geblieben, die nach den angesetzten Früchten einen guten Ertrag versprach.
„Sehen Sie sich diesen einen, fast winzigen Stamm an, der im Verhältnis zu seiner Größe eine weit reichere Ernte verheißt als mancher hochragende Baum, gnädige Frau,“ meinte der junge Erfinder, indem er auf den betreffenden niedrigen Stamm hinwies. „Auch im menschlichen Leben kann man nur zu oft eine ähnliche Beobachtung machen. Da gibt es auch viele Leute, die den Kopf sehr hoch tragen und doch so wenig leisten, während oft genug gerade die bescheidenen Naturen, die Kleinen, diejenigen sind, von denen große, weltbewegende Gedanken ausgehen.“
Traude lächelte. Und dann sah sie geradezu liebreizend aus. Ihre Augen begegneten denen Fritz Palzows und hielten deren Blick fest, während sie sagte:
„Also mit solchen Gedanken geben Sie sich auch ab?! Wirklich, ich bewundere Ihre Vielseitigkeit.“
Palzow sah eigentlich erst jetzt, wie schön Traude Karsten war. Er wurde verwirrt. Damals, als er sie vor der grünen Wand zum ersten Mal erblickt hatte, stand in ihren Zügen zumeist nur nachdenklicher Ernst zu lesen. Jetzt schimmerte in diesen leuchtenden, ausdrucksvollen Augen etwas anderes, – ein unbestimmtes Sehnen, ein Hoffen auf des Lebens herrlichste, irdische Freuden.
Um seine leichte Verlegenheit zu verbergen, erwiderte er nun:
„Zum Glück bin ich nicht so vielseitig, um mich vielleicht zu zersplittern. Auch Genies sind schon an dieser Gefahr vielseitigen Könnens gestrauchelt.“
Er hatte dabei den Kopf gesenkt und spielend ein Blatt abgerissen, das er nun zerpflückte.
Einer Eingebung folgend, streckte ihm Traude die Hand hin.
„Ich will Ihnen jetzt sofort herzlich für diese Stunde danken, in der ich so viel gelernt habe, und ich wünsche Ihnen gleichzeitig von Herzen, daß Ihnen Ihre Pläne gelingen möchten.“
Ihre Hände ruhten ineinander. Und Traude fühlte den festen Druck dieser arbeitsgewohnten, geschickten Finger. Das war Kraft – das war Gesundheit …!
Und wieder kroch die seltsame Unruhe ihr zum Herzen. Schnell machte sie ihre Hand von der seinen frei, von der ein aufreizender Strom in ihren Körper überzufließen schien. Eine Glutwelle schoß ihr in die Wangen, ihr Blick verschleierten sich …
Und Palzow dachte: „Welch’ schönes Weib …! Und welch’ bedauernswertes Wesen! Dieses Schicksal zu tragen, an einen siechen Mann bei so viel verheißungsvoller Frische gekettet zu sein, dazu muß eine seltene Seelengröße gehören.“
Hilde und Presterloh gesellten sich ihnen wieder zu. Der Zauber dieser Minuten war gebrochen. Aber Fritz Palzow vergaß ihn nicht, ließ ihn in sich fortwirken wie eine wunderbare Erinnerung.
Als Traude und der Oberleutnant dann gegangen waren, fragte Hilde den Bruder, indem sie sein versonnenes Gesicht prüfend musterte:
„Wie gefällt dir Presterlohs Schwester, Fritz?“
„Ein prächtiges Geschöpf!“ erwiderte er nachdenklich. Und er dachte daran, wie schroff sie ihm mit einem Mal ihre Hand entzogen hatte. Warum wohl nur – warum?
„Und was sagst du deinerseits zu dem Oberleutnant?“ fügte er nach einer Weile hinzu.
„Er ist der erste Adlige, mit dem ich Gelegenheit hatte, mich ungezwungener zu unterhalten. Wenn sie alle so sind wie er, dann begreife ich das Vorurteil nicht, das in vielen Schichten der Bevölkerung gegen den Adel herrscht.“
7. Kapitel.
Berta Karsten glitt lautlos wie immer in die Veranda, wo der Krankenstuhl an seinem gewöhnlichen Platz am Fenster stand. Der Pfleger war soeben für kurze Zeit hinausgegangen.
„Du solltest an die frische Luft, Max,“ sagte Berta, indem sie dem Bruder liebkosend über das Haar strich.
Der Gelähmte erschrak heftig. Er hatte die Schwester nicht kommen gehört, da er in Gedanken wieder einmal seinen eigenen dunklen Schicksalswegen nachgespürt hatte.
Langsam hob er den Kopf. In diesen zwei Wochen, die seit der Ankunft Edgar Presterlohs vergangen waren, war sein Gesicht merklich blasser und magerer geworden.
„Darf … ich … dich … um eins bitten, Berta,“ brachte er mühsamer als sonst hervor. „Deine geräuschlose Art … hat nichts Angenehmes für mich. Ich schrecke regelmäßig … zusammen, wenn du mich so unerwartet ansprichst. – Und, was die frische Luft … anbetrifft, – der Aufenthalt im Garten … macht mich stets so müde und matt …“
„Lieber Max, das bildest du dir ein. Heute ist es hier in der Veranda sehr drückend. Ich werde dich ein wenig im Garten spazieren fahren.“
Er erhob weiter keinen Einspruch. Sie wollte ja nur sein Bestes. Hätte er jedoch das böse Lächeln gesehen, das um ihre dünnen Lippen spielte, so wäre er wohl doch stutzig geworden.
Über die Stufen der Verandatreppe war eigens zum leichteren Hinausbringen des Krankenstuhles eine Bahn aus hellgrau gestrichenen Brettern an der einen Seite angelegt worden. Mühelos vermochte Berta Karsten daher den Bruder hinab in den Garten zu schaffen.
Aus ihrem ganzen Tun ging deutlich eine gewisse nervöse Unruhe hervor. Sie schien es eilig zu haben, dem Kranken die ihrer Ansicht nach bekömmlichere Luft unter den grünen Bäumen zuteil werden zu lassen.
„Besonders kühl ist es hinten im Garten,“ meinte sie halblaut, indem sie den leicht dahingleitenden Fahrstuhl immer schneller vor sich her schob.
Dann schwieg sie wieder.
Max Karstens Gesichtsausdruck verriet eine sich steigernde Ängstlichkeit. Mit dem feinen Gefühl, das gerade Kranken eigen ist, ahnte er irgend welche Unannehmlichkeiten, irgend eine schlimme Überraschung, die die Schwester ihm bereiten wollte. Inzwischen hatte er doch gemerkt, daß Berta heute eine bestimmte Absicht mit ihrer Fürsorge für ihn verband. Die Hast fiel ihm auf, mit der sie ohne weiteres Wort der Rückwand der langgestreckten Scheune zustrebte.
Vor ihnen ertönten jetzt Stimmen. Die Personen, die sich da hinter den Büschen laut unterhielten, ahnten offenbar nicht, daß jemand in der Nähe sei.
Berta hatte den Krankenstuhl bis dicht an die alte Kastanie gebracht. Hier machte sie halt, beugte sich, die Erstaunte spielend, zu ihrem Bruder herab und flüsternde ihm zu:
„Das ist ja Gertraud … Mit wem spricht sie nur …?! Presterloh ist doch heute vormittag nicht hier.“
Die Worte und Sätze, die die beiden hinter dem grünen Blättervorhang Verborgenen wechselten, waren ganz deutlich zu verstehen.
Eine kräftige, wohllautende Männerstimme sagte gerade mit heiterem Auflachen:
„Oh, gnädige Frau, wirklich – Sie halten mich nicht von der Arbeit ab! Nachher geht es stets um so flotter, wenn Sie mir einen noch so kurzen Gedankenaustausch gegönnt haben. Es ist das eine Anregung für mich, wie ich sie besser nicht finden kann.“
„Nun, wenn es sich so verhält …!“ äußerte sich Traude darauf. „Das ändert die Sache. – Wie war’s denn gestern im Theater …?“–
Max Karsten drehte den Kopf etwas zur Seite, damit seine hinter ihm stehende Schwester ihn besser verstehen könne.
„Bringe mich fort …! Ich mag nicht den Horcher spielen …!“ sagte er ungeduldig.
Ihre Lippen verzogen sich, und sofort setzte sie den Krankenstuhl wieder in Bewegung, – aber nach vorwärts, bog um das Gebüsch herum und hatte dann die schadenfrohe Genugtuung, daß Traude mit einem Schrei des Schreckens herumfuhr, als die beiden so unvermutet neben ihr auftauchten.
Max Karsten hatte mit schnellem Blick den hübschen Männerkopf dort oben zwischen den Ranken der grünen Wand gestreift. Sein Herz krampfte sich zusammen … War es ihm doch nicht entgangen, daß sein Weib in letzter Zeit mit so ganz anderen Augen, mit so viel frischeren Bewegungen durch das Haus schritt, – daß sie aber auch für ihn immer weniger freie Zeit fand. –
Damals, als sie von dem Besuch in der Scheunenvilla, von dem jungen Erfinder und dessen Werk ihm berichtet, als sie auch nochmals gebeten hatte, daß die eine Fensteröffnung in der grünen Wand bestehen bleiben dürfte, da bereits war in Max Karstens Seele die leise Angst aufgekeimt, daß es nun mit der friedlichen Ruhe ihres weltabgeschiedenen Daseins vorbei sein könnte und daß hier Ereignisse sich vorbereiteten, denen er machtlos gegenüberstand.
Traude hatte die etwas schuldbewußte Überraschung schnell überwunden. Bevor sie jedoch noch das Wort ergreifen konnte, sagte Berta Karsten schon spitzt:
„Siehst du, lieber Bruder, das kommt dabei heraus, wenn man an gewissen Einrichtungen etwas ändert!“
Dabei zeigte sie mit der Hand nach dem Männerkopf hin, der mitten in der grünen Fläche eigenartig genug wirkte.
Fritz Palzow hatte sich nämlich nicht etwa beim Erscheinen der Geschwister Karsten zurückgezogen. Nein – ihm war es sogar sehr lieb, daß er auf diese Weise Gelegenheit fand, dem Besitzer des Nachbarhauses seinen Dank abstatten zu können.
In seiner freimütigen Art rief er jetzt hinunter:
„Herr Karsten, Sie waren so gütig, mir ein wenig mehr frische Luft und Licht zu gönnen, als ich bisher hier oben in meinem Stübchen gehabt habe. Ich danke Ihnen herzlich dafür.“
Der Kranke hob matt die Hand und winkte dem jungen Mechaniker gütig lächelnden zu, worauf dieser mit einem höflichen: „Ich will die Herrschaften nicht länger stören …“ verschwand.
Berta merkte, daß auch dieses von ihr absichtlich herbeigeführte Zusammentreffen nicht die Wirkung auf ihren Bruder ausübte, die sie sich davon versprochen hatte. Deshalb suchte sie das Feuer durch stärkere Mittel zu schüren und sagte überlaut, fast schreiend:
„Ob es gerade sehr passend ist, liebe Gertraud, daß du dich hier so häufig mit dem Arbeiterstande angehörigen Menschen unterhältst, erscheint mir doch recht fraglich. Ich habe eigentlich angenommen, eine geborene Gräfin Presterloh würde etwas wählerischer in der Auswahl ihrer Freunde sein.“
Max Karsten sah eine heftige Szene zwischen den beiden Frauen voraus. Hatte doch Traude bei diesem höhnischen Angriff nicht etwa schüchtern wie sonst den Kopf gesenkt, sondern ihre Gegnerin mit kampfeslustigen, drohenden Blicken gemustert. Auch die plötzliche Blässe ihres Antlitzes deutete auf ein heraufziehendes Gewitter hin.
Er beeilte sich daher vermittelnd einzugreifen, um das Ärgste, einen völligen Bruch zwischen den Frauen, zu verhüten.
„Du … vergißt …, daß … Palzow ein alter Bekannter von Edgar ist, liebe Berta, … und daß er bereits weit über seine ursprüngliche Berufsstellung … hinausgewachsen ist. Ich finde nichts dabei, wenn … meine Frau gelegentlich … ein paar Worte … mit dem jungen Manne wechselt.“
So sprachen Max Karstens Lippen, um sein Weib gegenüber den spitzen Bemerkungen der Schwester in Schutz zu nehmen. Aber sein Herz dachte anders … Daß Traude heute nicht zum ersten Mal vor der grünen Wand gestanden und sich mit diesem blühend frischen, hübschen Menschen unterhalten hatte, war ja nun offenbar geworden. Und tiefer und tiefer fraß sich die Angst in die Seele des armen Gelähmten fest, ihm könnte auch noch das Letzte verloren gehen, was ihn dieses klägliche Dasein lebenswert machte – die Frau, die er mit jeder Faser seines Herzens liebte und nur deren Nähe ihn schon mit Glückseligkeit erfüllte.
Inzwischen hatte Traude die heftige Erregung, aus der heraus sie der Schwägerin vielleicht zum ersten Mal eine gebührende Antwort gegeben hätte, zurückgedrängt. Nein – diese Berta war nicht wert, sich mit ihr in einen Wortwechsel einzulassen. Und so erwiderte sie denn der mit hohnvollem Lächeln Dastehenden kalt und sogar etwas hochmütig:
„Eine geborene Gräfin Presterloh weiß stets, was sie tut, davon kannst du überzeugt sein.“
Dann trat sie hinter den Fahrstuhl.
„Gestattest du, lieber Max, daß ich dich mehr in den Schatten schiebe. Dieser Platz ist nicht sehr geeignet für dich.“ –
Berta hatte auch diese Partie wieder verloren. Wortlos ging sie davon und suchte Trost bei der alten Amanda in der Küche, der sie das eben Geschehene haarklein erzählte.
„Er ist eben blind – vollständig blind!!“ fügte sie mit zitternder Stimme hinzu. „Oh – wie ich diese Person hasse …!! Mit ihren schönen Augen richtet sie all das Unheil an …! Aber noch gebe ich den Kampf nicht auf!“ –
Und zu derselben Zeit sagte Traude zu ihrem Gatten:
„Ich danke dir von Herzen, daß du mich deiner Schwester gegenüber in Schutz genommen hast. Alles, was jung ist, haßt sie …, alles; für Jugend hat sie kein Verständnis.“
Max Karsten suchte nach ihrer Hand, die sie ihm willig überließ.
„Sie war stets … ein seltsam verschlossenes, verbittertes Wesen, schon als Kind,“ meinte er. „Ein etwas schwieriger Charakter … Es wäre besser, sie hätte … ihre eigene Häuslichkeit …“
Traude nahm diese letzte Bemerkung als eine versteckte Anfrage hin, ob es ihr vielleicht lieber wäre, wenn die Schwägerin das Haus verließe. Das wollte sie jedoch nicht. Jedenfalls würde sie ihrerseits nichts dazu beitragen, die gehässige Berta zu entfernen. –
Und so erwiderte sie nun:
„Hierüber mußt du dir selbst klar werden …“
Und dann sprachen sie von anderen Dingen. Max Karsten aber merkte sehr bald, daß sein Weib mit ihren Gedanken weit, weit fort war …, oder besser – – jenseits der grünen Wand weilte, wo die Jugend, die Gesundheit und die Kraft wohnten. Ihr verträumter Blick, ihre zerstreuten Antworten, das Schleppende in ihrer Sprache verrieten es ihm.
* * *
Gleich nach Tisch machte Berta Karsten sich zum Ausgehen fertig. Sie wollte eine Freundin besuchen, die in der Nähe des Zoologischen Gartens wohnte.
Auf dem Wege nach der nächsten Haltestelle der Straßenbahn bemerkte sie Fritz Palzow, der wenige Schritte vor ihr dahinschritt. Nachher benutzte er, ohne sie gesehen zu haben, dieselbe Elektrische. Berta saß im Motorwagen, der Mechaniker im Anhänger.
Am Großen Stern im Tiergarten gab es eine längere Verkehrsstockung. Das magere Fräulein Karsten war hierüber sehr ungehalten. Um sich abzulenken, betrachtete sie die zahlreichen Spaziergänger, die der schöne Sommertag in die schattigen Alleen des großen Parkes gelockt hatte.
Mit einem Mal stutzte sie. – War das nicht Edgar Presterloh …? – Natürlichen …! – Und an seiner Seite ging eifrig plaudernd – Berta riß ordentlich die Augen vor Interesse auf! – niemand anders als Hildegard Palzow, die sie von Ansehen ganz gut kannte.
Oh – die Sache versprach ja recht spannend zu werden, denn nun bemerkte sie auch den Mechaniker, der das Paar offenbar ebenfalls erspäht hatte und den beiden als für den guten Ruf seiner Schwester ängstlich besorgter Bruder heimlich folgte.
Berta überlegte nicht lange. Was machte es ihr aus, ob sie eine Stunde später zu ihrer Freundin kam …?! Hier gab es vielleicht recht wertvolle Dinge auszukundschaften. Das Spionieren und Ränkeschmieden lag der dürren alten Jungfer ja nun einmal im Blut.
Hastig stieg sie aus und schlenderte einige Schritte hinter Fritz Palzow her. Die Promenade war so belebt, daß sie nicht zu fürchten brauchte entdeckt zu werden, selbst wenn er sich einmal zufällig umdrehen sollte. –
Hm – was tat dieser Palzow jetzt überhaupt hier …? Amanda hatte ihr doch erzählt, er arbeite nachmittags immer bei der A.E.G. …! Und nun spielte er hier den Müßiggänger?! Sonderbar …!
Von Edgar und dem jungen Mädchen bekam sie seltener etwas zu sehen, da Fritz Palzow sich von diesen in vorsichtiger Entfernung hielt.
In gemächlichem Tempo näherten die drei Parteien sich dem Brandenburger Tor, schritten dann die Linden hinab und bogen rechts in die Friedrichstraße ein.
* * *
Als Berta Karsten gegen sechs Uhr nachmittags nach Hause zurückkehrte, war ihr erster Gang zu ihrer Verbündeten in die Küche.
Amanda trank gerade zum dritten Mal Kaffee. Für dieses Getränk, dem sie stets eine große Menge Zichorie beimengte, schwärmte sie wie alle Küchenfeen. Heute hatte ihr es besonders gut gemundet, weil sie die Abwesenheit des geizigen Fräulein Berta dazu benutzt hatte, sich noch ein paar Kartoffelpuffer zu backen.
Berta sog sofort argwöhnisch die Luft ein, als sie die Küche betrat, aus der der Bratendunst sich trotz der offenen Fenster noch nicht völlig verzogen hatte. Aber sie sagte nichts, obwohl ihre Nase ihr das Richtige verriet.
Sie setzte sich etwas erschöpft auf den Stuhl am Fenster und begann sofort leise:
„Ich habe heute großes Glück gehabt, Amanda. Denken Sie nur, was mir passiert ist.“
Amanda schüttelte empört den Kopf, nachdem die Schwester des Hausherrn ihre Neuigkeit ausgekramt hatte.
„Scheint ja eine nette Pflanze zu sein, dies Fräulein Palzow. Sich sofort mit dem Oberleutnant einzulassen!!“
Berta zuckte die Achseln.
„Was die beiden treiben, ist mir herzlich gleichgültig. Viel wichtiger ist mir der Fritz Palzow. – Sehen Sie, Amanda, – bei einem solchen Kampf, wie wir ihn gegen mit Schönheit ausgerüstete weibliche Raffiniertheit, nämlich meine liebe Schwägerin führen, ist die Hauptsache, daß man alle Schwächen des Feindes kennt. Mithin müssen wir uns auch näher mit dem Mechaniker beschäftigen. Der Mensch spielt ja jetzt schon in unseren Plänen eine gewisse Rolle. – Also – was hatte er in jenem alten Hause zu suchen …?! Eine halbe Stunde habe ich gewartet, ob er nicht wieder auf der Straße erscheinen würde. Er kam nicht. Da gab ich schließlich die Sache auf. – Aber ich habe hierüber so meine Vermutung. Kann man wissen, ob er sich dort nicht heimliche Stelldicheins mit einer uns nicht ganz unbekannten Dame gibt, die seit der Anwesenheit ihres Bruders hier in Berlin schon ein paar Mal nachmittags sich angeblich mit dem Grafen treffen wollte …?! Muß es nun gerade der Graf gewesen sein, oder besser – der Graf allein gewesen sein?! Man kann auch zwei Stelldicheins an einem Nachmittag erledigen.“
Amanda hatte sich durch einen erneuten Schluck Kaffee gestärkt.
„Hm – aber die gnädige Frau ist doch heute gar nicht ausgegangen?! Sie sitzt mit dem Herrn im Garten,“ sagte sie zweifelnd.
„Sehr richtig! – Wahrscheinlich habe ich eben durch meine Fahrt nach der Stadt, zu der ich mich erst mittags entschloß, ihre Pläne gestört. – Mag dem sein, wie ihm wolle, – wir müssen herausbekommen, was der Palzow dort in jenem Hause in der Straße am Königlichen Marstall treibt. Heute habe ich den Aufpasser gespielt, Amanda. Morgen tun Sie es! Morgen will nämlich Traude sicher nach der Stadt.“
8. Kapitel.
Am folgenden Tage verabschiedete Traude sich gleich nach dem Mittagessen von ihrem Manne.
„Vergiß … bitte … nicht, mir einen … Führer durch die Ausstellung mit … zubringen,“ sagte Max Karsten, als sie bereits der Tür zuschritt.
„Ich werde daran denken – keine Sorge!“
Sie nickte ihm nochmals zu und ging dann durch den Vorgarten auf die Straße hinaus, indem sie ihre weißen Glanzlederhandschuhe überstreifte.
Der Himmel war heute leicht bewölkt. Trotzdem lagerte eine drückende Schwüle über der Erde, eine feuchtwarme, schwerere Luft, die sich beklemmend auf die Brust legte und das Atmen fast behinderte.
Traude schritt ganz langsam mitten auf dem Fahrweg entlang. An der Einmündung der Wangenheimstraße machte sie ohne bestimmten Zweck einen Augenblick halt und schaute nach der Scheunenvilla hinüber. Dann setzte sie ihren Weg fort. Wäre sie noch eine halbe Minute stehen geblieben, so hätte sie Fritz Palzow sehen müssen, der den Garten verließ und ihr nun auf vielleicht zweihundert Meter Entfernung folgte.
Sehr bald hatte er sie mit seinen scharfen Augen erspäht. Er beschleunigte seine Schritte. Dann hatte er sie eingeholt, zog den weißen Strohhut und wollte mit einem „Guten Tag, gnädige Frau“ an ihr vorüber.
Doch sie sprach ihn an, streckte ihm die Hand hin und forderte ihn auf, ihr Gesellschaft zu leisten.
„Bis zur Haltestelle haben wir ja wohl denselben Weg. Und Sie müssen mir auch noch erzählen, wie weit Sie mit Ihrem Modell sind. – Denken Sie, Herr Palzow, Edgar und ich wollen heute in die Ala, die Allgemeine Luftschifffahrt-Ausstellung, besuchen. Noch vor vier Wochen hätte ich dafür nicht das geringste Interesse gehabt. Das ist jetzt anders geworden, seit Sie mir damals Sonntags vormittags die Entwicklungsgeschichte unseres modernen Flugwesens so hübsch übersichtlich geschildert haben.“
„Sie werden mich wirklich noch eitel machen, gnädige Frau,“ sagte er scherzend. Aber Traude merkte doch, daß seinem Benehmen heute das Ungezwungene, Freie und Natürliche fehlte, das so sehr für ihn einnahm und das unwillkürlich den Eindruck großer gesellschaftlicher Sicherheit hervorrief.
Auch durch die nun folgende Unterhaltung verstärkte sich bei Traude das Empfinden, daß Fritz Palzow irgend etwas bedrückte, das notwendig mit ihrer Person in Zusammenhang stehen müsse.
Schließlich fragte sie ihn dann ganz offen danach. Sie waren mittlerweile der Haltestelle der Straßenbahn schon recht nahe gekommen, und der junge Erfinder erwiderte daher auch schnell:
„Sie haben nicht ganz unrecht, gnädige Frau. Es bedrückt mich wirklich etwas. Aber in wenigen Sekunden – dort hinten taucht bereits die Straßenbahn auf – kann ich mir mein Herz nicht entlasten, obwohl es mir sehr lieb wäre, wenn ich Sie ins Vertrauen ziehen könnte.“
„Nun – dann gehen wir eben noch ein Stück zu Fuß. Das ist doch sehr einfach. Falls Sie natürlich Zeit haben.“
„Ich danke Ihnen. Zeit habe ich schon.“ Und nach kurzer Pause fügte er hinzu: „Es handelt sich um meine Schwester Hilde, gnädige Frau, – – ja, um Hilde und um Ihren Herrn Bruder, den ich so sehr verehre. Gerade weil ich dies tue, ist es mir doppelt peinlich, ihn dringend bitten zu müssen, die heimlichen Zusammenkünfte mit meiner Schwester, bei denen nichts Ernstes herauskommen kann, zu unterlassen. Ich habe erst gestern die beiden zufällig im Tiergarten getroffen. Als ich meine Schwester dann nachher zu Hause zur Rede stellte, gab sie offen zu – denn lügen mag sie nicht, – daß sie schon häufiger mit dem Herrn Grafen sich verabredet gehabt hätte. – Sehen Sie, gnädige Frau, Hilde ist jung und ein sehr temperamentvoller Charakter, auch recht reif in ihren ganzen Anschauungen. Als ich ihr nun vorhielt, daß ihr Ruf darunter leiden könne, wenn sie des öfteren mit einem Offizier in Zivil zusammen gesehen würde, gab sie mir eine Antwort, die mich geradezu erschreckte. – Darf ich ganz freimütig weitersprechen, gnädige Frau?“
„Natürlich. Ich bitte sogar sehr darum.“ Und Traude fügte in Gedanken leicht empört hinzu: „Wie kann Edgar nur! Er erweckt vielleicht in diesem hübschen Mädchen allerlei Hoffnungen, die nie in Erfüllung gehen können. Auf eine bloße Liebelei würde sich Hilde Palzow wohl nie einlassen!“
„Ja, eine Antwort gab Hilde mir, die ungefähr folgendermaßen lautete“, fuhr Fritz fort – –: „„Ich will meine Jugend nicht ungenutzt vorübergehen lassen, will wenigstens einmal ein wenig jenes große Glück genießen, was uns Frauen nur der geliebte Mann schenken kann. Unrechtes werde ich nie tun. Und wenn dann alles wieder aus ist, dann habe ich wenigstens eine einzige Erinnerung für mein späteres Leben, die mein Herz schneller schlagen läßt, dann habe ich wenigstens für ein paar kurze Wochen gefühlt, wie reich unser Dasein sein kann …“ – Meine Warnung, daß eine solche reine Freundschaft mit einem weit über ihr stehenden Herrn – ich betone: reine Freundschaft, denn wegwerfen wird sich Hilde niemals! – ihr die Zukunft verbittern, sie unzufrieden und wohl gar unglücklich machen könne, schlug sie in den Wind. „Laß mir doch diese harmlose Freude, Fritz,“ sagte sie mit feucht schimmernden Augen. „Nachher, wenn etwa Presterloh Berlin und Europa wieder verlassen hat, werde ich ganz still und bescheiden meine Pflicht weiter tun wie bisher. Nur reicher werde ich sein – in meinem Innern. Das Bewußtsein, die Vertraute eines Mannes, wie Presterloh es ist, gewesen zu sein, wird mich mit Stolz und Genugtuung erfüllen und mir eine Erinnerung bleiben, von deren Schönheit ich noch lange zehren kann.“ – – Ich befinde mich nun in einer sehr schwierigen Lage, gnädige Frau. Sie werden das begreifen. Hilde scheint die Tragweite einer solchen Neigung, wie sie offenbar schon bei ihr besteht, gar nicht abschätzen zu können – oder will es nicht. Sie hat nun einen Bewerber, der seiner Stellung nach für sie paßt. Und meine liebe Mutter und ich fürchten jetzt mit Recht, daß ihr dieser Mann noch weniger genügen wird als bisher, wenn sie erst Ihren Herrn Bruder lieben gelernt hat, – eine Liebe, die doch ganz aussichtslos ist.“
Traude reichte Fritz Palzow spontan die Hand, indem sie stehen blieb und ihn ernst anschaute.
„Ich werde mit Edgar sprechen. Er wird einsehen, daß er Ihrer Schwester nur schaden kann. Verlassen Sie sich ganz auf mich.“
„Ich danke Ihnen von Herzen, gnädige Frau.“ – Er hatte ihre Hand in der seinen behalten. Und wie zu sich selbst sprechend fügte er hinzu: „Es ist traurig, daß zwei Menschen nur zu häufig in diesem unvollkommenen Leben sich voneinander losreißen müssen, weil sich allerlei Hindernisse zwischen ihnen auftürmen: Herkunft, Name, Geld – oder besser gesagt: Armut!“
Unwillkürlich hatte er ihr bei diesen Worten mit traurigen Augen ins Gesicht geblickt. Da errötete sie. Ihre Blicke waren für einen Moment ineinander getaucht. Es war nicht nur schmerzliches Entsagen, das in den seinen sich ausdrückte. Es war auch ein heimliches Feuer darin, das zu ihr hinüberleuchtete und ihre Seele wie durch einen zuckenden Blitz erhellte … – Liebte Fritz Palzow sie etwa? War er deswegen so oft oben an dem Fenster der grünen Wand erschienen, wenn sie sich im Garten zeigte …?
In holder Verwirrung entzog sie ihm jetzt sacht ihre Hand, aus der in ihren Körper etwas Besonderes überzufließen schien, das sie unruhig machte. Und wieder fühlte sie jetzt jene seltsame Unrast, jenes rätselhafte Drängen und Wogen in ihrem Herzen, als gehe darin etwas Wunderbares vor. Plötzlich befiehl sie eine unerklärliche Angst … Nur fort von ihm, nur allein sein …!
Sie winkte schnell ein gerade vorüberkommendes Auto herbei, stieg ein, sagte Palzow kurz Lebewohl und fuhr davon.
Der Kraftwagen glitt weiter und weiter. Und Traude lehnte in den Polstern mit gesenktem Kopf, verträumten Augen und zitternden Nerven. Ihre Wangen waren blaß. Und wieder und wieder überlegte sie sich, weshalb sie so unvermittelt vor Fritz Palzow geflohen war, vor diesem frischen, heiteren Menschen, der schon mehr wie einmal sein reiches Innenleben ohne Scheu vor ihr ausgebreitet hatte, das zu seiner äußeren Erscheinung nur zu gut paßte …
Die grüne Wand hatte jedes Wort als einzige Zeugin mit angehört, das zwischen ihnen gewechselt worden war. Und Worte und Sätze waren es gewesen, die eine Brücke zwischen zwei Menschen schlugen, auf der sie innerlich, ihnen selbst unbewußt, sich näher und näher kamen …
Traude schloß jetzt plötzlich die Augen … Marternde Angst war abermals in ihr aufgestiegen, diese bebende Scheu vor den eigenen Gedanken. Nur nicht weiter sich einspinnen in all die harmlosen Erinnerungen, die sie mit diesem Manne gemeinsam hatte, den sie jetzt kaum drei Wochen kannte. Nur nicht an seine Augen denken, aus denen ihr heute ein heißes Wünschen entgegengestrahlt und ihre Seele in Aufruhr versetzt hatte … –
Wie ein Schauer ging es über Traudes Körper hin … Daheim der kranke, sieche Gatte, der nicht ihr Gatte war, und hier wie ein Gespenst immer das Bild des anderen … Sie schluchzte auf … Sie fand sich nicht mehr zurecht in ihrer eigenen Seele … –
Und dann etwas Neues wie ein rettender Haken, – ein Name: Rau–heim – Rauheim! Edgar wollte dorthin zur Kur. Und Max Karsten sollte mit ihr gleichfalls nach Rauheim! Fliehen wollte sie …! Es mußte sein …! –
* * *
„Bitte, nimm Platz, Kleines. Ich bin sofort fertig. Dann geht’s in die Ala …“
Er schob ihr einen Klubsessel hin.
Die Nachmittagssonne fiel in breiten Strahlen durch die beiden Fenster auf den bunten Perser, der den Boden von Edgar Presterlohs Wohnzimmer bedeckte. Die Räume in dem Fremdenheim der Frau Major von Krusius waren sämtlich vornehm und behaglich eingerichtet. Freilich – man mußte dafür auch gehörig bezahlen. Aber wohl fühlte man sich hier – wie im eigenen Hause.
„Hör’ mal Hascherl, du schaust ja heute so verteufelt ernst drein?!“ meinte er vom Spiegel her, vor dem er sich die Krawatte zurechtzog. Er war wieder in glänzender Laune.
Und Traude dachte jetzt beim Anblick ihres stattlichen Bruders unwillkürlich: „Ist es ein Wunder, daß ihm die Herzen zufliegen …?! Kann man es Hilde Palzow verargen, wenn sie gern mit ihm zusammen ist?!“
„Ich habe auch alle Ursache dazu,“ erwiderte sie nun. „Du solltest nie vergessen, Edgar, daß sehr leicht ein Feuer im Herzen eines Mädchens angezündet, sehr schwer aber wieder auszulöschen ist.“
Er drehte sich mit einem Ruck herum, zog die Augenbrauen hoch und blickte die Schwester fest an.
„Hilde Palzow?“ fragte er kurz.
Traude nickte. –
Ohne ein Wort einzuwenden ließ er darauf ihre Vorhaltungen über sich ergehen. Nur als sie von Hildes ernsthaftem Freier sprach, warf er ein:
„Das weiß ich. Der Mann ist kein Mann, sondern eine Art Rechenmaschine von Fleisch und Blut.“
Als Traude, die sich in einen warmen Eifer hineingeredet hatte, nun schwieg, ging er in dem geräumigen Zimmer erst eine Weile auf und ab, bevor er ihr folgendes erwiderte:
„Ohne Frage hast du mit allem, was du da eben gegen diese Freundschaft vorbrachtest, vollkommen recht. – Zunächst ein Geständnis, Kleines. Wäre Hildegard Palzow vermögend, so würde ich sie heiraten. Sie ist das erste Weib, das mich völlig fesselt, – das erste einer Reihe von Bekanntschaften, die bisweilen recht vertraulicher Art waren. Dein Bruder kann sich ja leider nicht rühmen, in diesem Punkte ein Heiliger gewesen zu sein. – Kurz: ich liebe Hilde tatsächlich. Viel Worte machen oder schwärmen wie ein junger Bruder Studio war nie meine Sache. Wenn ich mich dazu aufschwinge, zu behaupten: „Ich liebe,“ dann ist das ebenso gewiß, wie ich nebenbei leider auch ein armer Teufel bin, der sich gezwungen sieht, nur unter den begüterten Familien Ausschau nach einer Lebensgefährtin zu halten. Mithin: Geld ist das Hindernis! – Wenigstens erklärte ich ihr gestern, als ich sie abends vom Geschäft abholte und mit ihr in einem Taxameter durch den Tiergarten fuhr, wobei sich uns plötzlich wie von selbst das innige „Du“ über die Lippen drängte, weshalb wir uns nicht mehr wiedersehen dürften, eine Eröffnung, die bei ihr erst einige Tränen, dann viele … Küsse zur Folge hatte. – Du siehst also, Kleines, daß auch ich schon gemerkt habe, wie sehr es in unser beider, das heißt in Hildes und meinem Interesse liegt, dieser Freundschaft ein schnelles Ende zu bereiten.“
„Und ihr werdet euch wirklich nicht wiedersehen?“ fragte Traude erleichtert.
„Nein. Dem Zufall können wir freilich nicht gebieten. Aber Verabredungen gibt es nicht mehr. Und ich werde mich sogar ehrlich bemühen, ihr aus dem Wege zu gehen, um uns die Herzen nicht unnötig schwer zu machen. – Ich sage dir, Hascherl, – es war ein trauriger Abschied gestern – sehr traurig. Schweigen wir davon.“
Er war an das eine Fenster getreten und starrte in den Hofraum hinunter, wo das blühende Tulpenbeet in der Mitte in so leuchtenden Farben prangte. Er stand regungslos da. Nur seine Rechte trommelte mit erregten Fingern auf der Scheibe einen Sturmmarsch.
Da sagte Traude leise, und durch diesen gedämpften Ton wollte sie dem Bruder ihr Mitgefühl mit seinen Herzenskämpfen ausdrücken:
„Ich verstehe nur eines nicht. Offenbar hat doch Fritz Palzow gestern abend mit Hilde deinetwegen gesprochen. Wie kommt es aber, daß sie ihm bei dieser Gelegenheit nicht mitgeteilt hat, daß diese aussichtslose Freundschaft zwischen euch mit beiderseitigem Einverständnis für immer ein Ende gefunden hat?! Es liegt doch so nahe, daß sie gerade dieses hätte erwähnen müssen.“
Abermals drehte Presterloh sich jäh nach der Schwester um. In seinem Gesicht war jetzt ein grüblerischer Ausdruck zu bemerken.
„Ja, warum hat sie gerade die Hauptsache verschwiegen, die Fritz doch sofort beruhigt haben würde,“ meinte er langsam. „Hätte sie von diesem endgültigen Auseinandergehen ihm gegenüber etwas erwähnt, so würde er es doch nicht für nötig befunden haben, deine Vermittlung heute in Anspruch zu nehmen …! – Warum schwieg sie also, warum …?“
Er schaute nachdenklich zu Boden.
Da war’s, als ob die Antwort auf diesem Frage von draußen, vom Hofe her gegeben würde …
9. Kapitel.
Ein paar Mandolinenklänge zitterten durch die Luft, drangen durch das zweite, weit offene Fenster in das Zimmer hinein. Und ihnen folgten andere Töne, ein Lied, das gerade zu der Zeit von allen Kaffeehauskapellen gespielt wurde:
„Ich gehe nicht von Dir,
ich lasse Dich nicht
so lange noch Atem in mir
und das arme Herz mir nicht bricht,
ich bleibe stets um Dich,
und wenn in Gedanken auch nur,
das sage ich innig
mit treufestem Schwur …“
Eine volle, wohllautende Männerstimme war’s, die das Lied mit tiefem Gefühl und seltener Weichheit zum Vortrag brachte.
Traude lauschte atemlos. Sie sah, daß es in Edgars scharfgeschnittenem Gesicht, das die Sonne Westafrikas so tief gebräunt hatte, seltsam arbeitete, und daß er die Lippen wie in körperlichem Schmerz zusammenpreßte. Und auch in ihrer Seele zog bei diesem schwermütigen „Ich lasse Dich nicht …“ eine sehnsuchtsvolle Traurigkeit ein. Ihre Augen wurden feucht …
Wie schön, wie ergreifend schön dieser Mann da unten sang …!
Edgar hatte der Schwester inzwischen wieder den Rücken zugekehrt. Jetzt wandte er nur den Kopf nach ihr hin und sagte halblaut:
„Du hast Glück, Kleines. Es ist der blinde Sänger. Ich habe ihn schon einmal gehört. Der Mensch hätte mit seiner prächtigen Stimme auch ein besseres Schicksal verdient, als hier in den Höfen zu musizieren.“
„Oh – ein Blinder, wirklich, Edgar?! Ist der Ärmste wirklich blind …?“
Er antwortete nicht sofort, hatte sich vielmehr ein Stück zum Fenster hinaus gebeugt und aufmerksam in den Hof hinab geschaut.
Jetzt bog er sich hastig wieder zurück und raunte der Schwester zu:
„Weißt du, wer da unten als andächtige Zuhörerin steht? – Niemand anders als eure alte Köchin. Amanda heißt sie ja wohl. – Was hat die hier zu suchen?“
Bei dem Namen dieser gegen sie so sehr eingenommenen langjährigen Dienerin des Hauses Karsten war sofort in Traude ein unbestimmter Argwohn aufgezuckt. Sie dachte an die gehässige Feindschaft, mit der ihre Schwägerin sie verfolgte, dachte an jene Szene, als ihr Gatte ohne Frage absichtlich von Berta nach der grünen Wand hingeführt worden war, wo sie sich gerade mit Fritz Palzow unterhalten hatte. Die heimlichen Anfeindungen, von denen sie sich im Hause ihres Mannes ständig umgeben sah, hatten ihre Sinne geschärft. Sie wußte nicht, wie es kam, – aber plötzlich wurde sie den Gedanken, daß ihre Schwägerin ihr vielleicht durch die Köchin heimlich nachspioniert ließ, nicht mehr los. Fähig dazu war Berta ohne Zweifel. Der war jedes Mittel recht, jedes, um dem kranken Bruder zu beweisen, daß sein Weib eine Undankbare, ja eine Unwürdige sei …
In fliegender Hast teilte Traude jetzt dem Bruder ihre Vermutung mit.
„Wenn das wirklich der Fall sein sollte,“ meinte Edgar darauf mit unheilverkündender Miene, „so soll diese edle Dame, diese schwarzgekleidete Schleicherin, von mir so einiges zu hören bekommen, was ihr wahrscheinlich noch kein Mensch gesagt hat. Aber zunächst wollen wir uns mal Fräulein Amanda langen! Komm’, Kleines, – sonst entschlüpft sie uns vielleicht.“
Amanda stand in ihrem Sonntagsstaat mit einem grellbunten Blumenhut auf dem grauen Scheitel neben dem Hauswart Pachneike, dem sie soeben erklärt hatte, daß sie schon im Nebenhause dem Sänger gelauscht habe und gern noch ein paar weitere Lieder von ihm hören wolle, – worauf der Portier geringschätzig meinte:
„Hier sind die Weiber auch rein verrückt nach dem Gewinsel …“
Da erschienen Traude und Edgar.
Ihr Auftauchen auf dem Hof äußerte sich in seinen Wirkungen auf recht verschiedene Art: Pachmeike riß die Mütze ab und klappte untertänigst vor dem Herrn Grafen zusammen, der Sänger brach mitten in dem Walzerliede, das er als zweites angestimmt hatte, ab, und Amanda erstarrte ihrerseits zur Salzsäule.
Diese Salzsäule bekam jedoch sehr schnell wieder Leben, als Presterloh ihr gebieterisch zuwinkte und mit ihr dann in den großen Hausflur trat, während Traude, aufmerksam gemacht durch das merkwürdige Verhalten des Blinden, diesen weiter beobachtete.
Der graubärtige Musikant, der so grundlos mit seiner neuen Darbietung aufgehört hatte, war nämlich, offenbar durch irgend eine unbekannte Ursache in Bestürzung versetzt, ein paar Schritte zurückgewichen, hatte sich dann umgedreht und packte nun mit hastigen Bewegungen seine Mandoline ein, wobei der dem neben ihm stehenden ärmlich gekleideten Jungen einige Worte zuflüsterte.
Was aber konnte den Musikanten nur so erschreckt haben …?! – Traude drängte sich diese Frage, die immerhin einiges Interesse für den Mann voraussetzte, nur deshalb auf, weil der arme Sänger, der seines erloschenen Augenlichts wegen hier in den Höfen mit seinen reichen Stimmmitteln sich sein Brot verdienen mußte, ihr Mitleid wachgerufen hatte.
Die Köchin und der so schnell in ihr aufgetauchte Verdacht gegen ihre gehässige Schwägerin waren vergessen. Aber nicht vergessen war das wehe Lied, das ihre Seele so stark erschüttert hatte. In ihren Ohren klang es noch immer nach …
„Ich gehe nicht von Dir,
ich lasse Dich nicht …“
Und in ihrem Herzen zitterte noch immer die tiefe Traurigkeit nach, die diese Worte darin hervorgerufen hatten.
Etwas Gutes wollte sie tun, dem Blinden einmal eine große Freude bereiten. Sie zog ihre Börse, entnahm ihr ein Zehnmarkstück und schritt über den Hof auf das Tulpenbeet zu, auf dessen anderer Seite der Sänger jetzt stand.
Nun war sie dicht neben ihm, nun sagte sie mitleidig:
„Hier – bitte! – Ihr Gesang hat mir sehr gut gefallen.“
Er war beim Klange ihrer Stimme merklich zusammengezuckt, wandte sich jedoch nicht nach ihr um, sondern machte sich an dem Überzug seiner Mandoline zu schaffen.
Traude wußte nicht, was sie von diesem Benehmen denken sollte. – War der Blinde so ängstlich, so menschenscheu, daß er mit niemandem in Berührung kommen mochte …?! – Es mußte wohl so sein …! Und daher ließ sie ihm jetzt das Goldstück in die Tasche seiner geflickten Jacke gleiten und schritt dann wieder ein wenig enttäuscht auf den Hofeingang zu.
Inzwischen hatte Presterloh Amanda ins Gebet genommen.
Doch die Köchin war jetzt um eine Antwort keineswegs verlegen, nachdem sie den ersten jähen Schreck überwunden hatte.
„Was ich hier tue, Herr Graf …?! – Nebenan bei Geheimrat Schrötter dient meine alte Freundin Ulrike. Bei der war ich gerade zu Besuch, als der blinde Mann zu singen begann. Ich war ordentlich zu Tränen gerührt von seinen Liedern. Aber er sang leider im ganzen nur drei. Ich wollte nun gern mehr hören, und deshalb bin ich ihm nachgegangen. – Aber sehen Sie mich doch nicht so böse an, Herr Graf. Dabei kann einem ja ganz gruselig werden.“
Nur drei Lieder –, hm, das stimmte …! – Presterlohs gereizte Stimmung verflog. Vielleicht hatte Traude mit ihrem Verdacht doch danebengehauen …
Aber er wollte Amanda trotzdem noch etwas näher auf den Zahn fühlen.
„Geheimrat Schrötter? Ist der nicht Landgerichtsdirektor?“ fragte er, als ob er die Familie von Hörensagen kenne.
„Nein, Herr Graf, mit dem Gericht hat der nichts zu tun. Der ist Kaufmann – Geheimer Kommerzienrat.“
„So so. Na, dann meine ich doch einen anderen.“
Da trat Traude zu ihnen. Aber selbst der Gattin ihres Brotherrn gegenüber blieb die Köchin vollkommen gefaßt. Und schließlich entschwand sie mit einem „Ich wünsche den Herrschaften auch viel Vergnügen“ durch den Haupteingang nach der Straße hin, da der blinde Sänger inzwischen gleichfalls durch den über den Keller führenden Nebenausgang das Haus verlassen hatte.
Presterloh fragte jetzt seine Schwester:
„Hattest du denn der Köchin Erlaubnis zum Ausgehen gegeben, Kleines?“
Sie lachte etwas bitter auf.
„Ich – Erlaubnis?! – Mich fragt niemand! Dafür ist ebenfalls Fräulein Berta zuständig, der ich dieses eine Mal anscheinend mit meiner Vermutung unrecht getan habe.“
10. Kapitel.
Amanda war sofort nach dem glücklich überstandenen Verhör nach Hause zurückgekehrt, wo Berta Karsten sie dann ganz genau ausfragte.
Bertas hageres Altjungferngesicht verzog sich mehr als einmal bei der Köchin Bericht zu einem triumphierenden Lächeln.
„Oh – der Zusammenhang ist mir ganz klar,“ sagte sie dann hohngeschwollen zu Amanda. „Daß hier der vornehme Herr Graf den Mitwisser spielt, ist sicher. Na – jetzt wird Max ja wohl anders über seine schöne Frau denken lernen …! – Ich hoffe wenigstens, jetzt platzt die Bombe! Und daß Sie sich heute wieder Ihre geliebten Kartoffelpuffer braten, Amanda, dagegen habe ich nichts einzuwenden.“
Dann ging Berta Karsten in die Veranda hinüber, wo ihr Bruder wieder auf seinem alten Platze im Krankenstuhl saß und mit dem Pfleger in ein Brettspiel vertieft war.
Nachdem sie diesen hinausgeschickt hatte, nahm sie dessen Platz ein.
Max Karsten war über Bertas Erscheinen durchaus nicht erfreut. Er fürchtete jetzt das Alleinsein mit seiner Schwester fast. Heitere Minuten wurden es nie, wenn sie bei ihm war. In letzter Zeit hatte er doch hinsichtlich ihres Charakters allerlei Zweifel in sich aufkeimen gemerkt. Er traute ihrem guten Herzen nicht mehr so recht. Zu häufig hatte er Beweise erhalten, daß sie sogar recht heimtückisch seiner Frau gegenüber vorgehen konnte.
Mit einer gewissen leichten Unruhe sah er daher der Eröffnung des Gesprächs entgegen. Diese ließ denn auch nicht lange auf sich warten.
Nachdem die Brettspielpartie beendet war, wobei beide recht zerstreut ihre Züge getan hatten, stellte Berta es bei Seite und rückte ihren Stuhl dann mehr nach dem Fußende des halb schräg gestellten Krankenwagens hin, so daß sie dem Bruder voll ins Gesicht sehen konnte.
Er ahnte, daß allerlei Widerwertigkeiten auf ihn einstürmen würden. Und scheu und ängstlich sank er noch mehr in sich zusammen.
Da begann Berta auch schon.
„Es ist jetzt wirklich an der Zeit, lieber Max, daß wir einmal ganz eingehend über Gertraud sprechen. Nicht lange wird es mehr dauern, und du wirst zum Gespött der Leute werden. Gott hat dir wahrhaftig eine schwere Prüfung zugemutet, als er dir deine jetzige Gattin in den Weg führte. Du hast diese Prüfung nicht bestanden. Du hast dich durch eines jungen, eitlen Geschöpfes äußere Schönheit betören lassen. Nur Unheil hat Gertraud Presterloh in unser bis dahin so friedliches Haus hineingetragen. Sie paßte nicht in diese Umgebung solider Bürgerlichkeit hinein, sie brachte Gewohnheiten und Ansprüche mit, die auf ihre Leichtfertigkeit genügend hinweisen. Ich denke da zum Beispiel an das häßliche Zigarettenrauchen, ferner daran, daß für sie sofort neben ihrem Schlafzimmer ein Baderaum hergerichtet werden mußte, wo sie nun täglich morgens … „Körperpflege betreibt“, wie sie es nennt, das heißt in Wasser badet, welches mit sogenanntem Badesalz parfümiert ist. Nachher duftet sie dann den ganzen Tag so aufdringlich, daß einem fast übel davon wird. Wir Karstens haben solche Halbweltgewohnheiten nie gekannt. Unsere Familie hat es dafür aber auch zu etwas gebracht. Gottes Segen ruhte auf unserer Einfachheit, unseren reinen Sitten. – Nun – ich hatte dir ja genug abgeraten, als ich merkte, daß du der damaligen Erzieherin der Meierschen Kinder den Hof machtest und auch die Frau Kommerzienrat mich vor ihr warnte. Die hatte Gertraud längst durchschaut.“
Max Karstens Hände fuhren schon eine ganze Weile unruhig auf der über seinen Schoß gebreiteten Decke hin und her. Jetzt unterbrach er die Schwester. Und in der Erregung wurde ihm das Sprechen noch schwerer als sonst. Nur stoßweise kamen die Worte über die unbeholfene Zunge.
„Ich … verbiete … dir … in dieser Art von Traude … zu sprechen. Ich kenne … sie … besser als du. Du verfolgst sie mit deinem Haß. Was willst du … eigentlich von ihr, was hat sie dir … getan …?!“
Berta beugte sich weit vor und legte ihre Rechte wie beschwörend auf seinen Arm.
„Max, du sollst dich nicht aufregen. Es könnte dir schaden …!“ Ehrliche Besorgnis klang aus diesen Worten hervor. Und auch ihre Augen blickten den Bruder bittend an. – Sie dachte daran, daß, wenn ihn jetzt infolge des deutlich sich bemerkbar machenden Aufruhrs in seinem Innern ein neuer Schlaganfall traf, er ganz plötzlich sterben könnte, ohne ein Testament gemacht zu haben.
„Sieh Max,“ fuhr sie da fort, „mein Gewissen zwingt mich zum Reden. Ich halte es für meine heilige Pflicht, dir endlich vollkommen die Augen zu öffnen. Gertraud hintergeht dich. Heute habe ich die Beweise dafür erhalten. – Du kennst Amanda, du weißt, wie treu sie unserer Familie ergeben ist. Ich hatte sie gleich nach Tisch beurlaubt. Sie wollte eine Freundin besuchen. Zufällig verließ sie kurz nach deiner Frau das Haus. So wurde sie ungewollt Zeugin, wie Gertraud sich mit jenem Fritz Palzow auf der Straße traf und in Begleitung dieses jungen Mannes dann spazieren ging. Amanda war so empört über diese Entdeckung, daß sie dem Paare von weitem folgte. Das mag ja nicht recht von ihr gewesen sein, dieses Nachschleichen. Aber man muß es ihrer Anhänglichkeit für uns zugute halten. – Gertraud stieg dann nachher in ein Auto und fuhr davon. Amanda aber folgte dem Mechaniker. Es fiel ihr auf, daß er gar nicht daran dachte, zur Arbeit nach seiner Fabrik, der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, zu gehen, wo er doch nachmittags beschäftigt wird.“
Absichtlich machte sie eine kleine Pause. Und sie konnte zu ihrer hohen Befriedigung schon jetzt feststellen, daß dieses Mal ihre vergifteten Pfeile gewirkt hatten.
Max Karstens Kopf war tief nach vorwärts gesunken. Starr schaute er vor sich hin. Seinen Hände lagen regungslos auf der Decke. Nur die Fingerspitzen bewegten sich zuweilen in nervösem Zucken.
„Fritz Palzow betrat schließlich ein altes, schmales Gebäude in einer Gasse in der Nähe des Königlichen Schlosses,“ setzte Berta mit einer Stimme, als zittere ihr das Herz vor Weh über so viel menschliche Schlechtigkeiten, leise hinzu. „Amanda, die er von Ansehen kaum kennen dürfte, war dicht hinter ihm. In ihrem Eifer, dir zu nützen, beging sie nun eine große Unvorsichtigkeit. Sie folgte Palzow in das Haus, hörte ihn eilig die Treppen bis hinauf zu den Giebelstuben emporklimmen, hörte ihn eine dieser Türen aufschließen und auch wieder hinter sich verriegeln. Ja, sie vergaß sich sogar so weit, dann durch das Schlüsselloch in diesen Raum hineinzublicken. Viel sah sie nicht. Am Fenster an einem Tisch saß Palzow und … klebte sich einen falschen Bart an. – Amanda begab sich nun wieder auf die Straße hinab, behielt die Haustür jenes Gebäudes aber im Auge und erblickte dann sehr bald einen älteren Mann, der in der Eingangstür erschien und die Richtung nach der Friedrichstraße hin einschlug. Es war Fritz Palzow in einer Verkleidung. – Und wo, meinst du wohl, traf er nach einer längeren Fahrt mit der elektrischen Straßenbahn ein …?! – Nun, in dasselbe Haus, in dem dein Schwager in dem Fremdenheim der Frau Major von Krusius wohnt …!!“
Sie schwieg. Dieser Streich hatte gesessen.
Max Karsten stöhnte auf. Es war ein Laut, als gehe etwas in seiner Brust in Scherben, ein zartesten Gefäß, – – sein Glaube an sein Weib!
„Ja, in jenes Haus …!“ wiederholte Berta. „Und Gertraud ist bekanntlich heute nachmittag auch bei Presterloh, um ihn zu dem Besuch der Luftschifffahrt-Ausstellung abzuholen. Mir ist der Zusammenhang klar – nur zu klar! Als Musikant hatte Palzow sich verkleidet, mit einer Mandoline im Arm ging er völlig unkenntlich zu diesem Stelldichein. – Damit du aber nicht etwa denkst, daß ich mich nicht ganz genau an die Wahrheit halte, magst du Amanda befragen. Die wird dir Wort für Wort alles bestätigen, auch daß nachher zuerst Palzow und dann Gertraud das Haus verließ …“
Diese raffinierte Verdrehung der wahren Geschehnisse, dieses geschickte Fortlassen von Einzelheiten, die den Vorgängen ein ganz anderes Aussehen gegeben hätten, waren freilich ein Kartenhaus, das nur zu leicht zusammenstürzen konnte, sobald Max Karsten den Dingen auf den Grund ging und Traude zur Rede stellte. Dies mußte zunächst verhütet werden. Und hierauf zielten Bertas nächste Sätze hin.
„Deine Frau wird natürlich alles leugnen, ebenso der Graf und der junge Palzow. Es wäre jedenfalls das Verkehrteste, was du tun könntest, wenn du Traude jetzt gleich zur Rede zögest. Warte ab, bis wir so belastende Beweise gesammelt haben, daß jeder Zweifel an der Schuld deiner Frau ausgeschlossen ist. Das rate ich dir, deine Schwester, die stets aufs beste für dich gesorgt hat.“
Wieder stöhnte der Kranke qualvoll auf. Daß Berta ihn täuschen könnte, daran dachte er nicht einen Augenblick. In diesen furchtbaren Minuten, als diese Eröffnungen ihn wie Keulenschläge getroffen hatten, sagte er sich innerlich von Traude für immer los, begrub er das kümmerliche Glück, das sie ihm geschenkt hatte, auf ewig. Andere Gefühle wurden jetzt in ihm lebendig, nachdem die erste kaum faßbare Enttäuschung überwunden war. Er erinnerte sich der Szene, letztens im Garten, als Traude sich mit Palzow unterhalten hatte. Kein Wort der Rechtfertigung war später über ihre Lippen gekommen, ganz unwidersprochen hatte sie Bertas Bemerkung gelassen, daß sie schon häufiger mit dem hübschen jungen Manne an der grünen Wand ihre Gedanken ausgetauscht habe. Ja – seine Schwester hatte recht – Traude hinterging ihn schamlos, ihn, einen Gelähmten, der nicht imstande war, sie zu bewachen. Doppelt verwerflich handelte sie, mehr als grober Undank war dies, es war eine Schlechtigkeit, die ihren Charakter in das traurigste Licht rückte. –
Eine verzehrende Eifersucht flackerte in der Seele des gepeinigten Mannes auf. Er, der bisher überhaupt nicht hassen zu können geglaubt hatte, fühlte jetzt gegen seine Frau einen so wilde Wut in sich aufsteigen, daß er nichts mehr mit ruhiger Überlegung abzuwägen vermochte. Ja – Berta sollte mit ihm zufrieden sein! Er würde vorläufig schweigen, würde heucheln, freundlich und unbefangen tun, bis – bis die Stunde da war, wo er Traude, gestützt auf nicht umzustoßende Beweise, zum Hause hinausjagen konnte. Und auf diese Stunde freute er sich schon jetzt …!
Seine Hände ballten sich zu Fäusten, seine Arme hoben sich drohend empor.
Da stand Berta Karsten schnell auf.
„Lieber Max, – Ruhe – Ruhe –, ich flehe dich an! Denke an deine Gesundheit! Vergiß nicht, daß jede Aufregung vielleicht das herbeiführen kann, – was der gerechte Gott ja hoffentlich noch lange verhüten wird! –, worauf Gertraud vielleicht im Stillen hofft: – Dich zu beerben, um dann ihre Zukunftspläne mit Hilfe deines Geldes verwirklichen zu können!“
Schlauer hätte dieses verderbte, selbstsüchtige Weib es kaum anfangen können. Sofort nahm er diesen Gedanken auf. –
Erbin werden, reich und frei werden, ja, das würde der Heuchlerin gepaßt haben …!!
„Bringe mir – Papier – und Feder –“, keuchte er. „Ich will Vorsorge treffen, daß mein plötzlicher Tod ihr nicht unverdiente Reichtümer in den Schoß wirft.“
„Max, übereile nichts, ich bitte dich! Bedenke, daß du sie jetzt noch nicht enterben, sondern höchstens auf den Pflichtteil setzen kannst.“ Und Berta griff dabei wie beschwörend nach seiner Hand. Es schien, als ob ihr nicht das Geringste an einer solchen letztwilligen Verfügung lag, von der sie doch nur Vorteile gehabt hätte.
„Oh – ich habe meine fünf Sinne sehr gut beisammen – sehr gut! Ich weiß wohl, wie ich das Testament abzufassen habe. Natürlich zunächst nur die Beschränkung auf den Pflichtteil – natürlich! – Aber bringe mir jetzt das nötige Schreibmaterial bitte. Vermag ich vorauszusehen, wie lange ich noch zu leben habe …?! Jede Sekunde kann der Knochenmann seinen Arm nach mir ausstrecken!“–
Zehn Minuten später hatte Berta das Testament in den kleinen eisernen Geldschrank eingeschlossen, der in ihres Bruders Arbeitszimmer stand und dessen Schlüssel er stets bei sich trug.
Als die schwere Tür des Panzerschrankes mit metallischem, hellem Ton ins Schloß schnappte, lachte die dürre alte Jungfer schadenfroh auf.
„Nun gilt es, dieses Feuer weiter zu schüren,“ murmelte sie vor sich hin. „Der Anfang ist gemacht …! Der halbe Sieg ist erfochten …! Und bin ich erst am Ziel, weist Max dich zum Hause hinaus, schöne Schwägerin, so will ich dir auch erklären, wodurch dieser Fritz Palzow sein Geld verdient …! Dann wirst du dich voller Verachtung von ihm wenden …! Und auf diese Weise treffe ich dich doppelt!“
Dann brachte sie dem Kranken den Tresorschlüssel zurück, den sie ihm wieder am anderen Ende der langen goldenen Uhrkette befestigen und in die Westentasche stecken mußte.
Sie tätschelte ihm dabei zärtlich über die Wangen.
„Mein armer, gutmütiger Patient, als wir beide hier noch allein hausten, waren wir glücklicher,“ sagte sie mit leisem Seufzer wie in Erinnerung an schönere Zeiten.
Er aber war mit seinen Gedanken nur bei seiner Eifersucht und seinem Haß. Und daher entgegnete er nur:
„Schaffe mir die notwendigen Beweise, Berta, – wie, ist mir gleichgültig! Nur bald muß es sein! Ich weiß nicht, ob ich so gut werde heucheln können, daß sie nicht argwöhnisch wird!“
11. Kapitel.
Max Karsten hatte recht, als er seiner Schwester gegenüber die Befürchtung äußerte, es würde ihm schwer fallen, seine Frau nichts von der in ihm vorgegangen Veränderung merken zu lassen.
Traude fühlte sehr bald, daß es wie Gewitterschwüle über dem Hause lastete. Ihre Schwägerin war plötzlich auffallend freundlich zu ihr. Aber Traude entging es nicht, daß die Augen der alten Jungfer eine andere Sprache als die glatte Zunge redeten. –
Auch mit ihrem Manne verhielt es sich nicht viel anders. Der Kranker gab sich offenbar alle Mühe, liebenswürdig und harmlos zu erscheinen. Doch in seinem früher so sehnsüchtig, werdenden Blick, mit dem er Traude stets angeschaut hatte, war jetzt ein fremder Ausdruck, über dessen Bedeutung sie sich nicht klar werden konnte.
Von Tag zu Tag sah Traude sich daher mehr und mehr von Unaufrichtigkeit und versteckter Feindseligkeit umgeben. Immer deutlicher wurde ihr bewußt, daß ihr Gatte nunmehr mit seiner Schwester ganz ein Herz und eine Seele war. Kleinlichkeiten, die sie geschickt in Gedanken aneinander fügte und zu Beweisen verdichtete, zeigten ihr, welche Veränderung mit ihrem Manne vor sich gegangen war.
Sie litt schwer unter alldem, zumal sie gerade jetzt niemanden hatte, mit dem sie sich aussprechen konnte. Presterloh war schon am Tage nach dem Besuch der Luftschifffahrtsaustellung für eine Woche nach Kiel gefahren, um sich die großen Segelregatten anzusehen. Wenigstens hatte er Traude diesen Grund für seine plötzliche Abreise angegeben. Doch sie glaubte nicht recht an dieses Interesse für den Segelsport. Ihr kam es so vor, als ob er nur deshalb für einige Zeit Berlin verlassen wolle, um jeder Begegnung mit Hilde Palzow auszuweichen. Vielleicht war er von seiner Festigkeit, die endgültige Trennung von Hilde auch wirklich durchführen zu können, doch nicht so ganz überzeugt, vielleicht fürchtete er von der Geliebten ein gleiches und wollte ihnen beiden neue Herzenskämpfe ersparen. Oder – war Edgar vielleicht Oppeners nachgereist, die gleichfalls in Kiel weilten? Wollte er etwa dieses Liebesabenteuer, bei dem sein Herz so stark beteiligt und das doch so aussichtslos gewesen war, durch einen Gewaltstreich für immer aus seiner Erinnerung auszulöschen versuchen, indem er als Bewerber für die reiche Edith Oppener auftrat …?!
Nun, mochte dem sein wie ihm wolle, jedenfalls war Traude in diesen schweren Tagen, wo sie scheu und gedrückt durch das Haus schlich und eigentlich ständig darauf wartete, daß der Schwüle nun bald der Ausbruch eines Unwetters folgen würde, ganz allein auf sich angewiesen. Und dabei sehnte sie sich förmlich nach der Aussprache mit einem Menschen, zu dem sie volles Vertrauen haben und bei dem sie auch das Verständnis für das Qualvolle ihrer Lage voraussetzen durfte.
In dieser ihrer Einsamkeit und Verlassenheit wanderten ihre Gedanken unwillkürlich häufiger zu dem Manne hin, der ihre rege Phantasie schon längere Zeit und mehr, als für ihre Seelenruhe gut war, beschäftigt hatte.
Sie hatte Fritz Palzow seit jenem Tage, als er sie bat, bei ihrem Bruder Hildes wegen vorstellig zu werden, nicht mehr gesehen. Nur daß er ihr nahe war, hörte sie täglich. Das Hämmern und Klopfen verriet es ihr, das aus seiner Werkstatt durch die grüne Wand hindurchdrang. Damals, als sie so schnell in ein Auto gestiegen und davongefahren war, hatte zum erstenmal die Erkenntnis ihr Bewußtsein durchzuckt, daß dieser junge, blühende Mensch ihrem Herzen gefährlich zu werden drohte. Geflohen war sie vor ihm, vor seiner Nähe … Und jetzt mußte sie so häufig an ihn als den einzigen denken, dem sie die Last, die sie bedrückte, ehrlich gebeichtet haben würde …, ihm, Fritz Palzow, einem Mechaniker …!!
Ja, wer ihr das früher einmal vorausgesagt hätte, daß sie sich zu einer solchen verständigen Vorurteilslosigkeit durchdringen würde, um in jedem Menschen nur den Menschen als solchen ohne Rücksicht auf Herkunft, Stand und Namen zu sehen, den hätte sie ausgelacht. Und jetzt lächelte sie über die, die sich in ihrer Beschränktheit fernab von dem kräftigen Pulsschlag des modernen Lebens mit all seinen neuen Wesenserscheinungen hielten und die Augen vor der Erkenntnis verschlossen, daß jetzt nur der innere Wert des Einzelnen – Begabung, Fähigkeiten und zähe Energie, in Betracht kamen und alles andere nur eitel Mummenschanz war!
Und Fritz Palzow war für Traude ein solcher Vertreter modernen Menschentums. In glücklicher Vereinigung besaß er all die Eigenschaften, die ihm, wenigstens nach Traudes Meinung, den Weg zu hohen Zielen ebnen mußten.
Oft genug lenkte sie in diesen Tagen, wo die Luft in der einsamen Villa ihr über und über mit heimlicher Gewitterschwüle gesättigt zu sein schien, ihre Schritte nach der grünen Wand hin und lauschte, ob sie nicht die Töne seiner emsigen Arbeit vernehmen könnte. Sie ahnte nicht, daß es die Sehnsucht nach Fritz Palzow war, die sie in seine Nähe trieb. Sie glaubte, nur in ihrer Verlassenheit suche sie nach einem Menschen, der ihr Trost und Mut zusprechen sollte … –
Aber Fritz Palzow ließ sich nicht blicken. Kein Kopf mit leuchtenden, schaffensfrohen Augen erschien oben zwischen den Ranken des wilden Weines, keine Stimme rief ihr aus der Höhe einen Gruß zu …
So verging fast eine ganze Woche.
* * *
Berta Karsten war gleich nach dem Mittagessen nach der Stadt gefahren, um dort Besorgungen zu erledigen, und Traude wieder hatte sich in ihr Schlafzimmer zurückgezogen, um einer leichten Migräne wegen etwas zu ruhen. –
Der Kranke machte seinem Pfleger das Leben nicht gerade leicht. Er, der früher so geduldig, so bald zufriedenzustellen war, hatte jetzt stets ein paar gereizte Worte bereit, die oft ganz unberechtigt waren.
„Es ist heute hier unerträglich heiß in der Veranda,“ meinte Max Karsten, indem der den Pfleger, der ihm aus einem Leihbibliotheksband vorlas, mitten im Satz unterbrach. „Fahren Sie mich in den Garten an eine recht schattige Stelle. Ich will dort etwas zu schlafen versuchen.“
Einige Meter links unterhalb des Fensters in der grünen Wand stand ein dichtes Fliedergebüsch, das einst zu dem Zweck kreisförmig angepflanzt worden war, um dort eine Laube einzurichten. Hinter diese grünen Kulisse wurde der Fahrstuhl geschoben.
„Um vier Uhr können Sie wieder nach mir sehen kommen,“ befahl Max Karsten kurz, und der Pfleger verschwand.
Der Kranke lehnte sich in die Kissen zurück und schloß die Augen. Aber der Schlummer floh ihn auch jetzt, gerade so wie in den endlosen Nächten, in denen der einst in sein herbes Schicksal so geduldig ergebene Mann Gedanken der Eifersucht und eines heimlichen Hasses in seinem Hirn unaufhörlich hin und her wälzte.
Dann schlief Max Karsten schließlich doch ein. –
Traude hatte ein Migränepulver genommen, und sich auf das Bett gelegt. Sie fühlte sich schon nach einer halben Stunde bedeutend freier. Der Kopfschmerz war fast ganz geschwunden.
Durch den Kücheneingang verließ sie leise das Haus und schritt langsam durch den Garten der alten Kastanie zu, die ihre äußersten Zweige mit dem Rankengewirr der grünen Wand verwischte.
Daran, daß sie Fritz Palzow jetzt vielleicht sehen und sprechen könnte, dachte Traude heute nicht. In den letzten zwei Tagen war es in seiner Werkstatt still geblieben. Und diese Stille hatte Traude fast schmerzlich empfunden. Vielleicht weilte auch er gar nicht mehr in Berlin. Hatte er ihr doch damals bei dem Besuch in der Scheunenvilla erzählt, daß er das fertige Modell möglicherweise dem Direktor der Gothaer Flugzeugwerke vorführen würde, der bei den zuständigen Stellen im Kriegsministerium großen Einfluß hätte.
Traude hatte sich an den Stamm der Kastanie gelehnt und blickte in Gedanken versunken zu der grünen Wand empor. Sie ahnte nicht, daß keine sechs Meter von ihr entfernt die Augen ihres Mannes jede ihrer Bewegungen mißtrauisch und erwartungsvoll verfolgten.
Dann vernahm sie hinter sich flüchtige Schritte. Leicht zusammenschreckend wandte sie den Kopf.
Alles Blut strömte ihr zum Herzen … Es war Fritz Palzow …
Er trug heute einen offenbar ganz neuen, hellen Sommeranzug, in dem seine schlanke und doch so kraftverratende Figur vortrefflich zur Geltung kam. –
Mit einem Blick hatte Traude das festgestellt, auch daß auf seinem hübschen, energischen Gesicht ein frohes Leuchten lag.
Jetzt zog er den Hut, blieb vor ihr stehen und sagte:
„Sie werden sich gewiß wundern, daß ich hier so ohne weiteres eingedrungen zu sein scheine, gnädige Frau. Aber so unverfroren bin ich doch nicht. Die Köchin wies mich hierher. Sie erklärte, daß Ihr Herr Gemahl seine Nachmittagsruhe halte und nicht gestört werden dürfte. Zunächst wollte ich nämlich Herrn Karsten meine Aufwartung machen, um ihm, der mir in so liebenswürdiger Weise hinsichtlich des Fensters entgegenkommen ist, mit als erstem zu erzählen, welches unglaubliche Glück ich mit meiner Erfindung – eigentlich sind es ja mehrere technische Verbesserungen – gehabt habe. Natürlich hatte ich gehofft, gleichzeitig auch Ihnen, gnädige Frau, hiervon Mitteilung machen zu können. – Ja, ich habe Glück gehabt. Vorgestern hatte ich meine Zeichnungen und die sonstigen nötigen Papiere dem Patentamt eingereicht und gleichzeitig mein Modell einer Kommission von militärischen Sachverständigen zur Begutachtung übergeben. Und heute vor drei Stunden erhielt ich im Kriegsministerium bereits den Bescheid, daß meine Erfindung vom Staate angekauft werden würde. Man bot mir fünfzigtausend Mark. – Ich verlangte das Vierfache. – Nur die Lumpe sind bescheiden …! Und – die Herren sagten trotz dieser „Bescheidenheit“ zu allem ja und amen! Kurz – vor Ihnen steht heute nicht mehr der arme Schlucker von Mechaniker, sondern der gleichzeitig mit sehr anständigem Gehalt als technischer Mitarbeiter im Kriegsministerium angestellte, zweimalhunderttausend Mark „schwere“ Fritz Palzow, der … neue Fritz Palzow, der sich gründlich gemausert hat.“
Es war, als ob dieser Glücksschimmer auf seinem Gesicht sich auf dem ihrigen widerspiegelte. Und auch das Leuchten ihrer Augen war dasselbe, als sie ihm nun froh bewegt beide Hände hinstreckte und sagte:
„Herr Palzow, Sie glauben ja nicht, wie sehr mich dieser Erfolg, der nunmehr Ihre Arbeit gekrönt hat, erfreut. Mag auch die Zukunft Ihnen nur Gutes bringen.“
Er behielt ihre Hände in den seinen.
„Die Zukunft?!“ Er zuckte, plötzlich ernst und fast traurig geworden, die Achseln. „Sie hätten mich nicht an die Zukunft erinnern sollen, gnädige Frau. – Sehen Sie, ich bin ein gerader, offener Mensch. Und deshalb erkläre ich Ihnen, daß das Schicksal mir einerseits in diesen letzten Wochen verheißungsvoll zugelächelt hat, und damit meine ich diesen Abschluß meiner angestrengten Arbeiten, dann aber auch gezeigt hat, daß nichts vollkommen auf der Welt ist – nichts! Es ließ mich eine Frau kennen lernen, die Frau eines anderen, die ich lieb gewann und die doch für mich unerreichbar ist. Und dabei hätte ich dieser Frau ein Herz schenken können, das trotz der achtundzwanzig Jahre seines Besitzers so rein wie das eines Kindes ist, ein Herz, das vielleicht imstande gewesen wäre, diese Frau restlos glücklich zu machen. Es soll, es darf nicht sein …! Ich weiß das sehr wohl, und wenn ich in dieser Minute derselben Frau hier gegenüberstehe und ihr das alles zu sagen wage, so ist das kein Verbrechen an dem Manne, dem diese Frau sich als Lebensgefährtin zu eigen gegeben hat. Einmal mußte dies über meine Lippen, einmal sollten Sie erfahren, Traude, wie es um mich steht. Nein – die Zukunft wird mir ein volles Glück, volle Zufriedenheit nie gewähren, da ich verzichten und vergessen muß …“
Seine Stimme zitterte vor innerer Bewegung. Und seine Augen ruhten in denen Traudes mit einer Hingabe und Liebe, daß es wie ein Beben immer wieder über ihren Körper hinlief. Jetzt wußte sie plötzlich genau, was jene seltsame Unruhe und Unrast, jenes Stürmen und Drängen in ihrem Herzen gewesen war: Sehnsucht nach Liebe, nach der Liebe dieses starken, ganzen Mannes, den das Geschick ihr in den Weg geführt hatte. Und diese Erkenntnis betäubte sie für einen Moment vollkommen. Sie mußte die Augen schließen, nur um nicht der Versuchung zu unterliegen, dem Geliebten sich an die Brust zu werfen und zu rufen: „Ich will Dein sein, – nimm mich mit hinaus aus diesem goldenen Käfig für immer …!“
12. Kapitel.
Max Karsten saß regungslos in seinem Krankenstuhl. Der Blättervorhang der Fliedersträucher hatte gerade in Augenhöhe vor ihm eine kleine Lücke. So sah er die beiden einander gegenüber stehen, sich an den Händen haltend. Und jedes ihrer Worte hatte er verstanden. –
Wo war darin aber die verbrecherische Vertraulichkeit, von der Berta ihm erzählt hatte …?! – Daß Traude und Palzow bisher völlig rein dastanden, ein besserer Beweis hierfür als diese Begegnung hätte ihm gar nicht geliefert werden können …!
Traude hatte sich inzwischen gefaßt. Sie löste ihre Hände aus denen des Geliebten, trat einen Schritt zurück.
„Sie dürfen nie wieder so zu mir reden, nie wieder! Versprechen Sie mir das! Lassen Sie uns gute Freunde bleiben, aber auch unser Gewissen uns unbefleckt erhalten …! Mein Mann ist ein Unglücklicher, der doppelte Rücksichtnahme verlangt. Er ist herzensgut, er hat mir hier ein Heim geschaffen, in dem ich vielleicht zufrieden und wunschlos neben ihm dahingelebt hätte, wenn seine Schwester nicht gewesen wäre. Deren Anfeindungen waren es, die mir erst zum Bewußtsein brachten, wie einsam ich war, wie ich mich nach einem Mehr sehnte …! Denn daß das Leben ein Mehr als dieses mein Dasein hier zu vergeben hat, fühle ich sehr wohl … So ist es gekommen, daß meine Seele sich zu Ihnen in Gedanken oft genug hingeflüchtet hat, Fritz Palzow, – oft genug, besonders in den letzten Tagen, wo hier in diesem Hause in jedem Winkel mir versteckte Feindschaft, verheimlichter Widerwille aufzulauern scheint … Doch – die Presterlohs haben einen Wahlspruch, der auch mir zur Richtschnur meines Tun und Lassens dient: „Die Pflicht über alles!“ – Und meine Pflicht kenne ich. Sie verlangt von mir treue Fürsorge für meinen kranken Gatten, – ich betone: „treue“ Fürsorge! Und Pflichtbewußtsein schließt ja die Treue in weitestem Sinne in sich ein.“
Sie hatte sich wieder an den Stamm der Kastanie gelehnt und schwieg jetzt wie erschöpft. Ihr Gesicht war bleich. Das Entsagen fiel ihr so schwer, so namenlos schwer …
Da begann Fritz Palzow abermals:
„Sie besitzen eine große, starke Seele, Frau Traude! Und ich mag nicht hinter Ihnen zurückstehen. Sie sollen die Schwächen meines Charakters kennen lernen, sollen sich nicht ein Idealbild von mir aus dem bisher Gehörten zusammenfügen, das leider der Wirklichkeit in einem Punkte sehr wenig entspricht. – Ich habe die Welt und auch meine Mutter und Schwester in einer Beziehung getäuscht. Ich habe gelogen, wenn ich stets sagte, daß ich nachmittags als Mechaniker nach wie vor meinem Berufe nachging, um mir die Geldmittel für meinen Lebensunterhalt und für die Unkosten meiner Erfinderarbeit zu verschaffen. Auf andere Weise habe ich mir Geld verdient, und ich habe hierzu einen Weg eingeschlagen, der auch von mir nicht gebilligt wurde. Aber die Not zwang mich dazu. Als Mechaniker hätte ich in den Nachmittagsstunden nie so viel durch meiner Hände Arbeit mir erwerben können, daß ich meine Pläne schnell zur Ausführung zu bringen imstande gewesen wäre. Da kam mir ein Gedanke, der bei aller Abenteuerlichkeit Erfolg versprach. Wie ich diese Idee vorbereitet, wie ich es eingerichtet habe, daß mein Geheimnis bewahrt blieb, – all diese Einzelheiten schenken Sie mir wohl. Letztens – es war genau heute vor acht Tagen – haben Sie mir dies hier in die Tasche gleiten lassen …“
Er zog seine silberne Taschenuhr hervor, an deren Bügel ein Goldstück befestigt war.
Traude beugte sich über die Münze, starrte dieselbe verwundert an. –
Dann begriff sie…
„Sie … Sie sind … der blinde Sänger, der in den Höfen seine Lieder vortrug und der überall so viel Beifall erntete …?!“
„Nein – ich bin es nicht – ich war es! Der alte, graubärtige Mann wird nie wieder auftauchen!“
„Welch’ romantische Idee!“ meinte Traude staunend.
„Und doch habe ich mich als „blinder Sänger“ stets sehr unglücklich gefühlt – stets! Und als ich Sie damals so urplötzlich im Hofe neben Ihrem Bruder erscheinen sah – ich hatte ja gehofft, daß Sie beide längst in der Ausstellung seien! –, da habe ich mich zum erstenmal dieses Betrugs wegen geschämt … Nein, Frau Traude, – sagen Sie jetzt nicht, daß Sie etwa diese meine zweite Rolle, die ich an den Nachmittagen spielte, billigen …! Dazu kenne ich Ihre Denkungsart doch schon zu genau! – Außerdem muß ich mich jetzt verabschieden. Ich darf Ihren guten Ruf nicht aufs Spiel setzen. Die Köchin weiß, daß ich hier bei Ihnen weile. Und gehässige Zungen gibt es überall. – Leben Sie wohl, gnädige Frau – leben Sie wohl! Wir werden uns in Zukunft selten sehen. Ich habe für mich und die Meinen bereits eine freundliche Wohnung in der Stadt gemietet.“
Traude sprach kein Wort mehr. Die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Schweigend reichte sie ihm die Hand zum Abschied … Und hastig eilte er davon, als ob er ihnen beiden das Auseinandergehen nicht unnötig schwer machen wolle.
Traude war wieder allein. Einen Augenblick starrte sie ihm nach. Dann schlug sie die Hände vor ihr bleiches Gesicht und schluchzte herzzerbrechend …
Es dauerte lange, ehe sie sich soweit beruhigt hatte, um ins Haus zurückkehren zu können. Ängstlich schlüpfte sie in ihr Schlafzimmer. Niemand sollte ihre verweinten Augen sehen …
* * *
Kaum einige Minuten später erschien der Krankenpfleger im Garten, um nach den Befehlen Max Karstens zu fragen.
„Bringen Sie mich … in die Veranda – schnell! – Haben Sie jemandem gesagt, daß … ich hier im Garten war?“
„Nein. Ich hatte keine Veranlassung dazu.“
Der Pfleger war erstaunt, seinen Pflegebefohlenen so völlig verändert vorzufinden. Der mürrische, verbitterte Gesichtsausdruck war verschwunden. Sonniger Friede lag auf diesem Antlitz, und gütig und mild war Max Karstens Stimme wieder wie zuvor.
In der Veranda angelangt, mußte der Pfleger seinem Herrn aus dessen Geldschrank einen Umschlag holen, auf dem die Worte „Mein Testament“ standen. Er entnahm ihm zwei Blätter und entzündete sie sofort über einer Kerze. Er hatte den Pfleger hinausgeschickt, und als die Flammen gierig an dem Papier hochleckten, sprach er leise vor sich hin:
„Sie darf nie … erfahren, in welch’ häßlichem Verdacht ich … sie gehabt habe … Ich habe ihr unendlich … viel abzubitten.“
Dann klingelte er wieder nach dem Pfleger und ereilte ihm neue Anweisungen. Und eine halbe Stunde später lag ein anderes Testament in dem Tresor, das Max Karsten selbst darin einschloß, indem er sich in seinem Fahrstuhl bis vor den Stahlschrank hinschieben ließ. Mühsam suchte er dann noch aus einem Fache ein winziges kleines Fläschchen hervor und barg es in der geschlossenen Hand. Da befand der Pfleger sich schon im Nebenzimmer.
Karsten rief ihm jetzt herbei und saß dann bald wieder auf seinem alten Platz in der Veranda.
„Rufen Sie bitte meine Frau,“ sagte er nun.
Der Mann verschwand. Und der Kranke bewegte murmelnd die Lippen: „Ich muß mich beeilen … Sonst werde ich vielleicht doch noch schwach …“ –
Traude trat ein. Ihre Augen waren noch leicht gerötet.
Karsten nahm ihre Hand.
„Liebe Gertraud, du … könntest mir einen … Gefallen tun. Ich habe da … in der Zeitung einen neuen Roman … angepriesen gefunden. Willst du mir den sofort … aus der Stadt besorgen? – Und noch eins: hier übergebe … ich dir den Schlüssel … zu meinem Geldschrank. Bewahre ihn gut auf. – So, das wäre alles.“
Er drückte ihre Hand leise. Und dann bat er zaghaft:
„Gib mir noch … einen Kuß zum Abschied, Gertraud. Und denke dabei, daß … du einen Bruder küßt, der es am allerbesten von allen Menschen … mit dir meint.“
Sie begriff ihn nicht recht, beugte sich aber gehorsam herab und drückte ihre warmen Lippen einen Moment auf die seinen. Und diese waren eiskalt wie die eines Toten.
Eine Stunde darauf kehrte Berta zurück. Als sie dem Bruder die Hand zur Begrüßung reichen wollte, zog er die seine zurück und schob sie unter die Decke. Kalt und entschlossen sah er ihr in das heuchlerische Antlitz.
„Du sowohl … wie Amanda – ihr beide werdet … augenblicklich mein Haus … verlassen – augenblicklich! Und ich warne euch, meine Frau … weiter mit eurer Heimtücke zu … verfolgen. Euer falsches Spiel ist … aufgedeckt. Auch den jungen Palzow … laßt in Ruhe, wenn ihr euch nicht schweren Ungelegenheiten aussetzen wollt!“
Ehe Berta noch etwas erwidern konnte, hatte er schon nach dem Pfleger geklingelt.
„Meine Schwester … und die Köchin beabsichtigen … sofort … sich von mir zu … trennen. Besorgen Sie also ein … Auto, das nach einer Stunde … vorfahren soll. Deine Sachen, soweit du sie … nicht gleich mitnimmst, Berta, kannst du … später holen lassen.“
Dann saß Max Karsten ganz still da und wartete.
Endlich hörte er das Auto vor dem Hause halten. Noch einige Minuten, und es fuhr davon.
Berta hatte dem Bruder nicht mehr Lebewohl gesagt. Sie gab ihr Spiel verloren.
Der Pfleger erschien. Er hatte zwei Koffer in den Kraftwagen getragen.
„Sie könnten mir … ein Brötchen … mit Kaviar bringen. Ich habe gerade Appetit … darauf,“ bat Karsten.
Noch einmal blickte er zum offenen Fenster hinaus in den grünen Garten und auf die Blumen, die er so gern gehabt hatte.
„Gott wird mir … die schwere Sünde … verzeihen…“, sagte er dann leise vor sich hin.
Gleich darauf flog ein winzig kleines Fläschchen zum Fenster hinaus mitten zwischen die dichtstehenden Astern, wo kein Mensch es so leicht finden konnte. –
Als der Pfleger wieder die Veranda betrat, fand er nur noch einen Toten vor. Friedlich lag Max Karsten mit geschlossenen Augen in den Kissen, als ob er schliefe. Auf seinem Gesicht prägte sich ein eigener Ausdruck aus: tiefste Zufriedenheit, gepaart mit überlegener Weltklugheit. –
Der telephonisch herbeigerufene Hausarzt stellte als Todesursache ohne lange Untersuchung Herzschlag fest. – –
Am Tage nach Max Karstens Begräbnis wurde vor Gericht sein Testament eröffnet. Es brachte für Traude nie geahnte Überraschungen. Sie war zur alleinigen Erbin eingesetzt. Dann war noch eine Schlußbemerkung in der Urkunde vorhanden, die folgendermaßen lautete:
Meine Frau würde mich noch im Grabe schwer kränken, wenn sie die Erbschaft etwa ausschlagen würde. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, daß, falls sie dies entgegen meiner Erwartung doch tun sollte, der Erfinder Fritz Palzow mein Erbe wird. Ich hoffe aber, sie wird meinen letzten Willen ehren, auch in bezug darauf, daß sie nicht länger als einen Monat Trauerkleider tragen soll. Nach Ablauf dieses Monats soll sie ohne Gewissensbedenken sich das Glück suchen, das ich ihr nicht geben konnte.
* * *
Unsere Geschichte ist aus.
Daß aus Traude und Fritz Palzow sehr bald ein Paar wurde, und daß auch Edgar Presterloh, nachdem er den Abschied genommen hatte, seine Hilde heimführte, sei nur kurz noch erwähnt.
Die grüne Wand hat im einstmals Karstenschen, jetzt Palzowschen Garten noch oft heitere, glückliche Menschen und ausgelassen umhertollende kleine Palzows und Presterlohs gesehen …
Alle, die zur Familie gehören, lieben die grüne Wand, die mit Recht als die Vermittlerin zweier selten harmonischer Ehen gilt.
Anmerkungen:
- ↑ Zu Bernhard Kellermanns (* 4. März 1879 in Fürth; † 17. Oktober 1951 in Klein Glienicke bei Potsdam) Buch Der Tunnel gibt es einen Artikel auf Wikipedia: Der Tunnel.
- ↑ Zu Engelbert Humperdincks (* 1. September 1854 in Siegburg; † 27. September 1921 in Neustrelitz) Oper Hänsel und Gretel schrieb seine Schwester Adelheid Wette (* 4. September 1858 in Siegburg; † 9. August 1916 in Eberstadt) den Text der Oper. Einen Artikel zur Oper gibt es auf Wikipedia: Hänsel und Gretel.
