Hauptmenü
Sie sind hier
Die Verschleppten von Krapschaken
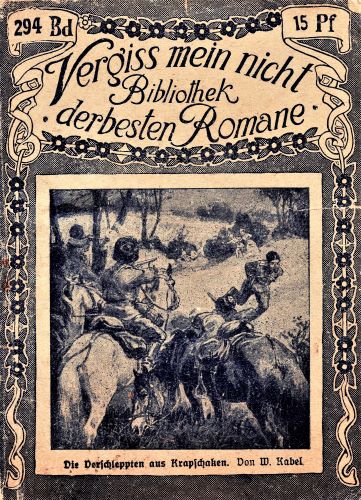
Vergiß mein nicht
Bibliothek der besten Romane
Band 294
Die Verschleppten von Krapschaken.
Roman von
W. Kabel.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.
Dresdenerstraße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.
1. Kapitel.
In diesen aufregenden Tagen hatte die Apotheke in Krapschaken einen Umsatz an harmlosen Tränkchen und Mittelchen, die ohne Rezept abgegeben werden durften, wie nie zuvor seit den acht Monaten ihres Bestehens.
Das lag nicht etwa an einer plötzlichen Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes in dem neunhundert Seelen etwa zählenden Kirchdorfe. Keineswegs. Die Krapschaker erfreuten sich von jeher außerordentlich widerstandsfähiger Körper. Und auch der plötzliche Ausbruch des Riesenkampfes zwischen England und den Handlangern englischen Großspekulantentums, Serbien, Rußland und Frankreich einerseits und den beiden europäischen Zentralmächten anderseits hatte den Nerven der Krapschaker aus dem einfachen Grunde wenig geschadet, weil diese Glücklichen in der überwiegenden Mehrzahl nichts von Nerven und deren gelegentlichem Versagen wußten.
Der Grund für die Völkerwanderung nach dem „Storchnest“, wie die Ortseingesessenen die neue Offizin bald gekauft hatten, lag dennoch in dem Kriegszustande. Um dies schon verstehen, sei erwähnt, daß es in Krapschaken außer dem Fernsprecher der Postnebenstelle noch zwei weitere dieser modernen Ferngesprächverständigungsmittel gab – eins bei dem Arzt Dr. Neuben und das zweite eben in der Apotheke „Zum Storchnest“.
Da die nächste größere Stadt Eydtkuhnen nicht weniger als sieben Meilen entfernt war, bildete der elektrische Draht für die Krapschaker die einzige zuverlässige Nachrichtenquelle über die Ereignisse da draußen in der aus ihrer Ruhe so unsanft aufgerüttelten großen Welt.
Doch der Fernsprecher der Postnebenstelle und der beim Herrn Doktor übermittelten den Dorfbewohnern aus sehr verschiedenen Gründen gleich nach der Mobilmachung keinerlei Neuigkeiten mehr. Der alte, schon etwas kindische Postverwalter Sensfuß war nämlich schon am Sonntagvormittag durch einen jungen, sehr schneidigen Beamten abgelöst worden. Dieser stellte die Zugeknöpftheit in Person dar. Von ihm erfuhr niemand etwas. „Dienstgeheimnis!“ schnauzte er jeden an, der sich eine Dreipfennigmarke holen kam und die Gelegenheit benutzte, so nebenbei zu fragen, wie es denn mit dem Kriege eigentlich stehe. Und der Doktor Neuber wieder hatte seine Wohnung schon am Sonnabend verschlossen, seine Haushälterin entlassen und war nach Königsberg abgereist, weil er sich dort als Oberarzt der Reserve bereits am Sonntagabend stellen mußte.
Natürlich hatte es sich in Krapschaken sehr schnell herumgesprochen, daß der Storchnest-Apotheker der einzige sei, von dem man in diesen wildbewegten Tagen neues erfahren könne. Daher auch der beispiellose Umsatz an Wundsalbe, Augenwasser, Kampherspiritus und ähnlichen Mitteln gegen weitverbreitete Gebrechen.
Erwin Pelchersen hatte soeben für August Spelnik, den reichsten Besitzer des Dorfes, den Getreidehändler Seligsohn in Eydtkuhnen angerufen und diesem mitgeteilt, daß Spelnik ihm den Roggen nun doch um zwei Mark den Doppelzentner billiger überlassen wolle, worauf Seligsohn offenbar in höchster Eile und Aufregung geantwortet hatte, er würde sich das Angebot für das erste Erntejahr nach Friedensschluß notieren. Vorläufig mache er keine Geschäfte mehr. Und von morgen ab sei er bei seinem Schwiegersohn Politscher in Königsberg, Ferngespräch Nummer 1824, zu finden.
Spelnik, eine mächtige Gestalt mit gebräuntem Gesicht, stieß eine Verwünschung aus, murmelte etwas von „feigem Pack“, zahlte sein Zehnpfennigstück für Heftpflaster und stapfte hinaus, ohne sich bei dem Apotheker für die Gefälligkeit irgendwie zu bedanken.
Pelchersen lächelte nur. Er kannte den Hünen schon von dieser Seite. Doch sein Hausdiener, den er gleichzeitig so etwas als Gehilfen beschäftigte, weil dieser Karl Timuleit ein äußerst geschickter und anstelliger Mensch war, trat jetzt aus dem kleinen Nebenraum heraus und sagte ärgerlich:
„Unhöflich ist die Gesellschaft – geradezu unglaublich!“
Der Storchnest-Apotheker drohte ihm mit dem Finger.
„Karl – vergessen Sie nicht, daß Sie von dem Mann sprechen, den Sie gern Schwiegervater nennen möchten …!“
Timuleit, ein schlanker, hübscher Bursche mit keck aufgedrehtem Schnurrbärtchen seufzte tief auf. Und dieser Seufzer kam offenbar aus einem schwer bedrückten Herzen.
„Ach, Herr Pelchersen, – – Schwiegervater …!! Hat sich was! Die Grete Spelnik war für mich im Frieden schon so gut wie unerreichbar. Und jetzt im Kriege, wo ich doch übermorgen in Königsberg schon bei den Kronprinz-Grenadieren als Reservist den bunten Rock anziehen werde, – lieber Gott, da muß ich das Mädchen mir ganz aus dem Sinn schlagen. Es war überhaupt ein Unsinn von mir, mich in sie zu vergaffen. Aber wer kann für seine Gefühle…“
Draußen auf der holprigen Dorfstraße ratterte ein leichter Jagdwagen vor die Apotheke und hielt mit scharfem Ruck.
Die beiden Braunen, selten schöne Tiere, dampften und warfen die Schaumflocken mit unruhigen Köpfen nach allen Seiten hin.
Karl Timuleit war an das Fenster getreten.
„Donner, der Herr Hartwig muß es aber eilig haben!“ meinte er. „Der jagt doch sonst seine Gäule nicht so ab.“
Da erschien auch schon des Gutsbesitzers hagere Gestalt vor dem Verkaufsfenster.
Erwin Pelchersen, der nur mit den Zehen des rechten Fußes einer kleinen Beinverkürzung wegen auftreten konnte und daher leicht hinkte, hatte schnell die Scheibe geöffnet und begrüßte Hartwig mit beinahe übertriebener Liebenswürdigkeit. Neben diesem war jetzt auch eine junge Dame sichtbar geworden, die dem jungen Apotheker ein zwangloses „Guten Tag, Herr Pelchersen“ zurief und sich dann an den Gutsbesitzer wandte:
„Papa, vergiß nicht für Fräulein Borchardt die Migränepulver mitzubringen. Ich werde inzwischen nach der Post fahren und die Depesche aufgeben, wenn es dir recht ist.“
„Gewiß, Mädel! Mach’, daß du fortkommst.“
Erna Hartwich nickte Pelchersen flüchtig zu und trat wieder auf die Straße hinaus, – zur großen Enttäuschung des Apothekenbesitzers, der schon gehofft hatte, wenigstens einige Minuten die Gegenwart des jungen Mädchens genießen zu dürfen.
„Hören Sie, Verehrtester,“ begann da der Gutsbesitzer auch schon, indem er sich auf das wagerechte Brett vor dem Verkaufsfenster lehnte, „haben Sie eigentlich noch Verbindung mit Eydtkuhnen …? Ich komme zu Ihnen, da der neue Postverwalter ein patentierter Hornochse ist, der den verknöcherten Beamten bei jeder Gelegenheit herauskehrt. Ungefällig ist der Mensch – unglaublich! Na – ich habe ihm schon gestern gehörig Bescheid gesagt. Wir sind fertig miteinander. Da tun Sie mir wohl den Gefallen und rufen mal für mich den Landrat in Eydtkuhnen an. Aber ein bißchen eilig. Ich will wissen, was ich mit meinen russischen Erntearbeitern machen soll. Die Gesellschaft muß schleunigst abgeschoben werden. Die ganze Bande ist sternhagelvoll betrunken und macht Miene frech zu werden.“
„Sehr gern, Herr Hartwich. – Ist denn Ihre Leitung nach der hiesigen Post hin unterbrochen?“
„Ach so – das vergaß ich zu erwähnen. Ja, denken Sie, vor einer Stunde will ich telephonieren. Hat sich was! Niemand meldet sich. Schließlich lasse ich anspannen, um hier bei Ihnen mein Glück zu versuchen. Auf dem Weg gerade in der alten Tannenschonung finde ich dann die Leitungsstangen sämtlich unterbrochen, und der Draht ist an einem Dutzend Stellen zerschnitten. Natürlich hat das so ein Kerl von dem russischen Erntegesindel besorgt, der wahrscheinlich im Neben- oder besser im Hauptberuf Spion ist.“
Pelchersen stand schon am Fernsprecher. Aber – auch hier meldete sich niemand.
Hartwig wurde ungeduldig.
„Nette Schweinerei!“ rief er durch die offene Scheibe hindurch. „Ist denn an Ihrem Apparat auch was in Unordnung …!“
„Bewahre! Ich habe ja vor kaum fünf Minuten noch mit Seligsohn in Eydtkuhnen gesprochen. Ich fürchte fast, daß …“
Auf der Straße raste der Hartwigsche Jagdwagen vor das Haus. Und Erna Hartwig stand halb aufrecht darin und rief mit heller Stimme in die offene Eingangstür der Apotheke hinein:
„Papa – Papa – schnell nach Hause! Die Post ist von russischer Kavallerie besetzt, von Kosaken …“
Der Gutsbesitzer stand einen Augenblick wie erstarrt da. Dann war er mit zwei Sätzen am Wagen, sprang auf den Bock, riß dem Kutscher Leine und Peitsche aus der Hand und hieb auf die Braunen ein, die wie wild davonstürmten.
Die beiden Männer in der Apotheke, die nun schon acht Monate so gut mit einander ausgekommen waren, schauten sich stumm an. Dann sagte Pelchersen leise:
„Das habe ich geahnt …“
Und Karl Timuleit erklärte:
„Ich auch. – Was tun wir nun, Herr Pelchersen?“
Der Apotheker hörte kaum hin. Die Sorge um Erna Hartwig ließ ihn alles andere vergessen. Hastig schritt er in den Flur hinaus und trat vor die Tür.
Karl Timuleit hatte sich seinem Herrn angeschlossen. Beide standen mitten auf der Straße und schauten nach dem Hartwigschen Wagen aus. Nach Osten zu über den größeren Teil des Dorfes hinspähend, stellten sie sofort fest, daß es in Krapschaken wie in einem aufgestörten Ameisenhaufen zuging und daß der Feind durch eine weite Kette von Posten das Dorf förmlich umzingelt hatte.
Weiber, Kinder und ältere Männer – der männlichen Dorfjugend überwiegende Mehrzahl war zum Glück schon zu den Fahnen geeilt und nach den verschiedenen Garnisonorten unterwegs – flohen überall einzeln und in Gruppen querfeldein dem Walde zu und liefen so den Kosakenposten geradezu in die Arme. Plötzlich knallten in der Ferne auch einzelne Schüsse. Hier und da rannten die Flüchtlinge schon wieder nach ihren Wohnstätten hin. Nun kam auch in die Nachbarhäuser der Apotheke unruhiges Leben hinein. Ein paar Leute liefen die Dorfstraße entlang, bleich und kopflos. Das eine Wort „Russen!“ flog von Mund zu Mund. Verängstigte Menschen umdrängten schutzsuchend den Apotheker, zu dem man längst trotz seiner Jugend Vertrauen gefaßt hatte. Pelchersen sollte raten, helfen.
Er zuckte nur die Achseln und deutete stumm auf die feindlichen Reiter, die einzeln und zu zweien überall in den umliegenden Feldern sichtbar waren.
Abermals Schüsse, verhallendes Geschrei. Der harte Klang der Karabiner dröhnte laut und aufreizend durch die stille, heiße Luft des klaren Augusttages. Und jetzt stiegen mit einem Mal zwischen den fruchtschweren Bäumen der Obstgärten drüben im Ostteil verschiedene Rauchsäulen auf. Die Schüsse mehrten sich. Die kleinen Pferde der Kosaken erschienen zwischen den Anwesen, verschwanden wieder. Dann sprengten einige dieser gefürchteten halbwilden Reiter auch auf die Gruppe Menschen zu, die sich um Erwin Pelchersen angesammelt hatte.
Alles stob auseinander. Nur der blasse Apotheker mit den drei Narben auf der linken Wange und Karl Timuleit blieben stehen. Letzterer freilich nur, weil sein Herr es verschmähte, sich wie die anderen irgendwo zu verkriechen.
Pelchersens Lippen, über denen der kurz geschnittene, blonde Schnurrbart wie eine Bürste lag, waren fest aufeinander gepreßt. Die Hände in die Taschen der hellgrauen Jacke seines leichten Sommeranzugs vergraben, schaute er den fünf Reitern entgegen. Deren Äußeres war ihm nichts neues mehr. Wozu wohnte man hier denn so nahe der Grenze?! – Freilich – erst vor zwei, drei Monaten waren die Kosaken drüben in Rußland in den Grenzgebieten aufgetaut und hatten deren Überwachung anstelle der Dragoner übernommen. Nun war es ja klar, weshalb man sie hier nach dem Osten gebracht hatte. Man brauchte sie eben für den Krieg, den England und seine Verbündeten heraufzubeschwören längst entschlossen gewesen waren.
Jetzt waren die fünf wüst aussehenden Reiter heran, zügelten ihre kleinen Gäule dicht vor den beiden Deutschen und hielten die Lanzen stoßbereit.
Erwin Pelchersen lächelte diese Banditen des allmächtigen Zaren beinahe freundlich an. Sehr zu Karl Timuleits Entsetzen, der befürchtete, die braunen, schmutzigen Kerle könnten dieses Lächeln falsch verstehen. Noch mehr staunte er aber, als sein Herr jetzt eine Bewegung mit der Hand machte, als ob er einen Becher zum Munde führen und austrinken würde.
Und doch war diese Behandlung des Feindes die richtige, wie sich sofort zeigte.
Die Kosaken brüllten eifrig nicken auf Pelchersen ein. Der lächelte wieder, winkte ihnen zu und schritt in die Apotheke hinein, füllte hier einen Korb mit Rumflaschen und ließ ihn von dem Hausdiener auf die Straße tragen.
Im Nu hatten die inzwischen abgestiegenen fünf Kerle die Flaschen in den Taschen ihrer Sättel verstaut, und Pelchersen und Karl schleppten eine zweite Ladung herbei, die der Feind sofort auf seine Güte hin probierte.
Aber keine Flasche rührten sie an, bevor nicht der arme Apotheker daraus eine Probeschluck genommen hatte.
Pelchersen schüttelte sich vor Widerwillen. Aber er trank. Und dabei war er das gar nicht gewöhnt. Dann erbarmte sich schließlich Karl seiner und lieferte bei der dritten Flasche den Beweis für die Kosaken, daß der Inhalt nicht vergiftet sei.
Eine Verständigung mit den Russen war nur durch Zeichen möglich. Sie verlangten jetzt etwas zu essen. Und Timuleit übergab ihnen dann den ganzen Vorrat an Dauerwürsten, der in der Speisekammer hing. Nein – doch nicht den ganzen … Einige zerschnitt er schnell und verbarg sie in seinen Taschen. Man konnte ja nicht wissen, ob die Bande das Dorf nicht völlig ausplündern würde … Und – der kluge Mann baut vor.
Die braunen Banditen trennten sich jetzt. Zwei nahmen die beiden Deutschen in die Mitte und führten sie nach der Kirche zu davon. Pelchersen sträubte sich erst ihnen zu folgen. Als die Kerle dann aber ihre bisherige Freundlichkeit in nicht mißzuverstehende Bewegungen mit ihren Lanzen übergehen ließen, gab er schnell jeden Widerstand auf.
Die drei anderen schienen die umliegenden Häuser nach jüngeren Männern absuchen zu wollen. Daß der Apotheker mit dieser seiner Vermutung recht hatte, zeigte sich, als man auf dem freien Dorfplatz anlangte, der zwischen der Kirche, dem Pfarrhause, der Post und dem Anwesen des reichen August Spelnik lag.
Hier hatten die Kosaken inzwischen bereits einige zwanzig junge Burschen zusammengetrieben. Die Gruppe dieser war das erste, was Pelchersen sah. Dann schrak er zurück. Da stand auch der Hartwigsche Jagdwagen vor dem Pfarrhause, und neben ihm lag auf dem grünen Rasen die hagere Gestalt des Gutsbesitzers, dessen Kopf Erna Hartwig in ihren Schoß gebettet hatte.
Und ein paar Schritte weiter redete Pfarrer Günther auf zwei Offiziere der Kosaken eifrig ein, während die Frau Pastor soeben mit einer Schüssel Wasser und ein paar Leinenbinden in den Händen auf den offenbar verwundeten Hartwig zueilte.
Erwin Pelchersen trat neben Erna Hartwig, die ihm aus leichenblassem Gesicht mit weiten Augen entgegenschaute.
Ehe er noch etwas fragen konnte, sagte sie schon:
„Helfen Sie meinen Vater verbinden. Die Schufte haben ihn durch die Brust geschossen, als wir im Wagen zu fliehen suchten …“
Sie liebte die starken Ausdrücke ebenso wie der Gutsbesitzer selbst, der jetzt bewußtlos und blutig am Boden lag.
2. Kapitel.
Erna Hartwig hatte recht laut gesprochen, obwohl sie wußte, daß der Jüngere der beiden Kosakenoffiziere ganz gut das Deutsche beherrschte.
Tatsächlich war sein Kopf auch bei dem Ausdruck „Schufte“ herumgeschnellt. Ein finsterer Blick traf die junge Deutsche, der dieser allerdings entging, dafür aber von Erwin Patterson bemerkt wurde, der der vor innerer Erregung bebenden Landsmännin denn auch hastig zuflüsterte:
„Gnädiges Fräulein, nehmen Sie sich in acht. Der Russe scheint Deutsch zu verstehen. Sie werden sich Unannehmlichkeiten zuziehen …“
„Er versteht Deutsch! Was schadet’s! Hören Sie doch, er unterhält sich ja mit Pfarrer Günther ganz gewandt. Mir ist alles gleichgültig – alles! Es sind Schufte …! Der Weg war uns ohnehin versperrt. Lediglich aus Mordlust haben sie gefeuert, ebenso wie sie hier auch vorhin eine fliehende Bäuerin und den geistesschwachen Krüppel, den das Dorf als Hütejungen angestellt hatte, niedergeknallt haben …“
Erna Hartwigs Lippen zitterten vor innerer Empörung, und wenn ihr nicht die Pastorin beschwichtigend etwas zugeraunt haben würde, hätte sie vielleicht noch mehr gesagt.
Jetzt kam Pfarrer Günther, ein wohlbeleibter Herr mit langem grauen Vollbart, auf die Gruppe neben dem Wagen zu. Sein sonst so gemütliches Gesicht sah unheilverkündend ernst aus und hatte eine Färbung, die ins Aschgraue spielte.
Mit zusammengepreßten Lippen sah er zu, wie Pelchersen mit Hilfe der Pastorin die kleine Kugelwunde des Gutsbesitzers, die etwa zwei Finger breit über dem Herzen saß, verband.
In dieser behutsamen Arbeit wurden die beiden Samariter immer wieder durch die lauten Befehle gestört, die der jüngere der feindlichen Offiziere seinen Leuten erteilte.
Der herumstehenden Kosaken hatte sich mit einem Mal eine gewisse Aufregung bemächtigt. Das mochte mit einer Meldung zusammenhängen, die dem älteren Offizier, einem Rittmeister mit vollständig mongolischem Gesichtsschnitt, soeben überbracht worden war.
In Eile wurden vier auf Pferde verteilt gewesene Maschinengewehre jetzt zusammengesetzt und dann auf ihren fahrbaren Gestellen im Laufschritt von der Bedienungsmannschaft davongerollt. Auch blieben auf dem Platz vor der Kirche zur Bewachung der Gefangenen nur zehn Kosaken zurück, während der Leutnant mit den übrigen nach Osten zu zwischen den Gärten verschwand.
Mit größter Spannung hatte der Pfarrer all dies beobachtet. Nun beugte er sich näher zu seiner Gattin und Pelchersen hin.
„Gott gebe, daß meine Vermutung zutrifft,“ sagte er leise. „Ich glaube, eine Abteilung unserer Truppen ist im Anmarsch. Vielleicht entgehen wir noch dem Schicksal, nach Rußland verschleppt zu werden.“
Der junge Apotheker war mit dem Verband fertig und erhob sich aus seiner knienden Stellung.
„Verschleppt werden …? Beabsichtigen die Russen dies? Aus welchem Grunde denn?“ fragte er beklommen.
Günther nickte traurig.
„Als Geiseln wollen sie uns mitnehmen – und dazu noch alle wehrfähigen Männer. – Als Geiseln …!“ Er lachte bitter auf. „Ein lächerlicher Vorwand ist’s! Daß sie die jungen Leute entfernen wollen, die später gegen sie die Waffen ergreifen könnten, das mag noch hingehen. Aber mich, die Damen und auch Sie, lieber Pelchersen davonzuführen, der Sie doch ein körperliches Gebrechen haben, – nur freventlichen Übermut kann man das nennen …! Hier geht eben Gewalt vor Recht …!“
Die Pastorin war blaß geworden.
„Wie, uns alte Leute …?! Das ist doch undenkbar …!“ stotterte sie. „Geiseln verlangt man doch nur, wenn man sich sichern will, daß der andere Teil eine eingegangene Verpflichtung auf jeden Fall einhält. Von derartigem ist hier doch keine Rede. Lassen denn die Offiziere gar nicht mit sich …“
Ein wüster Lärm, der aus dem nahen Wohnhause des reichen Bauern August Spelnik hervordrang, ließ die Pastorin verstummen.
Die Köpfe aller Deutschen, die hier unter Aufsicht der Kosaken ihr weiteres Schicksal abwarten mußten, flogen nach jener Richtung hin. Man hörte Spelniks dröhnende Stimme, das helle Kreischen eines Weibes, lautes Gelächter …
Auch der Rittmeister, der sich, eine Zigarette im Munde, auf die Steintreppe des Pfarrhauses gesetzt hatte, horchte auf. Dann erhob er sich schnell und schritt durch die offene Pforte in den großen Garten hinein, der zu der Pastorenwohnung gehörte. Das machte ganz den Eindruck, als ob er nicht Zeuge irgendwelcher Gewalttätigkeiten seiner Leute sein wollte.
Plötzlich verstummte der Lärm. Bisher hatten die auf dem Dorfplatz Stehenden nichts von den Personen gesehen, die diesen wildbewegten Auftritt verursacht hatten oder aber gegen ihren Willen daran teilnehmen mußten.
Jetzt im Hause Spelniks ein paar Schüsse, ein gellender Aufschrei und das Durcheinander lauter Flüche und Verwünschungen in einer fremden Sprache.
Dann stürzte Grete Spelnik, die älteste Tochter des Bauern, aus der Eingangstür heraus, blieb einen Augenblick wie geblendet von dem grellen Mittagssonnenschein des Augusttages stehen und flüchtete weiter in die sich ihrer schützend entgegenstreckenden Arme der Pastorin.
Die Kleidung des hübschen, vielleicht achtzehnjährigen Mädchens war zerrissen, das blonde Haar in Unordnung und in ihren Blicken ein so starres Entsetzen, daß die Deutschen ringsum in der Vorahnung schrecklicher Dinge in ohnmächtiger Wut die Fäuste ballten.
Nun erschien auch der Bauer selbst mit blutüberströmtem Gesicht, geführt von zwei Kosaken, in der Haustür. Und hinter diesen dreien trug man den Körper eines regungslosen Feindes hinaus, den Spelnik mit einem schweren Eichenstuhl zu Boden geschmettert hatte.
Das Rachegeschrei der vertierten Reiter schwoll zu nervenaufreizender Höhe an, verstummte aber ebenso schnell, als nicht allzu weit von Osten her mit einem Schlage das taktmäßige Knattern mehrerer Maschinengewehre einsetzte, in das sich sofort der hellere Klang von Karabinerschüssen mischte.
„Deutsche!“ sagte Pastor Günther leise und warf einen flehenden Blick zum Himmel empor.
Da kam auch schon der Rittmeister aus dem Garten herbeigerannt, schwang sich auf sein Pferd und jagte in Richtung des immer lebhafter werdenden Feuergefechts davon.
Eine bange Viertelstunde verstrich den Gefangenen mit Hoffnungen und lautlosem Flehen für deutsches Waffenglück. Um sie herum machten aufgeregt die Kosaken mit drohenden Lanzen und noch drohenderen Blicken die Runde.
Bitter und trostlos dann die Enttäuschung, als die Karabinerschüsse immer entfernter klangen, und auch die Maschinengewehre langsam verstummten.
Bald herrschte da vorn wieder Stille wie zuvor. Und Günther und Pelchersen schauten sich ernst und vielsagend an. Gegen die Maschinengewehre hatte die deutsche Streifpatrouillen, denn nur eine solche konnte hier so unerwartet aufgetaucht sein, nichts ausrichten können.
Dann kamen der Rittmeister und der Leutnant zurückgesprengt. Befehle hallten über den Platz. Bei den Gefangenen blieben nur noch drei Kosaken zurück. Die übrigen verschwanden nach der Dorfstraße hin.
Der Leutnant ließ sich jetzt August Spelnik vorführen und nahm ihn ins Verhör. Jedes Wort verstand man. Der Russe sprach wirklich überraschend gut Deutsch.
Der Bauer verteidigte sich wortkarg in verbissenem Grimm.
„Ich werde doch wohl das Recht haben, meine Tochter zu schützen …! Ihre Leute sind selbst schuld daran, daß ich mich an dem … Manne vergriff.“
Der Russe lächelte rachsüchtig, ließ Spelnik stehen und trat auf den Rittmeister zu. Beide flüsterten lange miteinander.
Inzwischen rollten mehrere Leiterwagen, die die Kosaken schnell mit je vier Pferden bespannt hatten, vor das Pfarrhaus. Auf die Wagen waren ein paar Bunde Stroh geworfen worden, ebenso allerlei Sachen, die die Feinde in Eile aus den Häusern geraubt hatten. Und immer zahlreicher wurden jetzt auch die Rauchwolken, die wirbelnd aus den in Brand gesteckten Häusern hochstiegen. Feurige Lohe schimmerte bereits hier und da durch das Grün der Bäume. Auch aus August Spelniks großer Scheune schossen jetzt zwischen den roten Ziegeln des Daches feine Rauchstreifen auf.
Krapschaken brannte an allen Ecken und Enden. Und die zum Himmel emporflackernden Rauch– und Feuersäulen, das jammervolle Blöken verbrennenden Viehs, das kopflose Durcheinanderrennen der zurückbleibenden Bewohner waren die letzten Eindrücke, die die aus der Heimat Verschleppten auf ihre traurige Fahrt ins Ungewisse mitnahmen.
Die jagende Hast, mit der die Russen zuletzt den Aufbruch beschleunigt hatten, bewies, daß sie sich in dieser Gegend nicht mehr sicher fühlten. Der eigentliche Leiter dieses aus vielleicht hundert Mann bestehenden Streifkorps, das sich sehr geschickt durch die Wälder bis in den Rücken der deutschen Grenzschutztruppen geschlichen hatte, war der Leutnant, ein noch junger Mensch, der dem bequemen Rittmeister bereitwilligst alle Arbeit abnahm, nur um seinem Hasse gegen die Deutschen desto ungezügelter nachgehen zu können. –
Die Beratung zwischen den beiden Kosakenoffizieren über das Schicksal August Spelniks hatte einen den Lieutenant wenig befriedigenden Verlauf genommen. Davon, den frechen Deutschen, der dem Demitri Pugieff den Schädel deswegen eingeschlagen hatte, weil dieser der Tochter des Bauern gegenüber zudringlich geworden war, sofort an die nächste Mauer zu stellen und niederzuknallen, wollte der Rittmeister nichts wissen. Er besaß noch so viel Gerechtigkeitsgefühl, um sich zu sagen, daß er in Spelniks Lage kaum anders gehandelt haben würde. Gerade da er ebenfalls verheiratet war und zwei Töchter hatte, entschied er sich dahin, die Aburteilung des Deutschen einem russischen Kriegsgericht zu überlassen. Im übrigen gab er seinem Leutnant aber völlig freie Hand hinsichtlich der Auswahl und Zahl der mitzunehmenden Geiseln und aller weiteren Anordnungen. Das Niederbrennen der Ortschaft geschah auf höheren Befehl und berührte ihn daher nicht weiter. Hatten seine Leute doch kurz vor dem Aufbruch zu dieser Streife besonders präparierte lange Streifen mit einer leicht brennbaren Masse erhalten, damit das Anzünden der Gebäude schneller vor sich gehe.
Das arme Krapschaken war eines der ersten Dörfer, welches der Russe wahrscheinlich als eine der kleineren Brutstätten des „preußischen Militarismus“ dem Erdboden gleichzumachen suchte.
Der Leutnant, ärgerlich, daß er seinen Morddurst nicht an dem deutschen Bauern hatte stillen können, befahl jetzt die Abfahrt. Außer dem Pastorenpaar, Pelchersen, Timuleit, Spelnik und den beiden Hartwigs mußten auch Grete Spelnik sowie der greise Gemeindevorsteher von Krapschaken namens Bulka die Reise ins „heilige“ Rußland hinein mitmachen. Kein Sträuben, keine Bitten halfen. Roh wurden die Gefangenen auf die Wagen verladen. Die Jungen, wehrfähigen Männer füllten allein vier der Gefährte. Auf einem fünften befanden sich nur Beutestücke. Und der sechste wieder beherbergte die zuerst aufgezählten Personen.
So setzte der Zug sich in Bewegung. In flottem Trab führten die Kosaken die Wagen auf einem Feldweg nach Südosten zu dem Walde entgegen. Die kleinen Gäule der braunen Reiter waren mit allerlei Päckchen und Paketen behängt, und die Mehrzahl dieser Mordbrenner hatte die Gelegenheit benutzt, sich bis zur halben Bewußtlosigkeit an den in dem Dorf vorgefundenen Spirituosen zu betrinken.
Das waren die Begleitmannschaften, denen einige neunzig Deutsche jetzt auf Gnade und Ungnade ausgeliefert waren. Für die Tränen der drei Frauen in dem vorderstem Wagen, für die vor Entsetzen starren Gesichter der Männer, die die Blicke nicht von der brennenden Heimat wenden konnten, bis der Zug in den Wald einlenkte, hatte die entmenschte Horde nur ganze Salven schadenfrohen Hohngelächters.
Pfarrer Günther saß neben Erwin Pelchersen auf einem Strohbündel. Ein Stück weiter hockten ebenso die drei Frauen in dem stoßenden, hin und herschwankenden Wagen. Zwischen ihnen lag der Verwundete Hartwig, möglichst weich gebettet.
Der Gutsbesitzer war jetzt bei Bewußtsein. Soeben hatte der Pastor ihm schonend mitgeteilt, was diese Wagenfahrt zu bedeuten habe.
Da hatte der wunde Mann einen Schrei ausgestoßen, in dem sich all sein unendlicher Grimm über die Freveltaten der Russen zusammendrängte. Halb aufgerichtet hatte er sich, und seine zur Faust geballte Rechte drohte nach dem Leutnant hin, der neben dem Wagen her ritt und sich an den Seelenqualen gerade dieser Gefangenen weidete, die er mitten aus ihrer ahnungslosen, friedlichen Ruhe herausgerissen hatte.
Ein Blutstrom, der aus der durchschossenen Lunge des Gutsbesitzers in den Mund drang, verhinderte es, daß die berechtigten Schmähungen laut wurden, die Hartwig gegen den Offizier auf der Zunge hatte.
Erna war beim Anblick des roten Lebenssaftes, der schaumig über das Kinn auf die Kleider rieselte, hochgeschnellt und warf sich neben dem Kranken in die Knie. Auch Pelchersen suchte ihr zu helfen, so gut es ging, während der Pastor dem Leutnant bittend zurief:
„Lassen Sie halten, um der Barmherzigkeit willen, oder der Verwundete stirbt in diesem stoßenden und schwankenden Wagen sehr bald …!“
Als Antwort gab der Leutnant seinem Pferde die Sporen und gesellte sich zu dem ganz vorn reitenden Rittmeister.
Auf dem schmalen Weg, den der Zug jetzt im Walde einschlug, gab es unzählige Baumwurzeln, über die die Räder regelmäßig mit einem hohen Satz hinwegglitten. Der Körper des Verwundeten flog dauernd hin und her. Der Blutstrom quoll weiter. Tiefe Schatten breiteten sich unter Hartwigs Augen aus. Längst umfing ihn wieder eine wohltuende Ohnmacht. Aber Erwin Pelchersen sah nur zu deutlich, daß diese Bewußtlosigkeit unfehlbar in den Tod übergehen würde, wenn der bedauernswerte Mann noch länger auf dem dahinjagenden Leiterwagen blieb.
So drängte der Apotheker sich dann an Spelnik und dessen Tochter vorbei nach vorn, wo der die Zügel haltende Kosak saß, griff in die Tasche, reichte dem Mann ein Goldstück und wies dabei nach rückwärts auf den in seinem Blut schwimmenden Gutsbesitzer, indem er gleichzeitig nach dem Zügeln griff, um den Wagen anzuhalten.
Doch der Kosak, der um sich her einen widerlichen Geruch von Fusel und anderen Ausdünstungen verbreitete, gab Pelchersen einen Stoß vor die Brust, daß dieser gegen Spelnik flog und beide wieder den Pastor umrissen, der quer über den Verwundeten fiel und sich seinen Anzug völlig mit Blut beschmutzte.
Wieder brüllten die Kosaken vor Lachen.
Und unter diesen Heiterkeitsausbrüchen der vertierten Bande starb Friedrich Hartwig ganz plötzlich. Pelchersen sah die Todeszeichen auf dessen Gesicht, sah die Wangen sich verfärben, die Züge sich verändern …
Er gab Günter einen Wink. Und der Pastor kniete neben Erna Hartwig nieder, zog sie sanft an sich und flüsterte auf sie ein.
Erna nahm die mit so viel Zartgefühl ihr beigebrachte Mitteilung von dem Tode ihres Vaters mit unnatürlicher Ruhe hin.
Kein Schrei des wildaufflackernden Schmerzes, keine Träne, – nichts – nichts …
Nur ihre Augen wanderten nach vorwärts, wo der Leutnant an der Spitze des Zuges neben dem Rittmeister dahintrabte …
3. Kapitel.
Erwin Pelchersen machte einem der nüchternen Kosaken durch Zeichen klar, daß der Gutsbesitzer gestorben sei und daß der Rittmeister hiervon benachrichtigt werden müsse.
Der Mann, ein graubärtiger Alter, setzte denn auch seinen struppigen Gaul im Trab und erstattete seinem Vorgesetzten Meldung. Dieser schien davon aber keinerlei Notiz zu nehmen. Pelchersens Hoffnung, daß man Erna Hartwig mit der Leiche ihres Vaters vielleicht am Wege zurücklassen würde, verwirklichte sich jedenfalls nicht.
Der Pastor und Erna vermochten für die Gemütsroheit, die in dieser Handlungsweise der beiden Russen lag – denn dem Leutnant hätte es sicherlich nur ein Wort der Überredung bei dem Rittmeister gekostet, den Toten wenigstens auf einem anderen Wagen unterbringen zu lassen, kein Wort des Abscheus zu finden. Desto empörter äußerten sich die übrigen Insassen dieses Gefährts. Aber sie änderten nichts dadurch.
Die Fahrt ging im Eiltempo weiter. Die Leiche hatten man nach hinten in den Wagen geschafft und dort mit Decken verhüllt. –
Drei Stunden dauerte dieser fluchtähnliche Rückzug des Kosakenstreifkorps nun schon. An mancherlei merkten die gefangenen Deutschen, daß ihre Entführer sich keineswegs sicher fühlten.
Die Russen hatten nicht nur eine Spitze unter einem offenbar ortskundigen Unteroffizier vorausgeschickt, sondern sich auch nach beiden Flanken hin durch eine Kette von Reitern geschützt. Die Deutschen konnten beobachten, wie ständig bei dem Rittmeister Meldungen einliefen, auf die hin die beiden Offiziere immer wieder ihre Karten einsahen. Einige Male bogen sie von dem bisherigen schmalen Wege in kaum befahrbare Seitenpfade ein. Spelnik, der die Umgegend von Krapschaken wie seine Tasche kannte, erklärte, daß die Kosaken auf diese Weise einzeln liegenden Gehöften ausbogen und dies wahrscheinlich zu dem Zweck, damit die Bewohner nicht später ihre Marschrichtung verraten konnten.
So war es vier Uhr nachmittag geworden.
Da schien plötzlich eine besondere Nachricht eingelaufen zu sein. Die Wagen hielten mit einem Male und bogen dann in einen hochstämmigen Kiefernbestand ein, der bald in eine weite, von dichten Gebüschgruppen bedeckte Lichtung überging. Hier wurden in einem geeigneten Versteck inmitten einer von hohen Haselnußsträuchern umgebenen Bodensenkung die Wagen nebeneinander aufgefahren, die Pferde ausgespannt und ein längerer Aufenthalt vorbereitet.
Den wehrfähigen jungen Deutschen wurde ein besonderer Platz zum Lagern angewiesen, während die Insassen des ersten Wagens neben diesem sich niederlassen durften.
Hier baute der findige Karl Timuleit schnell aus den Wagenleitern und den vorhandenen Decken für die drei weiblichen Leidensgenossen eine Art Zelt, so daß die Frauen wenigstens vor der Sonnenhitze etwas Schutz fanden.
Inzwischen war Erna Hartwig in Begleitung Pastor Günthers zu den beiden Offizieren gegangen, die sich im Schatten der Sträucher in das hohe Gras hingestreckt hatten.
Der Leutnant machte den Dolmetscher. Nach längerem Hin und Her erlaubte der Rittmeister, daß der Tote unter einer einzelnen stehenden Tanne begraben werden dürfe. Die Bitte, das junge Mädchen freizugeben, lehnte er nach kurzer Beratung mit dem Leutnant ab.
Umsonst hatte der Pfarrer diesem eindringlich ins Gewissen geredet und wiederholt betont, daß jetzt keinerlei Grund mehr vorliege, Erna Hartwig als Gefangenen mitzunehmen. Der junge Offizier, den der Rittmeister stets vertraulich mit Iwan Assumoff anredete, erklärte barsch, die Entscheidung hierüber möge der Pastor gefälligst den Offizieren überlassen.
Gedemütigt und niedergeschlagen kehrten die beiden zu den Gefährten zurück. Sofort wurde nun unter der Tanne das Grab hergerichtet. In Ermangelung von Spaten scharrten die Deutschen mit Baumästen in die Erde ein Loch. Stumpfsinnig standen die Kosaken daneben und sahen zu.
Dann wurde die Leiche in eine Decke gewickelt und in die Grube hinabgesenkt. Gerade als Pfarrer Günther mit seiner Ansprache an die das Grab umstehenden Landsleute beginnen wollte, kam Iwan Assumoff herbeigeschlendert, die glimmende Zigarette schief im Munde.
Unter diesen Umständen beschränkte der Pastor sich auf wenige, ganz allgemein gehaltene Worte des Trostes an die unglückliche Tochter des Dahingegangenen, segnete die Leiche ein und gab das Zeichen zum Zuschütten der Grube.
Es war ein Begräbnis, wie noch keiner der Deutschen es mitgemacht hatte. Das Rauschen des Forstes, das Krächzen eines Krähenschwarmes, das Stampfen und Wiehern der Pferde und das unterdrückte Lachen der im Lager zurückgebliebenen Kosaken im Verein mit den Gedanken an die traurigen Begleitumstände des Hinscheidens dieses kräftigen, zielbewußten Landsmannes wirken stärker als die beste Rede eines mitfühlenden Seelsorgers.
Erna Hartwig fand auch jetzt keine Träne. Ihr Blick war mit leerem Ausdruck ins Weite gerichtet. Die lose Erde, von den primitiven Grabwerkzeugen und den Händen der Deutschen in Bewegung gesetzt, rieselte gleichmäßig auf die gelbrote Pferdedecke herab, die des reichen Gutsbesitzers armseligen Sarg darstellte.
Ein bescheidener Hügel wölbte sich bald über dem Grabe, und treue Herzen legten schnellgefertigte Eichenlaubkränze darauf nieder. Auch ein Holzkreuz fehlte nicht, das Karl Timuleit geschickt aus einem losen Brett eines der Wagen geschnitzt und mit dem Namen des Toten versehen hatte.
Nun war alles vorüber, und zwischen dem Pastor und seiner Frau schritt Erna dem Lagerplatz wieder zu. Dabei kamen die drei an Leutnant Assumoff vorbei, der im Gespräch mit dem blondbärtigen Unteroffizier, der die Spitze geführt hatte und der mit Wegen und Stegen hier so vortrefflich Bescheid wußte, dastand und die junge Deutsche aus halb zugeschnittenen Augen mit unverschämten Blicken musterte.
Erna Hartwigs Augen versengten sich sekundenlang in die dunklen, flimmernden Pupillen des brutalen Feindes. Es war, als ob sie dessen Gesicht sich nochmals fest einprägen wollte. Und auch über den blonden Unteroffizier, der mit seinem länglichen Gesichtsschnitt so wenig unter die breiten, stumpfnasigen Kosakenköpfe paßte, glitten die hellen Augen des Mädchens hin. Plötzlich schien sie leicht zusammenzuzucken. Aber sie nahm sich zusammen. Und ihre Züge blieben weiter wie versteinert vor Schmerz.
Vor dem von Timuleit errichteten Zelt aber sagte sie zu Pastor Günther und Pelchersen leise:
„Ich kenne den Unteroffizier … Er war im vorigen Jahr bei uns auf dem Gut als Erntearbeiter beschäftigt und fiel mir damals wegen seines Diensteifers und seiner Anständigkeit auf. Der Mann ist nie ein geborener Kosak – niemals! Meiner Ansicht nach ein Kurländer …“
Der Pastor nickte.
„Mag schon sein. Unser Ostpreußen war ja seit Jahren von Spionen überschwemmt. Wir sind zu sorglos gewesen. Und gerade hier in den Grenzgebieten haben russisches Geld und russische Agententätigkeit dem Feinde für den kommenden Krieg ungeheuren Nutzen gebracht.“ –
Die Sonne sank tiefer und tiefer. Der Durst quälte die Gefangenen seit Stunden noch schlimmer als der Hunger. Niemand dachte daran, ihnen Speise und Trank zu reichen.
Der alte Gemeindevorsteher Bulka, ein kleines Männchen von zweiundsiebzig Jahren, hatte die Anstrengungen der Wagenfahrt infolge der drückenden Hitze schlecht vertragen. Sein faltiges, lederartiges Gesicht war immer spitzer geworden. Dem Begräbnis hatte er nicht mehr beiwohnen können. Erschöpft lag er hinter einer aus Zweigen geflochtenen Sonnenschutzwand und bewegte fortgesetzt murmelnd die Lippen. Der Anblick seines in Flammen aufgehenden Dorfes hatte den altersschwachen Geist völlig aus dem Gleichgewicht gebracht.
Der Pastor trat jetzt zu ihm.
„Lieber Bulka, wie fühlen Sie sich? Haben Sie etwas schlafen können?“
Der Kreis hob matt die Hand zu einer verneinenden Gebärde.
„Schlafen?! Heute, jetzt schlafen …?! Könnten Sie das, Herr Pastor?! – – Durst habe ich – großen Durst, und …“ Seine Stimme wurde immer leiser. Dann kam’s wieder deutlicher aus dem zahnlosen Munde hervor wie im Selbstgespräch … „Sechzig Schafe, achtzehn Lämmer … Alles dahin. Und das Kalb der Buntscheckigen ist sicher auch verbrannt. Wer sollte da retten …?! Alles brannte – alles …“
Da ging Günther abermals zu dem Rittmeister.
Der war jetzt allein. Iwan Assumoff hatte er auf Patrouille ausgeschickt. Aber der blonde Unteroffizier verstand gleichfalls genug Deutsch, um den Dolmetscher spielen zu können.
Der Pastor bat um Wasser und Nahrungsmittel, sagte, wie es um den greisen Bulka stände und daß die Frauen gleichfalls am Rande ihrer Kräfte wären.
Der Rittmeister zuckte die Achseln. Er könne daran nichts ändern. Deutsche Kavallerie sei hinter ihnen her, und er müsse seine Leute zusammenhalten, können niemanden fortschicken, um irgendwo das Verlangte besorgen zu lassen. Im übrigen verbiete er jedes laute Wort, jeden Lärm. Wer gegen diesen Befehl verstoße, würde aufgeknüpft. Dies solle Günther seinen Landsleuten nur mitteilen.
„Das ist der Krieg, Herr …!“ fügte er wie bedauernd hinzu. Jedenfalls war er weit mehr Offizier als sein von Deutschenhaß verblendeter Leutnant. –
Nach einer halben Stunde ließ er dann doch aus einem nahen Torfbruch gelbbraunes, modrig schmeckendes Wasser holen und auch je zwei Scheiben Brot für jeden der Gefangenen ausgeben.
Die drei Frauen hatten sich in das Zelt zurückgezogen. Die männlichen Insassen des Wagens aber saßen unweit des Zeltes auf der Erde und wechselten hin und wieder ein Wort, einen kurzen Satz. Der arme, weißhaarige Gemeindevorsteher lag auf einer Decke neben ihnen und zählte immer wieder an den Fingern zusammen, was er an Vieh verloren hatte. Die Rechnung stimmte nie. Aber auch den anderen Männern war’s, als habe man ihnen das Hirn entfernt. Die Ereignisse des Vormittags, das plötzlich über Krapschaken hereingebrochene Unheil und ihre eigene Entführung schienen ihnen bereits Tage zurückzuliegen. Zu viel war auf sie im Verlauf weniger Stunden eingestürmt. Der Geist vermochte das alles nicht so schnell zu verarbeiten. In ihre Gesichter war ebenfalls etwas Stumpfes, Abgestorbenes gekommen.
Nur der Pastor hatte mit seltener Elastizität dem Ansturm des Unerwarteten mit seinen wechselnden Schrecken widerstanden. Ebenso Karl Timuleit, den die Russen merkwürdigerweise bei den als Geiseln bezeichneten Personen belassen hatten. Vielleicht deswegen, weil sie ihn wegen seines sauberen Anzugs und seines intelligenten Gesicht für etwas Besseres hielten.
Die Minuten, die Stunden schlichen hin. Die einzige Abwechslung bot das militärische Treiben. Die Kosaken reinigten ihre Karabiner, putzten an ihren Pferden herum und warfen ihre langen Messern zur Übung nach einem mannshohen Baumstumpf. Patrouillen auf schweißbedeckten Gäulen gingen und kamen. Dann wieder ließ der Rittmeister eine stärkere Abteilung unter dem blonden Unteroffizier abdrücken. Seine Unruhe, sein ständiges Hin- und Hereilen bewiesen, daß die Lage für ihn und seine Leute infolge des Auftauchens deutscher Kavallerie sehr bedrohlich geworden sein mußte, zumal er sich dem Grenzstreifen schon recht nahe befand, in dem auch deutsche Infanterie die Wacht hielt.
Mit Anbrechen der Dunkelheit wurden die Posten, die die Deutschen beaufsichtigten, verstärkt. Ein Entweichen, woran wohl mancher der jüngeren Leute gedacht hatte, war unmöglich. Und bald ging auch der Mond auf.
Pelchersen und Timuleit waren jetzt die einzigen aus der Gruppe der Geiseln, die vor Erschöpfung nicht eingeschlafen waren. Nur Erna Hartwig war ebenfalls in dem Zelt noch wacht. Die arme Frau Pastor schnarchte leise, und auch Grete Spelnik atmete tief und regelmäßig.
Der Apotheker lag ausgestreckt in dem taufeuchten Grase, hatte den Kopf in die Hand gestützt und lauschte den nächtlichen Stimmen des Waldes. Käuzchen klagten, Eulen kreischten, in der Ferne geckerte ein jagender Fuchs. Wildenten und -gänse zogen unsichtbar in den Lüften mit ihren charakteristischen Schreien über die Lichtung hin.
Und Erwin Pelchersen, der stets ein Träumer und Phantast gewesen war, gab sich ganz dieser Stimmung hin, in die das Außergewöhnliche um ihn her ihn versetzte. In seiner Jugend hatte er alles an Büchern, was einen abenteuerlichen Inhalt hatte, mit wahrer Gier verschlungen. Gerade weil sein Körper so schwächlich war, berauschte er sich an den Erlebnissen kraftstrotzender, listiger Pfadfinder und Jäger. Als Sohn reicher Eltern hatte er dann, weil sein Vater mit einem ausgeprägten Erwerbssinn in jeder Apotheke eine Goldgrube sah, nach bestandener Reifeprüfung und leichter Lehrzeit Pharmakologie studiert, war hierauf auf Reisen gegangen und fast zwei Jahre im Ausland gewesen. Indien, Afrika, Amerika kannte er, sogar die norwegischen Kolonien Südgrönlands hatte er besucht. Aber er blieb der schüchterne, stets etwas gedrückte Mensch. Sein kleines körperliches Gebrechen, das kaum merkliche Hinken, war das Bleigewicht, das er ständig mit sich herumschleppte. Das Bewußtsein, einen Krüppel zu sein, machte ihn scheu und linkisch. Dies änderte sich auch nicht, als sein Vater für ihn die Apotheke im Krapschaken erwarb. Der alte Pelchersen hoffte, daß seinem Sohn gerade der Aufenthalt unter einer derben Landbevölkerung und die Selbstständigkeit von Nutzen sein würden.
Vielleicht wäre Erwin auch ein anderer geworden, wenn nicht unglücklicherweise im Krapschaken sofort ein Neues sich in sein Leben eingedrängt haben würde mit allen Qualen, mit Hoffnungen und Enttäuschungen: die Liebe …
Erna Hartwig hatte den „lahmen Apotheker“ nie für voll genommen. Männer, die so wenig selbstbewußt waren wie dieser an sich wohl ganz kluge und weitgereiste Erwin Pelchersen, waren ihr zu wesensfremd. Gerade sie, die von ihrem Vater starkes Zielbewußtsein und sicheres Auftreten geerbt und beides im Verkehr mit den ebenso selbstherrlichen Gutsnachbarn noch weiter ausgebildet hatte, vermochte über eine Natur wie die des Storchnest-Apothekers nur bedauernd zu lächeln.
Sie merkte bald, wie es um ihn stand. Aber nicht einmal ihre weibliche Eitelkeit fühlte sich durch sein stummes Anschmachten berührt. Trotzdem war sie gern mit ihm zusammen. Wenn er erst einmal seine Schüchternheit überwunden hatte und mehr aus sich heraustrat, wenn man ihn dann aufforderte von seinen Reisen zu erzählen, so wurde der bescheidene Apotheker zum Dichter, so bewies er den Leuten, daß man, um fremde Länder kennen zu lernen, nicht die ausgetretenen Touristenpfade benutzen dürfe. Dann schlug er seine Zuhörer bald völlig in Bann, dann merkten diese, welcher Unternehmungsgeist in dem überschlanken Manne steckte und wie mutig er Gefahren auf sich genommen hatte, nur um in Geheimnisse des Landes einzudringen, die ihm der Erforschung wert erschienen. Niemals kehrte er bei solchen Anlässen jedoch den Wert seiner eigenen Persönlichkeit hervor.
Jedenfalls war er bald, vielleicht gerade wegen seiner Bescheidenheit, auf den Gütern der Umgebung von Krapschaken ein gerngesehener Gast. Auch bei Hartwigs fand er sich häufig ein und stand dann meist Folterqualen der Eifersucht aus, wenn die Offiziere der nächsten Garnison, die dort viel verkehrten, der übermütigen Erna den Hof machten. –
Wie anders das nun alles mit einem Schlage geworden war …! Friedrich Hartwig lag still und stumm für immer unter jener Tanne da drüben … Und Erna würden nun vielleicht einige Tage dauern in seiner Nähe sein, halb angewiesen auf seine Hilfe …
Erwin Pelchersen spann diese Gedanken weiter und weiter aus. Wie gern wollte er alle Leiden einer Gefangenschaft ertragen, wenn sie ihm nur dadurch nähergerückt wurde, – sie, die er über alles mit seinem ernsten, ehrlichen und reinen Herzen liebte.
Dann riß ihn eine leise Bemerkung Karl Timuleits aus seinen bunten Zukunftsträumen heraus.
Timuleit hatte so eine eigene Art, lautlos vor sich hinzulachen. Das tat er auch jetzt. Und das Lachen endigte mit dem Satz:
„Das hat August Spelnik auch nicht vorausgesehen, daß er mich mal bitten würde, ich solle mich seiner Tochter etwas annehmen, falls die Russen ihn vielleicht gleich nach Sibirien brächten. Tatsache, Herr Pelchersen, – er hat’s vorher getan. Und ich habe ihm in die Hand gelobten, daß ich nicht dulden würde, daß der Grete auch nur ein Haar auf dem Kopf gekrümmt werde. Ja, ja – das Unglück bringt die Menschen einander schnell näher. Bis heute war der Hausdiener der „Storchnest“-Apotheke völlig Luft für den Krösus von Krapschaken. Jetzt bin ich mehr wie mancher andere – ein Mann!“
Wie selbstbewußt er dieses letzte Wort aussprach …! Erwin Pelchersen überkam es fast wie Neid. Ja, dieser Timuleit war die richtige Draufgängernatur, dazu ein ganz geriebener Bursche, durch nichts in Verlegenheit zu bringen, nie um eine Ausrede verlegen.
Dann fiel dem jungen Apotheker wieder etwas anderes ein. Er dachte daran, daß auch Karl sich soeben offenbar in Gedanken mit der Geliebten seines Herzens, mit Grete Spelnik, beschäftigt hatte, – genau so wie er selbst seine Hoffnungen gleich zarten Faltern um Erna Hartwig hatte spielen lassen. –
Da – ein lauter Ruf von der Stelle her, wo die beiden Offiziere sich gelagert hatten. Vor wenigen Minuten war eine Patrouille zurückgekehrt. Sie mußte die Meldung überbracht haben, daß der Weg nach der Grenze hin frei sei.
Es wurde aufgebrochen. Das bleiche Licht des Mondes beschien eine wildbewegtes Szene. Eilig wurden die Pferde vor die Wagen gespannt. Die Deutschen mußten helfen. Dabei ging es ohne Mißhandlungen nicht ab. Mit ihren Lanzenschäften schlugen die Kosaken zu. Auch Timuleit erhielt von dem blonden Unteroffizier ganz grundlos einen Stoß in den Rücken.
Als die Gefangenen die Wagen dann bestiegen hatten, ließ Leutnant Assumoff sie noch schnell durchzählen.
Drei der jungen Leute fehlten.
Der Leutnant schäumte vor Wut. Aber das half ihm wenig. Die Entflohenen, die so schlau die Dunkelheit und das allgemeine Durcheinander des Aufbruchs ausgenutzt hatten, zu verfolgen war unmöglich.
Da ritt Iwan Assumoff an die einzelnen Wagen heran und rief den Insassen jedesmal mit halblauter Stimmen zu:
„Entflieht noch ein einziger, so gibt’s mit den beiden jungen Weibern eine Kosakenhochzeit …! Ihr versteht mich wohl!!“
Sie verstanden, und niemand dachte mehr an Flucht. Die Ehre der deutschen Mädchen stand den Krapschakern höher als die eigene Freiheit.
4. Kapitel.
Bis zum Morgengrauen ging’s vorwärts auf entlegenen Wegen durch die stille Nacht, bisweilen querfeldein über Stoppeläcker, dann wieder durch den schweigenden Forst.
Beim ersten Schimmer des Tageslichts führte der Leutnant die Wagen dann in eine tiefe Sandgrube, die inmitten endloser, wellenförmiger Stoppelfelder lag.
Wieder wurde hier gelagert. Aber dieses Mal blieben die Kosaken beisammen. Keine Aufklärer wurden ausgeschickt. Nur ein paar Posten lagen oben am Rande der großen Sandgrube und beobachteten das Vorgelände.
Nachdem es hell geworden war, ließ der Rittmeister wieder Brot und Wasser an die Gefangenen verteilen. Noch während dies geschah, begann es zu regnen. Es wurde der richtige Landregen. Gleichmäßig rieselte es vom Himmel herab, – gleichmäßig und unaufhörlich.
Erwin Pelchersen gab Timuleit die Weisung, für die Frauen wieder ein Zelt zu bauen.
Doch der gestern noch so diensteifrige junge Mensch war wie ausgewechselt. Mürrisch erwiderte er, er wolle erst den Leutnant um Erlaubnis fragen gehen.
Pelchersen schaute ihn überrascht an.
„Wozu das, Karl?! Gestern hat keiner etwas dagegen einzuwenden gehabt.“
Timuleit zog die Schultern hoch.
„Ich habe nicht Lust, mich für andere vielleicht Unannehmlichkeiten auszusetzen. Seit die drei in der Nacht entflohen sind, versteht der Leutnant keinen Spaß mehr.“
Pelchersen sah ein, daß Karl nicht so ganz Unrecht hatte.
„Meinetwegen denn. So fragen Sie den … den Rohling,“ sagte er.
Aber Timuleit zögerte, drückte sich an dem Wagen herum und setzte sich schließlich auf einen Sandhaufen, indem er eine der Decken sich als Umhang umschlug.
Pelchersen beobachtete ihn kopfschüttelnd und ging dann selbst zu Assumoff. Dieser fuhr ihn grob an.
„Meinetwegen können Sie sich ein Palais bauen! Lassen Sie mich in Ruhe!“
Der junge Apotheker zog sich mit einer Verbeugung zurück.
Aber auch jetzt rührte Timuleit keine Hand.
„Ich fühle mich krank. Ich kann mich kaum rühren,“ erklärte er unfreundlich.
So machten sich denn Spelnik und Pelchersen allein an die Arbeit.
Karl Timuleit wurde seinen Landsleuten immer unverständlicher. Er hielt sich den Tag über abseits von ihnen, ließ sich mit dem blonden Unteroffizier des öfteren in ein Gespräch ein und tat auch so, als ob Grete Spelnik für ihn gar nicht mehr da wäre. Dann hatte er sogar eine längere Unterredung mit dem Leutnant, der ihm daraufhin erlaubt zu haben schien, sich frei überall zu bewegen.
Daher suchte Timuleit auch die wieder abseits von den Geiseln gehaltenen jüngeren Männer auf, redete mit diesem und jenem, wobei er nie unterließ, auf die Gefahren eines Fluchtversuches hinzuweisen.
„Ihr wißt, was den beiden jungen Mädchen dann bevorsteht!“ sagte er stets eindringlich. „Ja, wenn wir die Frauen nicht bei uns hätten …! Dann …“
Alle Versicherten ihm, daß er keine Angst zu haben brauche. Man würde aus Rücksicht auf die jungen Mädchen nichts unternehmen.
So horchte und spionierte Timuleit überall umher. Pelchersen belauerte mißtrauisch jede seiner Bewegungen. Als er dann noch sah, daß der Leutnant jenem Zigaretten schenkte und heimlich besseres Essen reichen ließ, wußte der Apotheker Bescheid.
„Der Jammerlappen hat sich auf die Gegenseite geschlagen,“ sagte er ingrimmig zu dem Pfarrer und zu August Spelnik. „Niemals hätte ich ihm eine solche Schufterei zugetraut. – Da – mit dem blonden Unteroffizier ist er schon ein Herz und eine Seele.“
Als Timuleit sich nachher seinen Leidensgefährtinnen wieder zugesellte, meinte er leichthin:
„Ich habe mir den Leutnant mal ordentlich vorgenommen. Wir werden jetzt anständiger behandelt werden. Auch der Unteroffizier, der tatsächlich ein Kurländer ist und Marchinski heißt, wird mir keine Püffe mehr versetzen. Man muß diese Leute nur zu nehmen wissen …“
Niemand erwiderte etwas, und erst nach einer Weile sagte Pastor Günther anzügliche:
„Judas Ischariot, der den Herrn verraten hatte, ging nachher hin und erhängte sich.“
Da brauste Timuleit auf:
„Herr Pfarrer – soll das etwa auf mich gehen?! Kann ich was dafür, daß der Leutnant mir Zigaretten anbot? Sollte ich sie ablehnen?! Das hätte böse für mich ablaufen können.“
„Mit Zigaretten fängt es an, und mit Rubelscheinen hört’s auf,“ polterte der derbe Spelnik heraus.
Timuleit verteidigte sich wenig geschickt gegen die Verdächtigungen. Schließlich ließ man ihn dann in Ruhe. Aber die anderen waren überzeugt, daß man jetzt einen Spion unter sich hatte, der jedes Wort dem Leutnant hinterbringen würde. Und nur aus Klugheit taten alle, als ob sie auch weiter von des jungen Menschen anständiger Gesinnung überzeugt seien.
Auch dieser Tag ging hin. Gegen Abend hörte der Regen auf. Dafür senkte sich dichter Nebel über die Felder herab.
Nun gestattete der Rittmeister, das kleine Feuer angezündet wurden, an denen die Kosaken für sich und die Gefangenen Kartoffeln brieten, die aus einem entfernten Acker geholt worden waren.
Wieder wurden jetzt Patrouillen vorgeschickt. Die gegen elf Uhr abends einlaufenden ersten Meldungen mußten sehr günstig sein, da der Rittmeister sofort aufbrechen ließ.
Abermals ging’s langsam auf allerlei Umwegen der Grenze zu. Streckenweise wurde auch im scharfen Trab gefahren. Dann wieder hielt der Zug oft eine Stunde lang in den grauen Nebelmassen, die selbst im Walde dick und schwer zwischen den Bäumen hingen.
Gegen Morgen verschwanden die feuchten Schleier. Und dann vernahm man von links herüber aus der Richtung von Eydtkuhnen das dumpfe Dröhnen eines von Minute zu Minute stärker anschwellenden Geschützkampfes.
Der ortskundige Spelnik konnte bald darauf feststellen, daß die Grenze in nächster Nähe sei. Der Wagenzug hielt gerade auf einer Anhöhe in einem kleinen Eichenwäldchens. Der Leutnant war vor einigen Minuten mit zehn Kosaken davongesprengt, und der Rittmeister wartete auf Meldung, ob man die Grenze ungehindert passieren könne.
Eine reichliche halbe Stunde verging. Dann von vorn einige Schüsse. Ein einzelner Reiter jagte heran, zügelte vor dem Rittmeister sein Pferd und deutete, eifrig sprechend, wiederholt nach der Richtung hin, aus der jetzt abermals der harte Knall von Gewehren und Karabinern herübertönte.
Der Erfolg dieser neuen Nachricht war, daß die Kolonne kehrtmachte und im schärfstem Trab auf demselben Wege zurückfuhr.
Wieder wurde nun dieser neue Tag von Mittag ab in einem abseits vom Wege gelegenen Versteck zugebracht. Hier ereignete sich ein Zwischenfall, der für den Verräter Timuleit leicht recht böse hätte ablaufen können. Inzwischen hatte nämlich Spelnik die wehrfähigen Landsleute auf dem vorderen Wagen davon verständigt, daß Timuleit nicht mehr recht zu trauen sei. Als dieser auf dem Lagerplatz sich wieder unter die gefangenen Wehrpflichtigen mischte, fielen diese plötzlich über ihn her, und nur seine körperliche Gewandtheit rettete ihn vor einer tüchtigen Tracht Prügel.
Leutnant Assumoff, den der Lärm schnell herbeigelockt hatte, ließ sich von Timuleit das Geschehene erzählen. Dessen Darstellung war aber wohl aus Angst vor der Rache seiner Landsleute so harmlos, daß der Offizier die Sache auf sich beruhen ließ. Von Stunde an sonderte der frühere Hausdiener sich immer mehr von seinen Leidensgefährten ab, die ihn jetzt mit nicht mißzuverstehender Kälte behandelten.
Vier Tage verstrichen nun bei einem aufregenden Versteckspiel zwischen der Kosakenabteilung und den deutschen Grenzschutztruppen. Nur nachts wurde immer wieder von den Russen der Versucht gemacht, irgendwo die Grenze zu passieren. Dabei konnte der Rittmeister es nicht verhindern, daß er mit seiner Kolonne immer weiter nach Süden zu abgedrängt wurde.
Die unzureichende Ernährung und der Aufenthalt im Freien während der kalten, taufeuchten Nächte hatte bei den Deutschen bald allerlei Krankheiten zur Folge. So starb der altersschwache Gemeindevorsteher Bulka eines Morgens als erster der Kranken in den Armen Pastor Günthers. Ihm folgte ein schwindsüchtiger junger Mensch, der sich eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Einer der Wagen mußte jetzt für die Kranken hergerichtet werden, deren Zahl ständig wuchs. Besonders ruhrähnliche Erscheinungen zeigten sich infolge des Genusses schlechten Wassers immer häufiger.
Auch die drei Frauen waren hohlwangig und bleich geworden, obwohl man ihnen von den spärlichen Nahrungsmitteln stets größere Portionen abgab. Bei solchen Gelegenheiten zeigte Karl Timuleit dann wieder, daß sein Herz doch noch nicht ganz verdorben war. Da ihm die Kosaken allerlei Kleinigkeiten zusteckten, die sie bei ihren vorsichtigen Aufklärungsritten aus entlegenen Gehöften geraubt hatten, – Schokoladentafeln, Wurst, Schinken und Eier, lieferte er heimlich an Pelchersen hiervon das meiste ab, damit dieser es den Frauen zukommen lasse. Erst hatte dieser die Annahme kurz verweigert. Aber Timuleit ließ nicht mit Bitten nach.
„Mögen Sie über mich denken wie Sie wollen, Herr Pelchersen,“ sagte er finster. „Sie müssen den Damen diese Dinge aushändigen, auch wenn sie von mir herrühren. Oder wollen Sie vielleicht, daß Fräulein Hartwig vor Entkräftung ebenso dahingewelkt wie der alte Bulka?!“
Dieser Hinweis genügte. –
Überhaupt – so recht klug wurde man aus Timuleit nicht. Eines Nachts hatte er an einem Patrouillenritt der Kosaken teilgenommen. Mit dem Leutnant war er jetzt nämlich auch ein Herz und eine Seele. Leichter Nebel lag damals wieder über den Feldern, und Pelchersen begriff nicht recht, was es zu bedeuten hatte, als plötzlich ganz lautlos der als Verräter erkannte Hausdiener neben der Lagerstätte der Geiseln auftauchte und im Stroh des Wagens schnell ein längliches, großes Paket verbarg und gleichzeitig seinem bisherigen Brotherrn zuraunte, niemandem etwas von dieser Beute mitzuteilen. Darauf verschwand er ebenso unbemerkt wieder nach vorn.
Pelchersen plagte die Neugier so sehr, daß er behutsam durch Befühlen die Natur der in ein Stück Leinwand eingehüllten Gegenstände festzustellen suchte. Zu seinem Erstaunen entdeckte er darin drei Karabiner, drei Mauserpistolen und eine ganze Menge Munition.
Dann, in der fünften Nacht nach dem ersten Versuch, über die Grenze zu kommen, glückte es dem Leutnant, die Kolonne ungefährdet auf russisches Gebiet hinüberzubringen.
Die nächste Rast wurde in einem verwahrlosten russischen Dorf gemacht, das nur aus einem Dutzend verfallener Hütten bestand. Truppen in größerer Anzahl waren hier nicht zu bemerken. Nur zahlreiche Kavallerie- und Radfahrerpatrouillen schwärmten umher. Von diesen erfuhr der Rittmeister, daß die Deutschen nach zähem Widerstand von Eydtkuhnen abgedrängt worden seien und daß starke russische Kräfte bereits an mehreren Punkten auf ostpreußischem Boden sich befänden.
5. Kapitel.
Nach zweitägigem Aufenthalt in dem kleinen, schmutzigen Dorf hatte sich Mensch und Tier soweit erholt, daß der Rittmeister beschloß, mit dem größeren Teil seiner Leute wieder sein Regiment zu suchen, während Leutnant Assumoff mit dreißig Mann die Gefangen nach Balki bringen sollte, wo, wie er inzwischen erfahren hatte, die nächste Sammelstelle für deutsche Zivilgefangene eingerichtet worden war.
So trennten sich denn die beiden Abteilungen, und die Krapschaker waren der Willkür eines Mannes überantwortet, der schon genügende Beweise einer brutalen Gesinnung und eines fanatischen Deutschenhasses gegeben hatte.
Bis Balki waren es gut vier Tagereisen. Die Fahrt ging durch ein Gebiet, das gerade zwischen den beiden auf Eydtkuhnen und Lyck vorstoßenden russischen Heeressäulen lag. Endlose Forsten, die noch völlig Urwaldcharakter zeigten, lagen zu beiden Seiten des jämmerlichen Weges, der den Namen Chaussee in keiner Weise verdiente.
Der Leutnant hatte Spelnik sofort fesseln lassen, nachdem der Rittmeister mit dem Haupttrupp kaum verschwunden war. Ebenso hatte er den Gefangenen in einer mit Grobheiten und höhnischen Bemerkungen gestickten Ansprache den Tod in jeder nur möglichen Art angedroht, wenn sie nicht seine Befehle aufs pünktlichste und genaueste befolgten.
Am zweiten Marschtage langte man in einem Städtchen an, wo der Leutnant auf der Post Erkundigungen über die Kriegslage einzog und Proviant beschaffte.
Wieder teilte er die neuesten Nachrichten hohngeschwollen den Deutschen mit: Revolution in Berlin, der Kaiser auf der Flucht nach Amerika, der Kronprinz schwer verwundet, Bayern auf Seiten der Entente und ähnliches, was eben nur jemand als wahr hinnehmen konnte, der von den Verhältnissen in Deutschland keine blasse Ahnung hatte.
Pastor Günther konnte sich denn auch nicht enthalten etwas ungläubig zu lächeln, worauf der Leutnant ihn grob anschnauzte und mit seinem Säbel wild herumfuchtelte. Seinen verschwommenen Augen sah man es an, daß er diese für sein russisches Vaterland so überaus günstigen Depeschen von dem inneren Verfall des Deutschen Reiches vorher stark mit Alkohol gefeiert haben mußte. Und auch Karl Timuleit, mit dem er Arm in Arm den Hof des Stadtgefängnisses betreten hatte, wo die Krapschaker untergebracht worden waren, taumelte unsicher hin und her und verzog keine Miene, als der würdige Vater mit Ausdrücken wie „frecher Pfaffe“, „Höllendiener“ und anderen rohen Schimpfworten belegt wurde.
Unglücklicherweise fiel dann des trunkenen Offiziers Blick auf Erna Hartwig, die in der Nähe neben der Pastorin auf einer einfachen Holzbank saß.
Schwankend schritt er auf die beiden Damen zu, ein Lächeln auf den Lippen, das allein schon ein paar kräftige Ohrfeigen verdiente.
Vor Erna Hartwig stehen bleibend, versuchte er ihr eine Art Verbeugung zu machen und sagte in seinem hart klingenden Deutsch:
„Darf ich Sie zu einem Rundgang durch das Städtchen auffordern, mein Fräulein? Etwas Bewegung wird Ihnen guttun. Für die Nacht habe ich Ihnen auch ein Zimmer in dem besten Hotel freigemacht.“
Alle Gefangenen, die Zeugen dieser Szene waren, fürchteten nun einen heftigen Auftritt, da mit Sicherheit anzunehmen war, daß das junge Mädchen den Russen gebührend abfertigen würde.
Es kam jedoch anders. Erna Hartwig war klug genug, den Unverschämten nicht zu reizen. Mit liebenswürdigem Lächeln erwiderte sie:
„Ich habe gerade heute meine bösesten Kopfschmerzen, Herr Leutnant. Jede Bewegung ist mir eine Pein. Unter diesen Umständen werden Sie als Kavalier es mir nicht verargen, wenn ich Sie bitte, diesen Spaziergang vorläufig aufschieben zu wollen.“
Der Russe, dergestalt an seiner Offiziersehre gepackt, wurde verwirrt, stammelte irgend etwas und verließ den Gefängnishof.
Alles atmete auf. Besonders Erwin Pelchersen fiel ein Stein vom Herzen. Niemals hätte er es geduldet, daß der trunkene Assumoff Erna irgendwie zu nahe getreten wäre, und wenn er diesen hätte zu Boden schlagen müssen.
Karl Timuleit, der sich dem Leutnant angeschlossen hatte, kehrte sofort wieder auf den Hof zurück, nachdem er sich von seinem Gönner unter einem Vorwand verabschiedet hatte.
Unsicheren Schrittes und leise ein Lied vor sich hinsummend kam er jetzt auf die drei Männer zu, die die Kosaken als Geiseln mitgeschleppt hatten und die erregt das soeben Geschehene besprachen.
August Spelnik und Pelchersen schauten dem Verräter finster entgegen, während im Pastor Günthers Augen mehr Mitleid mit dieser verirrten Seele zu lesen war.
Breitbeinig pflanzte Timuleit sich vor den dreien auf. In letzter Zeit hatte er sich völlig von seinen Landsleuten abgesondert und den Zug auch stets zu Pferde begleitet, wie er überhaupt jetzt ganz aufwändige Freiheiten genoß.
„Ich bin den Herren wohl nicht angehen, wie?!“ brüllte er laut genug, daß der blonde Unteroffizier Marchinski, dem die Überwachung der Gefangenen hier übertragen war und der unweit an die Mauer gelehnt, ihn verstehen mußte. „Was haben Sie eigentlich gegen mich?“
Spelnik und Pelchersen wendeten sich angewidert ab. Nur der Pfarrer sagte ernst und traurig:
„Denken Sie an meine Worte, Timuleit: „… und Judas Ischariot ging hin und erhängte sich“ …“
Der frühere Hausdiener lachte dröhnend:
„Gut gegeben, Herr Pastor …! Aber bei mir werden Sie auf das Hängen wohl noch ein Weilchen warten müssen …!“ Seine Stimme wurde immer leiser. Und nur für den Geistlichen verständlich fügte er hinzu, indem er das freche Grinsen beibehielt:
„Spelnik kennt die Gegend von hier bis Balki hin. Im Balki hat er doch stets Vieh und Holz eingekauft. Fragen Sie ihn bitte, ob es auf dem Wege dorthin größerer Ortschaften gibt. – Nein, nicht dieses Gesicht, Herr Pfarrer! Verraten Sie mich nicht durch Ihre Miene. Spielen Sie den Empörten, genau so wie ich nur Komödien gespielt habe. Doch davon später …“
So gelang es Timuleit, dem Pastor alles das mitzuteilen, was er für notwendig hielt, um seine ferneren Entschlüsse nach den Auskünften, die Spelnik geben sollte, einrichten zu können.
Dann schwankte er davon und auf den blonden Kurländer zu, dem er einen Schluck aus einer bisher in seiner Tasche gut verwahrt gewesenen Schnapsflasche anbot.
„Hör’ mal, Brüderchen Marchinski, wenn du mal in die Stadt gehen willst, so tu’s nur,“ stammelte er. „Ich werde hier schon auf Ordnung halten. Verlaß dich drauf. Der Leutnant hat auch nichts dagegen …“
Der Unteroffizier ließ sich das nicht zweimal sagen. Sofort machte er sich auf, um sich auch ein wenig Zerstreuung zu schaffen. Deutsche Goldstücke, die er in einem der Gehöfte in Krapschaken beschlagnahmt hatte, wollten doch auch mal in allerlei gute Dinge umgesetzt werden.
Inzwischen hatte Günther seine beiden Leidensgefährten bei Seite genommen.
Spelnik und Pelchersen trauten ihren Ohren nicht, als der Pfarrer ihnen erklärte, daß Timuleit absichtlich sich scheinbar ganz den Russen verschrieben habe, um für seine Landsleute eine Gelegenheit zur Flucht vorbereiten zu können. Dann fuhr der Pastor fort:
„Sie, lieber Spelnik, sollen ihm nun sagen, ob die Wälder zwischen diesem Städtchen und Balki sich dazu eignen, dort einige Zeit in der Verborgenheit hausen zu können und ob viele Dörfer am Wege liegen. Er hofft, uns ein Entkommen ermöglichen zu können. Wir sollen uns dann so lange versteckt halten, bis der Vormarsch unserer Truppen, auf den er sicher rechnet, die Gegend von Russen säubert, so daß wir uns den Unsrigen anschließen und dann nach Ostpreußen zurückkehren können.“
Spelnik nickte eifrig.
„Der Gedanke ist gut, meiner Treu! Wenn der Timuleit es nur ehrlich meint …! – Na, Sie werden’s ja wohl am besten beurteilen können, Herr Pfarrer, woran wir mit ihm sind. Und – was die Wälder anbetrifft, darin kann sich auch eine ganze Armee verbergen. Ortschaften bis nach Balki gibt es nur zwei, ganz elende Nester, in denen harmloses Volk, die Ärmsten der Armen, wohnen.“ – –
Eine halbe Stunde später wußte dann auch Karl Timuleit Bescheid.
* * *
Am nächsten Abend hatte der Gefangenentransport in dem ersten der von Spelnik angekündigten kleinen Dörfer halt gemacht.
Assumoff befand sich in geradezu glänzender Laune. Auf den Rat Timuleits hin hatte er in dem Städtchen, das man am Morgen verlassen hatte, alle Leiterwagen und Pferde bis auf den verkauft, auf dem die Geiseln untergebracht waren. Dieses Geschäft brachte ihm ein hübsches Sümmchen ein. Die wehrfähigen Deutschen konnten auch ganz gut zu Fuß bis Balki laufen. Beeilen brauchte er sich ja keineswegs, um seine Gefangenen an die Sammelstelle abzuliefern.
Des Leutnants Stimmung wurde dann noch um ein gut Teil ausgelassener und erwartungsvoller, als Timuleit ihm beim Einzug in das kleine Dorf zuflüsterte:
„Bringen Sie doch die Geiseln in einem etwas abseits gelegenen Hause unter, wenn sie so gern einmal allein mit Fräulein Hartwig plaudern wollen … Zwei Posten genügen für die wenigen Personen. Es ist nicht gerade nötig, daß gleich ein Dutzend Ihrer Leute Zeuge wird, wie ihr Anführer auf Abenteuer ausgeht. In einem einsamen Gebäude wird es sich schon so einrichten lassen, daß die Frauen getrennt untergebracht werden.“ –
Am jenseitigen Ausgang des Dörfchens stand etwa zweihundert Meter von der letzten der jämmerlichen Hüten entfernt das Schulhaus, ein halb verfallenes, großes Steingebäude, das einst das Jagdschloß eines russischen Fürsten gewesen und dann, nachdem es nur noch einer Ruine glich, nach bewährter Methode als neues Schulhaus dem Staate in Rechnung gestellt worden war.
Iwan Assumoff warf kurzerhand den Lehrer und dessen zahlreiche Familie hinaus und wies die Ruine den Geiseln als Unterkunft für die Nacht an. Die anderen Gefangenen wurden im Dorf selbst in eine leere Scheune eingesperrt.
Die Sonne war längst untergegangen, als Timuleit sich im Schulhaus einfand, um nachzusehen, ob der Befehl des Leutnants, daß die Geiseln einzelnen in die zahlreichen Zimmer einzuschließen seien, auch genau befolgt war.
Die beiden Kosaken, die als Posten beständig das Gebäude umkreisten, ließen ihn ungehindert durch. Wußten sie doch, daß dieser junge Deutsche ein ergebener Anhänger des großen Zaren und der Freund ihres Leutnants war. So fiel es ihnen auch nicht weiter auf, als Viertelstunde um Viertelstunde verging, ohne daß Timuleit das Haus wieder verließ.
Dann wurden sie gegen zehn Uhr abends von zwei anderen Leuten abgelöst. Den erhaltenen Anweisungen gemäß gingen sie mit den neuen Posten die Zimmer der Gefangenen durch, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Da erst fanden sie den Zechgenossen ihres Leutnants, der sich im unteren Flur ein Lager auf den halbverfaulten Dielen hergerichtet und eine brennende Petroleumlampe neben sich stehen hatte.
Timuleit bedeutete ihnen durch Zeichen, daß er ebenfalls auf die Geiseln acht geben solle. Das erschien durchaus glaubwürdig, und die vier Kosaken zogen wieder ab.
Inzwischen war es draußen völlig dunkel geworden. Der Himmel hatte sich schon gegen Abend mit dichten Wolken bedeckt, und seit einer halben Stunde rieselte auch ein feiner Regen herab.
Nachdem die eben abgelösten Posten nach dem Dorf zu verschwunden waren, begab sich Timuleit in den Raum, in dem Erwin Pelchersen eingesperrt war. Der Schlüssel der Tür steckte von außen im Schloß, und gleich darauf begann der erste Auftritt eines aufregenden und gefährlichen Spieles.
Timuleit hatte die Haustür leise geöffnet und rief nun einen der beiden Posten herbei. Der Mann mußte aus den Zeichen des jungen Deutschen entnehmen, daß bei den Gefangenen irgend etwas vorgefallen sei. Leise und diensteifrig betrat er den Flur, wo er im Dunkeln von vier Armen sofort gepackt, umgerissen und dann gebunden und geknebelt wurde.
Dem zweiten Kosaken erging es nach einer Weile genau ebenso.
Karl Timuleit, der trotz seines schlanken Körpers über fast athletische Kräfte verfügte, war nicht wenig erstaunt, als er bei diesen beiden Überrumplungen der Posten merkte, daß auch Pelchersen, der so zart und schwächlich aussah, sich sowohl äußerst gewandt zeigte als auch eine Arm- und Handmuskulatur besaß, die einem der Kosaken, dem der Storchnest-Apotheker die Kehle zudrückte, beinahe das Leben gekostet hätte.
Nach dem glücklichen Unschädlichmachen der Wächter holte Timuleit den Pfarrer und Spelnik herbei, damit diese auf die Gefesselten acht geben sollten. Er selbst und Erwin Pelchersen begaben sich auf den Hof, wo der Leiterwagen, unter dessen Strom die Schußwaffen noch immer versteckt lagen, in einem offenen Schuppen aufgestellt war. Sie holten die Karabiner und Pistolen hervor, ebenso die Munition, und wenige Minuten später waren nicht nur die vier Männer, sondern auch Erna Hartwig, die als gute Schützin in dem der Krapschaker Gegend einen gewissen Ruf genoß, mit den kurzen Schußwaffen ausgerüstet, wie sie die Kavallerie aller Länder zu führen pflegt. Drei Karabiner hattet Timuleit ja schon in jener Nacht nach dem kurzen Feuergefecht an der Grenzen gefallenen Kosaken abgenommen und heimlich beiseite geschafft. Hinzu kamen jetzt noch die beiden Karabiner der überwältigten Posten, so daß man eine ausreichende Anzahl von Waffen zur Verfügung hatte.
Es folgte nun eine kurze Beratung, die im Flur beim ungewissen Lichte der Petroleumlaterne stattfand.
Bei dieser Gelegenheit bewies Pelchersen, ohne sich irgendwie vorzudrängen, einen so weitschauenden Blick für die Vorbereitungen zu der eigentlichen Flucht, daß die anderen sich schweigend seinen Vorschlägen fügten und die Führerschaft über die kleine Schar ganz unmerklich in seine Hände überglitt.
Für Erna Hartwig war dieses Zielbewußtsein, diese Umsicht und überlegene Ruhe bei dem jungen Apotheker etwas vollkommen Neues. Sie konnte denn auch eine anerkennende Bemerkung nicht unterdrücken, auf die Pelchersen gelassen erwiderte:
„Hier bin ich in meinem Element, gnädiges Fräulein. Alles Abenteuerliche hat mich stets gereizt. Und daß ich jetzt eben bei diesem Kriegsrat an manches gedacht habe, was unsere Gefährten vielleicht übersehen hätten, kann ich mir kaum als besonderes Verdienst anrechnen. Vergessen Sie nicht, daß ich sowohl in Indien als auch in Südamerika längere Jagdexpeditionen allein ausgerüstet und unternommen habe, nur begleitet von einem Dutzend Eingeborener, deren Sprache mir so gut wie fremd war. Schließlich hat doch unsere Flucht in die Wälder einige Ähnlichkeit mit so einem Jagdausflug in wenig bewohnte, tropische Gegenden.“
Aus der Wohnung des Lehrers, der den deutschen Geiseln hatte das Feld räumen müssen, wurde nun alles zusammengesucht, was den Flüchtlingen während ihres Aufenthaltes in den Wäldern von Nutzen sein konnte. Viel war es ja nicht, was hier gefunden wurde. Immerhin aber doch Sachen, die gut zu brauchen waren, allerlei Handwerkszeug, Nägel, Schrauben, zwei für Tranfüllung eingerichtete Laternen, Decken, ein Ballen grobe Leinwand, etwas Wäsche, einige Kleidungsstücke und manches andere.
Aus diesen Gegenständen wurden vier Packen hergestellt, die man den beiden kräftigsten der vier Wagenpferde, welche im Stall des ehemaligen Jagdschlosses untergebracht waren, aufladen wollte.
Um den armen Schulmeister für den Verlust seiner Habe zu entschädigen, legte Spelnik einhundertundfünfzig Mark in Goldstücken, die den Kosaken glücklich entgangen waren, zwischen die Blätter eines auf dem Ofensims liegenden Andachtsbuches.
6. Kapitel.
Gerade als Karl Timuleit sich dann nach dem Stalle begab, um die beiden Pferde, die man als Lasttiere benutzen wollte, anzuschirren, blinkte aus dem leichten Regenschleier das Licht einer sich nähernden Laterne hervor, und gleichzeitig hörte der junge Deutsche auch die Stimme Assumoffs und des blonden Unteroffiziers.
Das war eine gefährliche Überraschung. Timuleit hatte nicht damit gerechnet, daß der Leutnant in Begleitung nach dem Schulhaus kommen würde.
Dieser hatte nun auch des früheren Hausdieners Laternen bemerkt und rief deren Träger argwöhnisch an. Dann, nachdem er Timuleit an der Sprache erkannt hatte, ging er weiter, während der Kurländer sich mehr im Hintergrund hielt.
Assumoff war stark angetrunken. Als er sah, daß der Deutsche einen Karabiner am Riemen über der Schulter trug, lachte er dröhnend.
„Hast dich ja ordentlich als Gefangenenwärter herausgeputzt, Brüderchen! – Sag’, wo wolltest du denn hin? Und wo sind unsere beiden Posten?“
„Der eine wird gerade hinter dem Hause sein, der andere steht im Flur als Wache vor den Türen. Ich habe seinen Dienst ihm ein wenig hier draußen abgenommen und mache eben die Runde.“
Timuleits Stimme zitterte doch leicht vor Erregung. Alles stand jetzt auf dem Spiel. Gelang es nicht, auch diese beiden Feinde ohne Lärm unschädlich zu machen, so konnte die Sache recht schlimm enden.
Der Leutnant, der seinen Mantel lose um die Schultern gehängt hatte, stützte sich auf seinen Säbel und schien zu überlegen.
Dann wandte er sich an dem Unteroffizier, der mit der Laterne einige Schritte hinter ihm stand.
„Boris Marchinski, du kannst jetzt ins Dorf zurückkehren. Ich bin müde und bleibe vielleicht die Nacht über hier.“
Timuleit fiel eine Zentnerlast vom Herzen. Leider kam sein befreites Aufatmen zu früh.
Der Unteroffizier erwiderte nämlich:
„Mir war’s eben, als ob sich in der Haustür eine Gestalt bewegte. – He, du da vorn, komm’ mal her!“ rief er dann laut.
Keine Antwort.
„Du wirst dich getäuscht haben,“ meinte der Leutnant, der Marchinski gern schnell losgeworden wäre. „Wer soll’s auch sein? Dort ist uns einer unserer Leute.“ – –
„Laß das laute Schreien …!“ befahl er barschem Tones, als der Unteroffizier abermals ein mißtrauisches „Halt – wer da?!“ hervorstieß.
Da entfernte sich der Kurländer endlich. Aber Timuleit wurde das Gefühl nicht los, daß der Mann irgend einen Verdacht geschöpft habe.
Deshalb raunte er auch Assumoff leise zu:
„Der Unteroffizier ahnt vielleicht, weshalb ein Teil meiner Landsleute gerade hier untergebracht worden ist. Vielleicht ist er neugierig und bleibt in der Nähe.“
Der Kosakenoffiziere stampfte mit dem Säbel auf.
„Er soll’s wagen …!! – He, Marchinski,“ rief er mit unterdrückter Stimme dem sich immer mehr verlierenden Laternenschimmer nach, „du gehst jetzt sogleich und revidierst die Posten im Dorf – verstanden?!“
Aber der Unteroffizier war wohl schon zu weit entfernt. Jedenfalls gab er keine Antwort.
„Laß ihn laufen!“ brummte Assumoff, dessen Atem auf Schritte nach Alkohol roch. „Der dumme Kerl kriecht lieber ins Stroh, als daß er hier im Regen herumspionieren wird. – Komm’ jetzt. Es ist wenig behaglich hier draußen. Im Hause wird’s dafür hoffentlich desto angenehmer werden …“
In der Haustür führte eine von Gras überwucherte Steintreppe von wenigen Stufen hinab.
Der trunkene Leutnant stolperte über einen bloßen Stein und schlug lang hin. Er mußte sich das eine Schienbein arg zerschunden haben, da er laut fluchte, ohne sich sofort wieder zu erheben.
Diese Gelegenheit war zu günstig. Timuleit stellte die Laterne beiseite und packte zu. Sein Hände legten sich wie Eisenklammern um Iwan Assumoffs Hals.
Der Leutnant schlug mit Armen und Beinen um sich. Aber er kam nicht mehr hoch. Immer matter wurden seine Bewegungen. Und dann glitten auch schon Pelchersen und Spelnik aus der Tür, jeder mit einem Strick versehen. Die ersten Schlingen legten sich um des halb Erwürgten Hände und Füße …
Da – drei Köpfe flogen hoch – da plötzlich Marchinskis drohende Stimme:
„Weg da von dem Leutnant, Gesindel, oder ich schieße …!“
Kaum sechs Schritte vor der Treppe stand er, die Laterne vor der Brust befestigt. Und in der Hand hielt er schußbereit seinen Karabiner.
Timuleit überschaute mit einem Blick die mehr als bedrohliche Lage. Er suchte Zeit zu gewinnen.
„Assumoff ist gestürzt und hat sich den Kopf verletzt,“ sagte er, sich langsam aufrichtend, indem er dabei unauffällig in die Tasche seines Beinkleides langte, in der eine geladene Pistole steckte.
Aber der Kurländer war auf seiner Hut, riß den Karabiner an die Backe und …
Zwei Schüsse waren’s, die kurz hintereinander und daher fast wie ein einziger klingend die Stille der Nacht mit hartem Knall zerschnitten.
Der Unteroffizier taumelte, fiel hintenüber, raffte sich aber sofort wieder auf und verschwand in der Dunkelheit.
Oben in der Haustür aber stand Erna Hartwig und riß die Kammer ihres Karabiners auf, um eine frische Patrone aus dem Magazin in den Lauf einzuführen.
Timuleit wischte sich mit der Hand über die Schläfe. An seinen Fingerspitzen klebte Blut. Des Russen Kugel hatte ihm nur einen ganz leichten Streifschuß beigebracht.
„Das kam keine Sekunde zu früh, gnädiges Fräulein,“ bedankte er sich bei Erna Hartwig. „Schade nur, daß Sie den listigen Fuchs nicht besser getroffen haben.“
Da mischte Pelchersen sich ein.
„In einer Viertelstunde spätestens haben wir die Kosaken auf dem Hals. Karl – schleunigst heraus aus dem Stall mit den Gäulen. Und den bewußtlosen Assumoff nehmen wir mit. Wer weiß, ob wir ihn nicht noch brauchen können …“
* * *
Drei Minuten später verließen die Flüchtlinge im Gänsemarsch den Hof des Schulhauses. Voran schritt Karl Timuleit, der sich noch vor Dunkelwerden etwas in der nächsten Umgebung umgesehen hatte und die Landsleute nun geradeswegs auf einen Pfad im nahen Walde zuführte, der sich späterhin in dessen Tiefen verlor.
Sofort in dem dichten Forst unterzutauchen, bildete für die kleine deutsche Schar die einzige sichere Aussicht auf Rettung. Dieser Vorschlag, der von Erwin Pelchersen ausgegangen war, hatte sofort die Billigung der anderen drei Männer gefunden. Den Gedanken, auch die wehrfähigen Krapschaker aus den Händen der Kosaken zu befreien, mußte man leider aufgeben, obwohl man ursprünglich diese Absicht gehabt hatte, die man dann aber wegen des Entweichens des von Erna Hartwig nur verwundeten Unteroffiziers aufzugeben gezwungen war, wenn man nicht den ganzen Plan scheitern lassen und sich dazu noch einer brutalen Bestrafung wegen der an den beiden Posten, dem Leutnant Assumoff und Marchinski verübten Gewalttätigkeiten aussetzen wollte.
Bevor noch der schweigend durch die regnerische Nacht dahinwandernde Zug den Waldrand erreicht hatte, vernahm man schon vom Dorf her lautes Rufen. Die Kosaken war mithin bereits von dem blonden Kurländer alarmiert worden.
Eiliger schritt der Führer Timuleit aus, hinter dem zunächst die drei Frauen, dann der Pfarrer und endlich Spelnik und Pelchersen mit je einem der beiden Packpferde am Zügel folgten. Dem kräftigsten der Tiere hatte man noch den Leutnant aufgeladen, den man gefesselt und geknebelt hatte.
Assumoff war aus seiner Betäubung längst erwacht, verhielt sich aber ruhig. Ein Fluchtversuch war ja auch unmöglich. Die Füße waren ihm unter dem Leibe des Pferdes zusammengebunden, ebenso die Hände auf dem Rücken verknotet. Außer dem Knebel im Munde trug er auch ein Tuch über den Augen, so daß er nicht einmal im Stande war festzustellen, was um ihn herum geschah.
Jetzt bog Timuleit in die völlige Dunkelheit des Waldes ein. Der schmale Pfad war kaum zu erkennen, und es gehörten schon die tadellosen Augen des früheren Hausdieners dazu, um sich in dem Unterholz der hohen Buchen und Kiefern zurechtzufinden. Das Vordringen ins Ungewisse hinein ging daher auch nur sehr langsam von statten. Oft genug stolperte Timuleit über irgendein Hindernis, oft genug kam er von dem in vielfachen Windungen laufenden Holzfällerweg ab und mußte dessen Fortsetzung dann erst mühsam suchen.
Endlich glaubte er es wagen zu dürfen, eine der Laternen anzuzünden, die er mit einem Stück Leinwand derart verhüllte, daß nur ein kleiner Lichtschein vor ihn auf den Pfad fiel.
So verging eine halbe Stunde. Die Pastorin begann jetzt immer unsicherer auf den Füßen zu werden. Oft genug strauchelte sie, und leise Seufzer trieb die zunehmende Erschöpfung immer häufiger über ihre Lippen, bis sie dann mit einem nur noch gehauchten „Ich kann nicht weiter …“ zu Boden sank.
Der Zug hielt sofort. Pfarrer Günther kniete neben seiner treuen Lebensgefährtin nieder und flößte ihr einige Tropfen mit Wasser vermischten Alkohols ein. Langsam erholte sie sich. Aber daran, daß sie die Flucht weiter zu Fuß fortsetzen könne, war nicht zu denken.
Die Lage der kleinen Schar war infolgedessen recht besorgniserregend geworden. Wenn die Kosaken auch jetzt in der Nacht den von den Flüchtlingen und besonders von den Pferden hinterlassenen Spuren nur sehr langsam mit Hilfe von Fackeln folgen konnten, so durfte man sich doch nicht lange aufhalten, sondern mußte bis zum Morgengrauen soweit in die Wälder eingedrungen sein, daß man sich die Zeit lassen konnte, die entstandene Fährte zu verwischen oder aber einen Weg einzuschlagen, auf dem keinerlei Spuren zurückblieben. An diese Notwendigkeit, eine längere Strecke sozusagen unsichtbar für die Verfolger zu marschieren, hatte Pelchersens erinnert, indem er darauf hinwies, daß gerade die Kosaken als halbwilde, in der Steppe Südrußlands aufgewachsene Reiter sicherlich recht gute Fährtensucher sein würden.
Kein Wunder, daß sich jetzt aller eine gewisse Niedergeschlagenheit bemächtigte, die zunächst nur in bedrücktem Schweigen zum Ausdruck kam. Zwar erbot sich der kräftige Spelnik, die Frau Pastor zu tragen, aber für die Dauer konnte wohl auch er die menschliche Last nicht bewältigen. Da war es wieder der Storchnest-Apotheker, der den Vorschlag machte, man solle aus den mitgenommenen Riemen und Stricken und ein paar Ästen einer Art Tragbahre fertigen, die zwischen den beiden Pferden befestigt werden könne.
Wie schon verschiedentlich an diesem aufregenden Abend, so wurde die von Pelchersen gegebene Anregung von Karl Timuleit noch in manchen Einzelheiten ergänzt und zur Ausführung gebracht.
Beim Schein zweier Laternen stellten der Apotheker und sein ehemaliger Hausdiener eine recht zweckentsprechende, einem kurzen Liegestuhl ähnliche Sitzgelegenheit her, während August Spelnik wieder die Geschirre der Pferde derart veränderte, daß die Tiere in einem bestimmten Abstand nebeneinander hergehen mußten.
Der Pastor und Erna Hartwig hielten inzwischen auf dem Pfad in einiger Entfernung nach dem Dorfe Wache, damit man nicht etwa von den Verfolgern überrascht würde.
Diese Rast inmitten des Forstes bei tiefer Dunkelheit und stetem Regen hatte eben so viel Abenteuerliches wie Nervenaufpeitschendes an sich. In schweren Tropfen rieselte ringsum die Nässe von Blatt zu Blatt mit klatschenden Geräuschen, die sich zu einem anhaltenden Rascheln vereinigten. In den von einem leichten Wind hin und her bewegten Baumkronen rauschte es wie das ferne Branden der See. Und fast lautlos, nur leise miteinander flüsternd, arbeiteten die drei Männer an dem Tragsitz und den Geschirren der Pferde. Hin und wieder glitt ein Lichtstrahl der Laternen auch über den auf dem feuchten Boden sitzenden, gefesselten Leutnant hinweg, den Spelnik vom Pferde gehoben hatte, um ungehindert die notwendigen Veränderungen an dem Riemenzeug der Tiere ausführen zu können. Neben der in Decken gehüllten Pastorin saß Grete Spelnik, die seit jenem Tage, als Karl Timuleit seine Verräterrolle ausgespielt und bewiesen hatte, mit welcher Selbstverleugnung er zum Wohle der anderen sich der allgemeinen Verachtung ausgesetzt hatte, auffallend still und insichgekehrt war. Vielleicht machte sie sich heimlich bittere Vorwürfe darüber, daß sie dem jungen, hübschen Menschen, den sie stets recht gut hatte leiden mögen, während der Zeit des scheinbaren Abfalles von seinen Landsleuten so schlecht behandelt hatte, schlechter noch als die übrigen, da gerade ihr Timuleits Verrat am meisten nahegegangen war.
Aufmerksam beobachtete sie jetzt unauffällig das eifrige hin und her eilen Timuleits, der ihr geflissentlich auswich und mit dem sie seit langem kein Wort mehr gewechselt hatte. Sie ahnte nicht, daß die Pastorin sehr wohl bemerkte, wohin ihre Blicke immer wieder wanderten.
Dann flüsterte Frau Günther ihr plötzlich zu, indem sie ihre Hand ergriff und leise drückte:
„Wir haben dem Karl Timuleit viel abzubitten, liebe Grete. Auch Sie sollten recht freundlich zu ihm sein. Ihr Vater schwebte fraglos in großer Gefahr. Die Russen hätten ihn sicher vor ein Kriegsgericht gestellt, weil er den Kosaken mit dem Stuhl niedergeschlagen hat. Wenn unsere Flucht gelingt und ihr Vater auf diese Weise seinen Häschern entgeht, so hat Timuleit das Hauptverdienst daran.“
Grete Spelnik nickte verwirrt. Gut, daß es ringsum so dunkel war, und die Pastorin nicht bemerken konnte, wie rot sie geworden war. –
Dann sagte sie unsicher:
„Bei nächster Gelegenheit werde ich gutmachen, was ich in falscher Beurteilung der Sachlage gefehlt habe.“
Frau Günter lächelte ein wenig.
„Ich glaube kaum, daß Timuleit die ihm zur Versöhnung entgegengestreckte Hand zurückweisen wird,“ sagte sie. Und in Gedanken fügte sie nur für sich selbst hinzu: „Glückliche Jugend …! Auch in diesen schweren Zeiten geht die Liebe durch die Welt mit leisen Schritten und sucht sich die Herzen aus, die sie gern aneinander ketten möchte. Und es freut mich, daß dem so ist. Fällt doch auch auf uns Alte ein Widerschein dieses erwachenden Glückes zurück.“ – –
Der Tragstuhl war fertig, und der Weitermarsch konnte angetreten werden.
Man kam jetzt schneller vorwärts als vorhin, wo auf die von den Strapazen und Aufregungen der letzten Tage ermattete Pastorin hatte Rücksicht genommen werden müssen.
Von den Verfolgern hatte man bisher nichts bemerkt. Spelnik als altgedienter Soldat meinte, die Kosaken würden sicherlich zunächst die gebahnten Straßen nach den Flüchtlingen absuchten und sich während der Nacht kaum damit abgeben, auf gut Glück den Wald zu durchstreifen. Pelchersen und Timuleit stimmten ihm zu. Infolgedessen wuchs auch die Zuversicht der Frauen, daß man sich glücklich würde in Sicherheit bringen können.
August Spelnik, dem von dem Holzeinkäufen her die Gegend bis nach Balki hinab recht gut bekannt war, hatte Pelchersen vorhin mitgeteilt, daß diese Forsten westlich der sogenannten Chaussee nach einigen Meilen in ein weites, unwegsames Sumpfgebiet übergingen, in dem außer Elchen auch noch der Luchs und anderes Wild zahlreich vorhanden sein sollte. Ebenso wußte er zu berichten, daß die Wälder von einem flachen Nebenfluß des Pzarow durchströmt wurden.
Gerade diese Angaben waren es gewesen, die dem jungen Apotheker, der stillschweigend als Führer der deutschen Flüchtlinge anerkannt worden war, dazu bestimmt hatten, die Richtung nach Westen hin einzuschlagen. Hoffte er doch, in den Sümpfen vielleicht einen Schlupfwinkel zu finden, in dem man vor Nachstellungen sicher war. –
Gegen Morgen hörte der Regen endlich auf. Als die Dämmerung des heraufziehenden Tages anbrach, verschwand jede Spur eines Pfades, und Timuleit hatte nun die nicht leichte Aufgabe, seine Landsleute durch das dichte Unterholz immer weiter nach Westen zu führen. Mit großem Geschick erledigte er dies, und bald mußte er dann am Ufer des von August Spelnik angekündigten Flusses halt machen, der an dieser Stelle eine breite von vielleicht fünfzehn Meter hatte.
Pelchersen entschied sich jetzt dafür, in dem flachen Wasser eine ganze Strecke stromauf zu waten, um für die Verfolger die Spuren unsichtbar zu machen. Zum Glück war der Grund des Flusses sandig, so daß auch die Pferde nur wenig einsanken. Nach einer guten halben Stunde erstieg man dann das jenseitige Ufer und zwar in einer Weise, daß recht deutliche Fährten zurückblieben. Nachdem man hierauf eine Strecke in den Wald eingedrungen war, wurden den Pferden die Hufe mit Decken umwickelt, und auch die Männer und die beiden jungen Mädchen sorgten durch Ausziehen ihrer Schuhe dafür, daß jetzt keinerlei tiefere Fußeindrücke zurückblieben. Durchnäßt waren Schuhe und Strümpfe ja ohnehin, so daß diese Vorsichtsmaßregel niemanden Überwindung kostete. Abermals wandten sich die Flüchtlinge jetzt dem Flusse zu, indem sie auf ihren eigenen Spuren zurückkehrten, abermals wateten sie ein Stück im Wasser stromabwärts und betraten dann wieder im Wald, wo sie zunächst eine Weile unweit des Ufers Rast machten, damit Pelchersen und Timuleit wie beim Verlassen des Flusses trotz aller Vorsicht doch noch entstandene Fährten verwischen konnten.
Inzwischen war es heller Tag geworden.
Die Gesichter der sieben Krapschaker Verschleppten sahen bleich und übernächtig aus. Eingehüllt in die groben Decken saßen die drei Frauen, gegen den Stamm einer uralten Buche gelehnt, da. Bald waren sie trotz der unbequemen Stellung eingeschlummert. Auch Pastor Günther kämpfte umsonst gegen die zunehmende Müdigkeit an. Schließlich streckte er sich lang auf dem taufeuchten, nadelbestreuten Waldboden hin, legte den Kopf auf einen halbverfaulten Baumstumpf und war auch im Nu eingeschlummert.
7. Kapitel.
Zwei Stunden Ruhe gönnte Pelchersen den Gefährten. Dann weckte er sie. Schlaftrunken erhoben sie sich, und gleich darauf setzte der Zug sich wieder in Bewegung, Karl Timuleit als Führer abermals ein Stück voraus.
Erna Hartwich drehte sich, als man eben eine kleine Lichtung passierte, nach dem hinter ihr gehenden Spelnik um.
„Wo ist eigentlich Herr Pelchersen?“ fragte sie mit einer gewissen Unruhe in der Stimme.
Der reiche Bauer wurde verlegen.
„Hm – er wird schon nachkommenden, Fräulein,“ meinte er ausweichend.
Da wurde das junge Mädchen mißtrauisch.
„Wir sind schon eine reichliche Viertelstunde unterwegs. Und ich habe sehr wohl bemerkt, daß Herr Pelchersen an der Stelle zurückblieb, wo wir vorhin rasteten. Er hätte uns längst eingeholt haben müssen, Herr Spelnik. Sie verbergen mir irgend etwas, ohne Frage …!“
Der breitschultrige Riese, der jetzt die beiden Pferde, zwischen denen der Tragsessel hing, an den Zügeln hinter sich herzog, warf einen Blick auf die Pastorin und sagte dann leise:
„Eigentlich sollten es die Damen und der Herr Pfarrer nicht merken. Wir drei, Herr Pelchersen, der Timuleit und ich, haben alles verabredet, als Sie und die anderen schliefen, Fräulein Hartwig. Der Herr Apotheker ließ sich davon nicht abbringen. Er meinte, wir müssten darüber unbedingt Bescheid wissen.“
„Ja,– worüber denn?!“ fragte Erna ungeduldig.
„Nun, – ob die Kosaken hinter unsere List kommen würden.“
„Ach so. Ich verstehe. Also Herr Pelchersen ist allein an unserem eben verlassenen Lagerplatz zurückgeblieben, nicht wahr …?“ forschte das Mädchen gespannt.
Spelnik schüttelte den Kopf.
„Nein, das nicht, Fräulein. Er ist nach jener Stelle geschlichen, wo wir den Fluß zum ersten Mal verließen. Dort will er sich verstecken und die Kosaken beobachten.“
Erna Hartwig zuckte ordentlich zusammen.
„Aber – das ist doch ein allzu großes Wagnis!“ sagte sie erregt. „Mußte das denn sein?! Denken Sie, Herr Spelnik, – wenn die Russen ihn aufspüren …! Dann ist er verloren …!“
„Er ließ sich nicht davon abbringen,“ erwiderte der riesige Bauer achselzuckend. „Und so ganz unrecht hat er ja nicht damit, daß er dem Timuleits und mir vorhielt, wir müssten uns darüber Aufklärung verschaffen, ob die Kosaken noch hinter uns her seien oder ob unsere List sie von unserer Spur wirklich abgebracht hat.“
Erna Hartwig sagte nichts mehr. Eine ganze Weile schritt sie nachdenklich neben Spelnik her. Dann wandte sie sich abermals ihm zu.
„Wie wird Herr Pelchersen uns aber finden …?!“ meinte sie besorgt. „Wir wandern hier noch immer ohne Schuhe weiter und hinterlassen auf dem elastischen Waldboden nicht die geringste Fährte.“
Spelnik schaute das junge Mädchen treuherzig an.
„Nicht wahr, Fräulein Hartwig, Sie begreifen’s auch nicht, daß er mit Hilfe dieser so gut wie unsichtbaren Spuren sich uns wieder anschließend will. Aber es ist so. Er sagt, er hat das alles bei den Indianern in Südamerika gelernt. – Ja, ja – unseren Apotheker habe ich überhaupt jetzt erst so recht erkannt. Das ist so ein ganz stiller, der von seiner Person nie viel redet. Und dabei besitzt er trotz seines kurzen Fußes eine Gewandtheit und auch sonst Körperkräfte, die ihm niemand zutraut. Jung sieht er aus wie ein Student, und doch ist’s ein ganzer Mann, unser wackerer Storchnest-Apotheker. Wirklich – der müßte sich im Leben so etwas mehr vordrängenden. Zu bescheiden sein taugt auch nichts.“
Erna nickte gedankenvoll. Unwillkürlich erinnerte sie sich an manche kleine Begebenheit, bei der sie Erwin Pelchersen sehr merklich hatte fühlen lassen, daß sie ihn nicht ganz für voll ansähe. Darüber schämte sie sich jetzt vor sich selbst. Was mochte er nur von ihr gedacht haben, wenn sie ihn geflissentlich übersehen hatte, nur weil er es mit den anderen Herren in der Kunst, leicht und nichtssagend zu plaudern, nicht aufnehmen konnte …?! Wie gering mußte er ihre geistigen Fähigkeiten eingeschätzt haben, ihre Menschenkenntnis und ihre Ansprüche an männliche Charaktereigenschaften, wie hatte er sie sicherlich oft genug belächelt, wenn sie die inhaltsleere Unterhaltung mit anderen einem ernsten Gespräche mit ihm vorzog …! –
Und weiter und weiter hinein in die endlosen Forsten von Balki verlor sich die kleine Schar der deutschen Flüchtlinge.
Karl Timuleit hatte jetzt an Stelle Pelchersens das Kommando übernommen. Nach zwei Stunden, gegen sieben Uhr morgens, ließ er abermals rasten. Während die anderen mit Ausnahme Spelniks, der die Wache übernahm, sofort sich zum Schlafe niederlegten, eilte der ehemalige Hausdiener eine geraume Strecke voraus, um sich die Umgebung genauer anzusehen. Verschiedene Anzeichen hatten ihm nämlich gesagt, daß man sich dem Sumpfgebiet nähere. So waren zum Beispiel zuletzt die Gruppen von Birken, Erlen und anderen, auf feuchtem Boden wachsenden Bäumen immer häufiger geworden. Farnkraut und Wasserpflanzen tauchten ebenfalls auf, und hier und da sah man an tieferen Stellen verfilzte Moosgebilde, die darauf hindeuteten, daß hier in der nassen Jahreszeit Wasserlachen vorhanden waren.
Nach einer Stunde fand Timuleit sich auf dem Lagerplatz wieder ein.
Spelnik saß ein paar Schritte von Leutnant Assumoff entfernt am Boden. Er hatte dem Kosakenoffizier die Fesseln der Hände gelöst und ihm auch die Augen von dem Tuch befreit, ebenso den Knebel entfernt.
Als Iwan Assumoff den jungen Deutschen, der ihn so listig getäuscht hatte, erblickte, färbte sich sein Gesicht vor Wut dunkelrot.
„Hund,“ zischte er Timuleit an, „ich lasse dir die Haut in Striemen …“
Er kam nicht weiter.
Ein Wink von Timuleit an Spelnik genügte und im Nu hatte Assumoff den Knebel wieder im Munde. Fest schnürte ihm der Strick die Hände auf dem Rücken abermals zusammen.
Dann gingen die beiden Deutschen etwas abseits und setzten sich nebeneinander ins Moos. Timuleit erstattete Bericht über seinen Kundschaftergang.
„Eine Viertelstunde vor uns, ein wenig nach Süden zu, beginnt ein sumpfiges Wasserbecken von anscheinend recht bedeutender Ausdehnung. Ohne Frage ist’s ein früherer See, der jetzt zum größten Teil verkrautet ist. Kleinere und größere Inseln habe ich inmitten dieses nassen Moores bemerkt. Birken und Sträucher wuchern auf diesen trockenen Stellen. Jedenfalls ist’s eine Wildnis, wie wir sie uns für unsere Zwecke kaum geeigneter denken können. Ich werde daher Pelchersen den Vorschlag machen, daß wir uns ein Floß bauen und die offenen Wasserrinnen dieses Sumpfes damit befahren, um ein Versteck für uns zu suchen. Ich denke dabei an eine größere Insel, auf der wir uns vielleicht vorläufig niederlassen können.“
„… und auf der uns die Mücken auffressen werden,“ setzte Spelnik hinzu, der von diesem Vorschlag nicht viel zu halten schien.
„Sie übersehen, daß der Herbst vor der Tür ist,“ verteidigte Timuleit seinen Plan. „Außerdem, Mücken sind besser als Kosaken, und ein paar Dutzend Mückenstiche ohne Frage angenehmer als ein einziger Lanzenstich …!!“
Aber eine Einigung zwischen den beiden Männern kam trotz dieses Hinweises nicht zu Stande. –
Eine Stunde später kehrte dann Pelchersen ziemlich erschöpft zurück. Er sah stark übermüdet aus, hatte aber in den Augen einen triumphierenden Glanz, der auf einen guten Erfolg der angewandten Kriegslist schließen ließ.
Erna Hartwig war inzwischen munter geworden. Beim Erscheinen des Apothekers näherte sie sich schnell den jetzt flüsternd bei einander stehenden drei Männern.
Kameradschaftlich und mit ehrlicher Herzlichkeit streckte sie Pelchersen die Hand hin.
„Sie haben für uns alle viel gewagt,“ sagte sie warmen Tones. „Jedenfalls will ich nicht verabsäumen, Ihnen meinen Dank für Ihre Aufopferung sofort auszusprechen.“
Pelchersens Wangen, die die körperliche Entspannung farblos gemacht hatte, röteten sich erneut. Noch nie hatten Erna Hartwigs lebenswarme Finger die seinen mit so festem Druck umspannt, noch nie waren ihre Augen so leuchtend den seinen begegnet.
Er wurde verwirrt. Eine heiße Welle sehnenden Zärtlichkeitsgefühls strömte ihm zum Herzen. Mit aller Macht fühlte er wieder die Liebe zu diesem starken, selbstbewußten Mädchen seine Seele in tausend Schwingungen versetzen.
Aber ebenso schnell schüttelte er die Befangenheit wieder ab. Hier in Gottes freier Natur, unter diesen außergewöhnlichen, abenteuerlichen Verhältnissen war er nicht mehr der schüchterne, scheue Erwin Pelchersen, der sich stets nur seines körperlichen Gebrechens erinnerte, der sich stets als Krüppel ängstlich bei Seite hielt.
„Machen Sie nicht zuviel Aufhebens von diesem Kundschaftergang, gnädiges Fräulein,“ sagte er kurz „für einen, der im Innern der Urwälder Westbrasiliens den Indianern nachgespürt hat, war dieses Unternehmen wirklich eine Kleinigkeit. Die Hauptsache ist, daß unsere Kriegslist vollen Erfolg gehabt hat. Eine Rothaut hätte sich freilich nicht so leicht täuschen lassen wie diese Kosaken, die dort hinter uns noch immer nach der Fortsetzung der Fährte vergeblich suchen dürften.“
Dann wandte er sich an Timuleit und ließ sich über das nahe Moor nähere Angaben machen. Nach kurzer Beratung, an der sich auch Erna Hartwig beteiligte, entschied man sich dahin, daß zunächst Pelchersen und der frühere Hausdiener auf einem kleinen Floß die weiten Sümpfe befahren und nach einem passenden Schlupfwinkel absuchen sollten, während die übrigen Flüchtlinge in der Nähe in einem Versteck das weitere abwarteten. Dieses war bald in Gestalt eines winzigen, von undurchdringlichem Unterholz umgebenen Tales gefunden. Wieder zog sich die kleine Schar in diesen sicheren, neuen Lagerplatz unter allen möglichen Vorsichtsmaßregeln zur Vermeidung von Spuren zurück. Dann begaben sich Pelchersen, Spelnik und Timuleit, nachdem man sich vorher zusammen an den aus dem Schulhaus mitgenommenen Eßvorräten gestärkt hätte, versehen mit den nötigen Werkzeugen an eine entfernte Uferstelle des Sumpfes und bauten hier aus gefällten Stämmen ein Floß. Diese Arbeit nahm mehrere Stunden in Anspruch. Als das plumpe Fahrzeug fertig war, kehrte Spelnik nach dem Lagerplatz zurück. Die beiden jüngsten männlichen Mitglieder der kleinen Gesellschaft aber stießen mit Hilfe von Stangen, die sie aus schlanken, ihrer Äste beraubten Tannenbäumen hergestellt hatten, vom Ufer ab und lenkten in die breiteste der offenen Wasserrinnen ein, um sich weiter nach der Mitte des großen Moorgebietees vorzuarbeiten.
Von der Ausdehnung dieses erhielten Pelchersen und Timuleit jetzt eine richtige Vorstellung. Immer neue Rinnen öffneten sich vor ihnen, manche davon breit und vielgestaltig wie kleine Seen. Auf dem bräunlichen Wasser schwammen überall große Blätter von allerlei Sumpfpflanzen, besonders von Wasserrosen. Die Inseln waren bald kaum einige Quadratmeter groß, bald von erheblichem Umfang. Birken, Brombeeren und allerlei niedrige Waldfrüchte, so Erd-, Blau- und Preißelbeeren, bedeckten den Boden neben Moospflanzen, die in hellerem Grün ihrer dichten Pflanzenverästelungen aufleuchteten. Auch Pilze aller Art schienen hier in Menge vorzukommen.
Beinahe eine Stunde hatten die beiden Leidensgefährten ihr Floß nun schon von Rinne zu Rinne weitergelenkt, wobei sie sich lediglich nach Pelchersens kleinem Taschenkompaß richteten, den dieser an der Uhrkette trug.
Dann landeten sie an einer Insel, die mitten in einer runden seeartigen offenen Stelle klaren Wassers lag und, wie sie durch Umrunden feststellten, etwa einhundertundfünfzig Meter Durchmesser hatte.
Nach dem Pelchersen die Insel genau in Augenschein genommen hatte, beschloß er, hier die beabsichtigte kleine Niederlassung zu gründen, bis das Vorrücken der deutschen Heere nach Rußland hinein, auf das er bestimmt rechnete, ihnen die Möglichkeit geben würde, wieder in die ostpreußische Heimat zurückzukehren. – –
Gegen Abend waren dann sämtliche Mitglieder der Flüchtlingsschar nach der Insel hinübergeschafft worden. Die beiden Pferde ließ man vorläufig in dem versteckten Tal, da es zu viel Mühe gekostet hätte, auch sie nach dem Eiland zu bringen. Spelnik übernahm es, für ihre Fütterung zu sorgen. Jedenfalls sollten die Tiere den unfreiwilligen Ansiedlern später noch von großem Nutzen werden.
Bei der Überfahrt nach der Insel ereignete sich ein Zwischenfall, der dem russischen Offizier beinahe das Leben gekostet hätte. Assumoff, dem Pelchersen die Fesseln jetzt abgenommen hatte, machte nämlich, als das Floß sich bereits ein Stück vom Ufer entfernt hatte, einen Fluchtversuch. Er wollte auf das feste Land zurückspringen, glitt aber auf den feuchten Stämmen des Floßes aus und fiel ins Wasser, das hier eine beträchtliche Tiefe hatte. Des Schwimmens unkundig, hätte dieses Wagnis für ihn sehr böse ablaufen können, wenn Timuleit ihn nicht aus dem feuchten Elementen noch rechtzeitig herausgeholt haben würde.
Immerhin brachte dieser Vorfall Pelchersen auf einen guten Gedanken. Da der Gefangene, der ständig hätte bewacht werden müssen, den Deutschen mit der Zeit doch recht lästig geworden wäre, schaffte man ihn, ohne ihm den eigenen Zufluchtsort zu verraten, mit verbundenen Augen auf eine kleine, nur mit Gebüsch bestanden Insel, die in einem anderen seeartigen Becken des riesigen Sumpfes lag und von der ihm ein Entweichen unmöglich war.
Pelchersen hatte dann noch, bevor man den Gefangenen allein ließ, mit ihm eine sehr ernste Unterredung, bei der er ihm zunächst sein geradezu barbarisches Verhalten den Krapschakern gegenüber vorhielt und von ihm das Ehrenwort verlangte, daß er keinen Fluchtversuch unternehmen werde.
Assumoff mußte sich in dieser ersten Nacht mit zwei Decken und einem Stück Öltuch als Schutz gegen die Unbill der Witterung begnügen, ebenso wie er auch nur einige Schnitten trockenes Brot zum Stillen des Hungers erhielt. Als das Floß dann wieder von der winzigen Insel, die vielleicht einige vierzig Schritt Durchmesser hatte, abstieß, grüßte er Pelchersen ganz höflich und zog sich hierauf hinter die Büsche zurück.
Absichtlich machte Timuleit, der sich als zweiter auf dem schwerfälligen Fahrzeug befand, auf der Fahrt nach dem neuen Schlupfwinkel der Flüchtlinge allerlei Umwege durch verschiedene sich kreuzende Wasserrinnen, damit Assumoff darüber im unklaren blieb, wo sich das Versteck der Deutschen befand.
8. Kapitel.
Als Timuleit und Pelchersen das Floß an das flache Ufer der nunmehr von den deutschen Flüchtlingen bevölkerten Insel trieben, kam ihnen Pfarrer Günther entgegen.
„Wir sind hier inzwischen schon recht fleißig gewesen, liebe Gefährten,“ meinte er. „Auf dem vorher vereinbarten, von Gebüsch und Bäumen geschützten Hügel in der Mitte unseres Eilandes haben wir zwei Zelte errichtet, und jetzt sind die Damen schon dabei, uns eine Pilzsuppe zu kochen, damit wir eine warme Mahlzeit zu uns nehmen können. – Ja, ja, mein lieber Pelchersen, – eigentlich hätten Ihnen während Ihrer Abwesenheit ordentlich die Ohren klingeln müssen. So lobend haben wir alle uns über Ihre Umsicht ausgesprochen. Eine bessere Auswahl an Gegenständen, die uns unser verborgenes Dasein hier erleichtern sollen, hätten Sie kaum treffen können. Das haben wir soeben so recht erkannt, als wir unsere Werkzeuge, Haushaltsgeräte und all das andere ausgepackt haben.“
Dann schritten die drei der Mitte der Insel zu. Zwischen den beiden Zelten, von denen eins vorläufig den Frauen, das andere den Männern zur Wohnung dienen sollte, brannte unter einem eisernen Dreifuß, auf dem ein großer Kochtopf stand, ein Feuer. Jedes der Mitglieder der kleinen Schar war eifrig beschäftigt. Gab es doch genug zu tun, um sich recht schnell hier häuslich einzurichten.
Pelchersen unterzog dann die auf den beiden Pferden mitgeführten Gegenstände einer eingehenden Musterung. Das aus dem Schulhause mitgenommene Eßgeschirr genügte für ganz bescheidene Ansprüche. Dagegen war es unbedingt nötig, sich für den Winter – denn man konnte ja nicht wissen, wie lange dieses Zigeunerleben notwendig dauern würde – einen größeren Vorrat an den einfachsten Lebensmitteln, so besonders Kartoffeln, Salz und manches andere, zu beschaffen. Dieses „beschaffen“ war nun leider gleichbedeutend mit „in unerlaubter Weise wegnehmen“ oder, um es ganz treffend zu bezeichnen, mit „stehlen“. –
Doch – Not kennt kein Gebot! Und mit Gewissensbedenken durfte man sich in der Lage der Flüchtlinge nicht quälen. Das betonte nachher auch der Pastor, als man im Kreise beisammensaß und aus den Blechtellern die Pilzsuppe auslöffelte, trockenes Brot dazu aß und beriet, wie man sich das Dasein auf der Insel möglichst behaglich einrichten könne.
Pfarrer Günther hatte im Laufe der Unterhaltung bei der Mahlzeit das weite Sumpfgebiet einige Male die „Tausend Inseln“ in Anlehnung an die gleiche Bezeichnung eines Teils des Ontario-Sees in Nordamerika genannt, ein Name, der von den Flüchtlingen dann bald allgemein gebrauch wurde. Ebenso taufte man auf seinen Vorschlag hin diese von Wasser rings umgebene Zufluchtsstätte „Hoffnungseiland“. – –
In den nächsten Tagen arbeitete alles eifrig an der Errichtung von zwei Hütten, die aus Kiefernstämmen hergestellt wurden und von denen die größere als Wohnhaus, die kleinere als Vorratsspeicher dienen sollte. Man verwandte nur dünne, schlanke Stämme zu den Wänden, die aus einer doppelten Reihe von Pfählen bestanden, deren Zwischenraum mit Moos ausgefüllt wurde, so daß man hoffen durfte, auch im Winter gegen die Kälte genügen geschützt zu sein.
Das Wohnhaus, in dem sich vier Räume befanden, erhielt ebenso wie der Vorratsspeicher ein weit überragendes Dach aus Baumstämmen, auf die wieder eine dichte Schicht Moos gebreitet wurde, während man die Ritzen mit demselben Material verstopfte. Immerhin verging eine Woche, ehe die beiden Hütten fertig wurden.
Während der Pfarrer und Spelnik dann die Anfertigung der nötigen Einrichtungsgegenstände in Angriff nahmen, darunter besonders einfache Kasten als Bettgestelle, Tische und Stühle, wobei ihnen Erna Hartwig und Grete Spelnik tüchtig halfen, bauten Pelchersen und Timuleit für den Gefangenen auf dessen Inselchen gleichfalls eine Hütte, die einen Herd von Steinen enthielt, damit Assumoff sich selbst seine Mahlzeiten zubereiten konnte.
Nachdem in dieser Weise für den Leutnant gesorgt war, der sich mit bewundernswerter Gleichgültigkeit mit seinem Schicksal abgefunden zu haben schien und fleißig mithalf, um sein Heim recht bald beziehen zu können, begannen die beiden jüngeren Männer die Ansiedlung mit allem Nötigen zu versorgen, indem sie weite Ausflüge in die Umgegend unternahmen und nachts die Felder entfernter Dörfer plünderten. Diese Ausflüge, die zumeist zwei Tage in Anspruch nahmen und bei denen Pelchersen und Timuleit mit größter Vorsicht sich bewegten, waren nicht ganz ungefährlich. Oft genug bewahrte nur die größte Achtsamkeit die beiden Männer vor unerwünschten Begegnungen mit russischen Truppen, die die Hauptwege im Westen und Osten der Tausend Inseln oft in endlosen Kolonnen bedeckten. Diese zogen sämtlich der ostpreußischen Grenze zu, ein Beweis, daß die Deutschen offenbar noch nicht zum Gegenstoß wider die feindliche Invasion angesetzt hatten.
Regelmäßig nahmen die beiden auf diesen Streifzügen, bei denen sie bald auch die weitere Umgebung des mehrere Quadratmeilen großen, gänzlich unbewohnten Sumpfgebietes genau kennen lernten, die Pferde mit, auf die die erbeuteten Dinge verladen wurden.
Eines Tages hatten Pelchersen und Timuleit das Glück, auf der nach Balki führenden Straße zwei unbrauchbar gewordene Lastautomobile, die von den Begleitmannschaften vorläufig stehen gelassen worden waren, zu entdeckten. Die mächtigen Kraftwagen waren vollgepackt mit Lebensmitteln und allerlei Gebrauchsgegenständen. Nach den auf den Kisten befindlichen Aufschriften, gehörten sie dem Oberkommando einer russischen Armee. –
Hier gab es nun überreiche Beute. Um davon möglichst viel beiseite schaffen zu können, entschlossen sich die beiden Männer, ein Versteck in der Nähe im Walde anzulegen und dort zunächst alles zu verbergen, was ihnen des Mitnehmens wert schien.
Bei Anbruch der Dunkelheit waren sie auf die Kraftwagen gestoßen, und die ganze Nacht über arbeiteten sie beim milden Lichte des Vollmondes. Keinerlei Störung trat ein. Die Begleitmannschaften verbrachten die Nacht ohne Frage in dem nächsten Dorf.
Um nun die Durchsuchung der Kraftwagen möglichst unauffällig zu machen, entnahmen Pelchersen und Timuleit den Kisten und Paketen immer nur einzelne Gegenstände und brachten die Deckel und Verschnürungen stets wieder in Ordnung. Einiges ließen sie jedoch ohne jede Rücksicht mitgehen, so vier Acetylenlaternen und den gesamten Vorrat an dem dazu gehörigen Kabid, ferner drei zusammenlegbare Feldbetten, mehrere warm gefütterte Militärmäntel und manches andere noch.
Bei Tagesanbruch zogen sie sich in ein entfernteres Gebüsch zurück, von wo aus sie beobachten wollten, ob die Begleitmannschaften bei ihrer Rückkehr etwas von der Dursuchung der Ladung merken würden.
Die Leute tauchten denn auch gegen sieben Uhr morgens auf der Straße auf, kamen gemächlich näher und begannen dann nach den Schäden an den Motoren zu suchen. Eine Stunde später war der größere der Lastwagen wieder in Ordnung gebracht, wurde vor den anderen gespannt und zog diesen langsam dem nahen Dorfe zu.
Pelchersen und Timuleit atmeten auf. Und zwei Tage später waren all die verschiedenartigen Dinge aus dem Waldversteck glücklich nach dem Hoffnungseiland geschafft.
Besonders angenehm war es für die Flüchtlinge, daß sich unter den Beutestücken auch eine ganze Menge jener zum Unterbringen von Landkarten bestimmten Taschen befanden, die aus einem Lederrand und durchsichtigen Zelluloidplatten bestehen. Diese Zelluloidplatten hatte Timuleits sofort als vorzüglichen Ersatz für die den unfreiwilligen Ansiedlern noch fehlenden Fensterscheiben erkannt, und bald darauf besaß das Wohnhaus recht praktische Fenster, deren Mangel schon sehr störend empfunden worden war.
Die Lebensführung der Flüchtlinge, die in der Hauptsache sich nur auf der kleinen Insel bewegen konnten, wären wahrscheinlich schnell recht eintönig geworden, wenn Pelchersen nicht dafür gesorgt haben würde, daß jeder stets auf irgend eine Weise beschäftigt war.
Die Zubereitung der Mahlzeiten hatten die Pastorin und Grete Spelnik übernommen. Erna Hartwig war mit der Jagd und dem Einsammeln der Waldfrüchte betraut. Was die Jagd anbetraf, so mußte man sich ausschließlich auf den Fang von Rehen, Hasen, Kaninchen und Vögeln in Schlingen beschränken, da Gewehrschüsse zu leicht die Aufmerksamkeit der umwohnenden Bevölkerung hätten erregen können. Die Tochter des Gutsbesitzers, ohnehin eine leidenschaftliche Jägerin, versah denn auch die Küche der kleinen Siedlung reichlich mit Fleisch, das zum Teil, um es haltbarer zu machen, geräuchert wurde. Timuleit hatte der Erna Hartwig aus einem halb ausgefaulten Buchenstamm einen Kahn zurecht gezimmert, der bequem zwei Personen bergen konnte und in den sie stets zum Übersetzen nach dem Walde benutzte. Häufig begleitete der frühere Hausdiener der Storchnest-Apotheke sie bei diesen Jagdausflügen, was auf Veranlassung Pelchersens geschah, der sich stets um die Sicherheit Erna Hartwigs sehr besorgt zeigte, ihr im übrigen aber nach Möglichkeit auswich, soweit sich dies bei dem engen Beieinanderhausen tun ließ.
Der Tag begann meist schon recht früh für die Kolonisten. Sobald es draußen hell wurde, fand sich einer nach dem andern in dem gemeinsamen Speisraum ein, wo der Morgenimbiß in Gestalt einer Fruchtsuppe und gerösteter Kartoffeln sowie kalten Rauchfleisches eingenommen wurde. Dann begab man sich an die Arbeit. Die Mittagsmahlzeit versammelte die sieben Deutschen abermals in dem inzwischen ganz behaglich ausgestatteten Zimmer, das jetzt sogar einen gedielten Fußboden besaß, der mit einer Öltuchplane bedeckt war. Hierauf zogen sich die älteren Herrschaften, das Ehepaar Günther und August Spelnik, zu einem Verdauungsschläfchen zurück, während die beiden jungen Mädchen in der Küche das Geschirr reinigten und den Eichelkaffee aufbrühten, der, solange das Wetter noch warm blieb, unter einer großen nahen Buche getrunken wurde, wo Karl Timuleit eine Laube erbaut hatte. Nach dem Abendessen begannen die eigentlichen Feierstunden, wo man in ernstem Gespräch die verschiedenartigsten Gegenstände erörterte. Hierbei zeigte es sich stets, ein wie guter Erzähler Erwin Pelchersen war. Andächtig hörte alles zu, wenn er von seinen Reisen berichtete und anschauliche Schilderungen fremder Völker, ihrer Sitten und Gebräuche gab oder mit der Begeisterung des wahren Naturforschers die Schönheiten anderer Erbteile mit ihrer tropischen Pflanzenpracht und vielseitigen Tierwelt vor den Augen seiner Landsleute in greifbarer Deutlichkeit entstehen ließ. An warmen Abenden kam es wohl auch häufig vor, daß man auf dem Nachen oder gar dem tragfähigeren Floße Ruderpartien in entlegene Teile der Tausend Inseln unternahm. Besonders Timuleit und Grete Spelnik schienen diese Wasserfahrten sehr zu lieben, nachdem die Tochter des reichen Bauern bald nach der Übersiedlung auf das Hoffnungseiland mit dem von ihr so schwer verkannten und deshalb sehr schlecht behandelten kecken Storchnest-Hausdiener eine Aussprache ohne Zeugen gehabt hatte, bei der sogar von Seiten der hübschen, frischen Ostpreußin einige Reuetränen geflossen waren.
August Spelnik merkte sehr wohl, daß zwischen den beiden jungen Leuten sich etwas vorbereitete. Aber er trat in keiner Weise bei diesem Liebesidyll als Störenfried auf. Die Erlebnisse der letzten Wochen hatten dem früher so stark auf seinen Reichtum pochenden Bauern gezeigt, daß Karl Timuleit ein selten anschlägiger Kopf war, der auch mit der Bewirtschaftung eines Bauerngutes spielend leicht fertig werden würde. Und die hierzu notwendigen Eigenschaften mußte der Schwiegersohn des Dorfkrösus notwendig besitzen, da Grete dessen einziges Kind war, das seine früh verstorbene Frau ihm hinterlassen hatte.
Weit weniger aussichtsvoll war das Verhältnis zwischen dem anderen jungen Paare. Die Zurückhaltung Pelchersens Erna Hartwig gegenüber blieb niemandem verborgen. Und oft genug besprach der Pastor mit seiner Gattin diese auffallende Tatsache, für die niemand eine Erklärung finden konnte.
„Was meinst du, liebe Frau,“ fragte Günther eines Tages seine treue Ehehälfte, „ob ich nicht mal unseren Apotheker mir so etwas vornehme und ihn aushorche, weshalb er sich der Erna gegenüber so seltsam benimmt. Das Mädel leidet darunter. Das merke ich. Früher mag sie ja Pelchersen aus Mangel an Urteilsfähigkeit übersehen haben. Jetzt liegt die Sache anders. Ich behaupte sogar, daß sie ihn liebt. Er ist ja auch in der Tat ein selten prächtiger Mensch und ein so überaus gediegener Charakter.“
Aber die Pastorin wollte von einer solchen Einmischung eines Dritten nichts wissen.
„Unser Apotheker wird schon seine Gründe haben, weswegen er Erna so kühl und fremd behandelt. Die Sache mögen die jungen Menschen allein untereinander ausfechten. Da kann man höchstens nur etwas verderben.“
So ließ denn Günther die Dinge ihren Lauf nehmen und spielte nur weiter den stillen, teilnehmenden Beobachter.
Im allgemeinen konnten die Kolonisten mit ihrem Leben im Gebiet der Tausend Inseln ganz zufrieden sein. Dieses halbe Zigeunerdasein, bei dem man auf so viele Bequemlichkeiten verzichten mußte, erforderte eine große Anpassungsfähigkeit an die neuen, eigenartigen Lebensbedingungen. Zum Glück besaßen die sieben Krapschaker diese Eigenschaft sämtlich in so hohem Maße, daß sie die drückendsten Entbehrungen sogar mit stillem Humor hinnahmen. Hierzu gehörte das Fehlen von Brot und anderen Lebensmitteln, an die man von früher her nur zu sehr gewöhnt war. Ferner auch der Mangel an Kleidungsstücken und Wäsche. Bereits nach einem Monat sahen die Anzüge der Männer und Frauen recht abgetragen aus. Und Pelchersen war es wieder, der eines Abends die drei Damen bat, in Rücksicht auf den bevorstehenden Winter mit dem Anfertigen warmer Kleider zu beginnen, wobei er daran erinnerte, daß man sowohl genügen Felle als auch den Stoff der aus dem Lastauto erbeuteten Mäntel zur Verfügung habe.
Diese Anregung genügte. Eine Ecke des Speiseraumes wurde nun als Schneiderwerkstatt hergerichtet, in der unter Anleitung der auch auf diesem Gebiet gut bewanderten Pastorin die jungen Mädchen jede freie Stunde zum Zuschneiden, Auspassen und Zusammennähen von warmen, praktischen Anzügen benutzten. Nadeln, Schere und Zwirn hatte der vorsorgliche Pelchersen schon damals bei der Flucht aus dem Schulhause mitgenommen. Später, als besonders das Nähgarn auf die Neige ging, unternahmen der Apotheker und Timuleit eigens zum Zweck der Ergänzung dieses Artikels einen dreitägigen Ausflug nach einem weit entfernten Dorf, wo sie spät abends die Hütte eines jüdischen Hausierers aufsuchten und dem Mann das Fehlende abkauften. Bei dieser Gelegenheit beschafften sie auch gleichzeitig eine Menge anderer nützlicher Gegenstände, die der Händler in seinem Kramladen vorrätig hatte. Daß sie bei diesem Einkauf mit größter Vorsicht zu Werke gingen, erforderte schon ihre eigene Sicherheit. So war Karl Timuleit allein bei dem Hausierer eingetreten, während Pelchersen draußen bei den Pferden Wache hielt. Sehr geschickt spielte der Hausdiener den Taubstummen, so daß der Händler nicht ahnen konnte, daß er einen Deutschen vor sich habe. Auch die Bezahlung mit deutschem Goldgeld machte ihn keineswegs stutzig. Gab es doch nach dem Russeneinfall in Ostpreußen in den Grenzgebieten genug deutsche Münzen, die drüben von den Kosakenhorden zusammengestohlen und dann wieder ausgegeben waren. Jedenfalls verlief dieser immerhin recht gewagte Einkauf so günstig, daß die beiden Kolonisten später noch einige Male den Hausierer aufsuchten.
9. Kapitel.
Inzwischen war auch in ostpreußischen Gefilden bei Tannenberg der „russischen Dampfwalze“ durch Hindenburg so gründlich der Weg verlegt worden, daß die Heere des Zaren in wildester Unordnung hinter den Gürtel der Sperrfestungen Grodno und Kowno zurückflüchteten.
Von diesen Ereignissen merkten unsere Ansiedler jedoch zunächst nur sehr wenig, da der geschlagene Feind zumeist andere Wege bei seinem Rückzug benutzte. Gewiß, auch die Straße nach Balki war in den Tagen nach jener entscheidenden russischen Niederlage von Wagen, Munitionskolonnen, Artillerie und einzelnen Trupps Infanterie belebt, und Pelchersen und Timuleit wunderten sich auf ihren Beutezügen mehr wie einmal über diesen regen Verkehr, kamen aber nicht auf die richtige Erklärung, da sie niemals mehr Geschützdonner vernommen hatten und sich deshalb nicht denken konnten, daß der Russe nach einer auf ostpreußischem Gebiet verlorenen Schlacht seinen eiligen Rückzug bis hierher ausdehnen würde.
So kam der 5. September 1914 heran, ein Tag, der die Kolonisten recht unsanft aus ihrer beschaulichen Ruhe aufrütteln sollte.
Nachdem am Morgen einige Regenschauer niedergegangen waren, klärte sich das Wetter wieder auf. Pelchersen und Timuleit wollten daher abermals nach einigen entfernten Kartoffeläckern aufbrechen, um zu ernten, wo sie nicht gesät hatten. Diese Felddiebstähle, zu denen sie durch die harte Not gezwungen worden, wußten sie stets an anderen Orten vorzunehmen, um nicht die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu erregen, die sonst nur zu leicht hätte auf den Verdacht kommen können, daß die weiten Forsten die seiner Zeit von den Kosaken so eifrig gesuchten deutschen Flüchtlinge noch immer beherbergen könnten. Gegen acht Uhr vormittags brachen die beiden Männer auf, setzten mit dem Floß vom Hoffnungseiland nach dem festen Lande über, holten die Pferde aus dem Versteck hervor und ritten, wie immer bewaffnet mit Karabiner und Pistole, nach kurzem Abschied von Spelniks davon. Dieser war als dritter mit auf dem Floß gewesen, um es nachher nach der Insel zurückzurudern.
Als Spelnik sich den Hütten wieder näherte, fand er die übrigen Mitglieder der kleinen Siedlung aufbruchbereit vor. Der Pastor erklärt ihm, man sei dahin übereingekommen, den Vormittag zum Einsammeln von Pilzen und Haselnüssen zu benutzen, um sich davon größere Vorräte für den Winter anzulegen. Spelnik wollte diesen Ausflug ebenfalls gern mitmachen, mußte aber vorher noch nach dem Gefangenen sehen, den man morgens und abends regelmäßig mit Nahrungsmitteln versorgte, eine Arbeit, die Spelnik zumeist übernahm. Assumoff war ein recht bequemer Gefangener. An Flucht schien er getreu seinem gegebenen Wort nicht zu denken. Allerdings wäre es ihm auch schwer gefallen, seine kleine Insel, da er ja des Schwimmens unkundig war, zu verlassen. Er fühlte sich vorläufig offenbar ganz wohl in seiner Lage, verbrachte den Tag zumeist mit Angeln und Schnitzen von allerlei Gerätschaften für seine Blockhütte. Mit großem Geschick hatte er sich Angelzeug angefertigt, und täglich lieferte er für die Küche der Ansiedler eine Menge der in den Moorgewässern sehr zahlreich vorkommenden Karauschen ab, die zum Teil geräuchert worden und eine angenehme Abwechslung in den Speisezettel der Kolonisten brachten.
Als Spelniks sich dem Inselchen Assumoffs in dem Nachen näherte, saß der Leutnant schon wieder am Ufer und lag dem Angelsport ob. Wie immer machte der Bauer, nachdem er den Kahn ein Stück auf das Land gezogen hatte, einen Rundgang durch das Eiland, um sich zu vergewissern, daß der Gefangene nicht etwa Vorkehrungen zur Flucht getroffen habe.
Hierbei mußte Assumoff ihn begleiten. Auch das war feststehende Regel.
Mit den dahinschwindenden Wochen hatten die Deutschen den berechtigten Groll gegen den Leutnant ein wenig vergessen. Nur Erna Hartwig schien unversöhnlich zu sein, wenn sie auch nie hierüber ein Wort äußerte. Nur gelegentlich merkte man, daß sie es für sehr überflüssig hielt, den Russen auf dieselbe Weise zu verpflegen, wie die Kolonisten dies für sich selbst taten.
Spelnik, von Natur gutmütig trotz seines verschlossenen Gesichtes und seines riesigen, kraftstrotzenden Körpers, unterhielt sich denn auch heute wieder mit Assumoff über allerlei, – die Ergebnisse des Angelns, das Wetter, die Scharen der Zugvögel und andere unverfängliche Dinge.
Unmerklich begannen der Kosakenoffizier den biederen Bauern dann darüber auszuhorchen, was die einzelnen Ansiedlern heute gerade trieben. Er fing dies sehr geschickt an. Und in kurzem wußte er, daß Pelchersen und Timuleit vor dem nächsten Morgen nicht zurückerwartet wurden.
In seinen dunklen Augen glomm da ein unheilverkündendes Feuer auf. Schon längst hatte er den Gedanken erwogen, sich des Nachens bei guter Gelegenheit zu bemächtigen und zu fliehen. Schlauerweise wiegte er die Deutschen aber erst in Sicherheit und spielte den in sein Schicksal völlig Ergebenen. Der Erfolg blieb auch nicht aus. Die Wachsamkeit Spelniks ließ immer mehr nach, und darauf hatte Iwan Assumoff es abgesehen.
Jetzt kamen die beiden bei dem Rundgang auch in die Nähe der Blockhütte des Leutnants. Dieser trat plötzlich einen Schritt zurück … Dann ein Sprung wie der eines seine Beute beschleichenden Raubtieres. Um August Spelniks Hals legten sich die harten Hände des Russen, der ihn gleichzeitig durch den Anprall nach vorn über auf den Boden geworfen hatte. Das Ringen war kurz und heftig. Der deutsche Riese schlug wild mit den Armen um sich, suchte den Angreifer abzuschütteln und sich aufzurichten. Es gelang ihm nicht. Die Besinnung begann ihm zu schwinden. Wie ein Schraubstock lagen Assumoffs Finger an seinem Halse. Dann wurde er ohnmächtig. Und dem Bewußtlosen band der Leutnant eiligst Arme und Beine mit bereitgehaltenen Baststricken, schob ihm auch einen Knebel zwischen die Zähne.
Im Nu hatte er ihm dann auch die Pistole, die Spelnik stets bei sich trug, abgenommen, ebenso auch das große Klappmesser und den Taschenkompaß, den der Bauer bei der Verteilung der Beutestücke aus dem Lastauto erhalten hatte.
Hierauf versuchte er, den plumpen Nachen wieder zu Wasser zu bringen. Aber was den Bärenkräften eines Spelnik ein leichtes gewesen war, wollte dem bedeutend schwächeren Assumoff nicht gelingen. Der aus dem schweren Baumstamm gefertigte Kahn rückte und rührte sich nicht. Nur zentimeterweise vermochte der Leutnant ihn endlich durch allerlei Kunstgriffe vorwärts zu bewegen. Jedenfalls verstrich eine geraume Zeit, ehe er den Nachen endlich besteigen konnte.
Inzwischen war Erna Hartwig durch das lange Ausbleiben des Gefährten, der sich doch hatte möglichst beeilen wollen, mißtrauisch geworden. Sie hielt den Gefangenen durchaus nicht für so harmlos, wie dies ihre Freunde taten und nach Ablauf einer halben Stunde etwa griff sie nach ihrem Karabiner, rief den anderen ein kurzes: „Ich muß nachsehen, weshalb Spelnik noch immer nicht zurückkommt!“ zu, sprang auf das Floß und arbeitete sich langsam nach dem Eiland Assumoffs mit Hilfe der Stoßstange vorwärts. Pfarrer Günther hatte das junge Mädchen erst zurückhalten wollen, da ihm diese Sorge sehr überflüssig erschien, schwieg aber, da Erna Hartwig sich in ihren Entschlüssen kaum je beeinflussen ließ.
Nachdem Erna Hartwig in den schmalen zwischen vielen kleineren Inseln hinlaufenden Kanal eingebogen war, der auch Assumoffs Eiland berührte, vermochte sie bereits durch das Buschwerk hin und wieder einen Blick auf die seeartig offene Stelle der Tausend Inseln zu werfen, in deren Mitte des Leutnants winzige Moorinselchen lag.
Da – plötzlich sanken Erna die kräftig die Stoßstange handhabenden Arme vor Schreck herab. Sie hatte soeben gesehen, wie der Nachen von dem Eiland des Gefangenen abstieß. Und in dem Kahn stand aufrecht, mit dem Ruder in der Hand, Leutnant Iwan Assumoff.
Im Augenblick wußte das junge Mädchen Bescheid. Es konnte sich hier nur um einen Fluchtversuch handeln. Das unterlag keinem Zweifel. Der Russe brach sein Ehrenwort. Er wollte frei sein um jeden Preis. Und entkam er wirklich, so waren die Deutschen verloren. Dann würde er schleunigst mit russischem Militär oder mit schnell zusammengetrommelten Einwohnern der nächsten Ortschaften zurückkehren, würde nach dem Hoffnungseiland übersetzen und … das weitere war für die Männer der Tod, und für die drei Frauen schmachvolle Einkerkerung.
Ebenso schnell, wie sie sich die Folgen der Flucht Assumoffs vergegenwärtigt hatte, wurde sie sich auch über die Mittel und Wege klar, das Entweichen des Gefangenen zu verhindern. Sie kannte das endlose Sumpfgebiet der Tausend Inseln jetzt genau genug, um zu wissen, daß es aus dem seeartigen Becken, dessen Mitte das Gefangenen-Eiland bildete, für einen Unkundigen nur einen Ausweg gab, eben den, durch den sie selbst soeben das Floß hindurchtrieb. Alle übrigen offenen Stellen zwischen den zahllosen Inselchen und vertorften, krautigen Flecken liefen derart durcheinander, daß sie ein förmliches Labyrinth darstellten, durch das sich nur ein Eingeweihter hindurchfand. Auf diesen günstigen Umstand baute sie ihren Plan auf. –
Assumoff, der längst herausgefunden hatte, in welcher Richtung die den Deutschen als Schlupfwinkel dienende Insel lag, steuerte den Nachen, ohne das Floß und das junge Mädchen zu bemerken, in entgegengesetzter Richtung über die offene Wasserfläche, da er an der Insel der Ansiedler nicht gern vorüber wollte. Sehr bald verschwand er in dem breitesten der Kanäle zwischen den Inseln.
Aber Erna Hartwig verließ sich fest darauf, daß er die Durchfahrt nach der nächsten seeartigen Stelle des Sumpfes nicht finden werde. Und sie behielt auch recht mit dieser Zuversicht. Eine knappe Viertelstunde später erschien der Kahn bereits wieder zwischen dem Grün der Weidensträucher und wurde nun von Assumoff, der eingesehen hatte, daß er den stets von Spelnik benutzten Wasserweg notwendig einschlagen müsse, gerade auf die Durchfahrt zugetrieben, in der das Mädchen auf dem Floß mit schußfertigem Karabiner saß.
Jetzt bog der Nachen um eine dicht mit Unterholz bestandene Insel in der Durchfahrt herum, jetzt sah Assumoff die Gestalt der Tochter des damals so jämmerlich dahingeschiedenen Deutschen. Der Russe zuckte zusammen. Vielleicht fünfzig Schritt trennten ihn noch von dem Floß. Er wollte umkehren. Der Karabiner in der Hand der Feindin sagte ihm nichts Gutes.
Erna Hartwig war schnell aufgestanden. Und mit vor Aufregung zitternder Stimme rief sie jetzt dem Leutnant zu:
„Legen Sie sofort das Ruder aus der Hand, sofort – oder ich schieße! Glauben Sie nicht, daß ich Sie schonen werde …!“
Sie brachte die Schußwaffe in Anschlag aber inzwischen hatte Assumoff sich von dem ersten Schreck erholt.
Er gehorchte nicht, machte dem jungen Mädchen vielmehr eine höhnische Verbeugung und rief zurück:
„Ich bin nicht daran gewöhnt, von Damen Befehle entgegenzunehmen, meine Gnädige. Und daher …“
Weiter kam eine. Aus der Karabinermündung fuhr ein Feuerstrahl heraus, und eine Kugel pfiff in bedrohlicher Nähe an Assumoffs Kopf vorüber.
„Das war nur ein Warnschuß! Vergessen Sie das nicht! – Weg mit dem Ruder!“
Erna hatte während dieser Worte die Waffe neu geladen. Und mittlerweile war auch der Nachen noch ein Stück weiter gelaufen und nur noch knappe dreißig Schritte entfernt.
Der Leutnant merkte, daß er sein Leben aufs Spiel setzte, wenn er nicht gehorchte. So legte er denn das Ruder aus der Hand und setzte sich auf die mittelste Ruderbank. Aber in seinem Gesicht lauerten die Heimtücke und die Rachgier.
Der Kahn hatte sich jetzt am Ufer eines kleinen Inselchens festgefahren und lag regungslos da.
„Steigen Sie aus!“ rief Erna Hartwig Assumoff zu. „Und dann geben sie dem Nachen einen Stoß, daß er ins offene Wasser treibt.“
Dieser Gedanke, den Leutnant vorläufig auf dem Inselchen auf diese Weise festzuhalten, war jedenfalls die einfachste Art, den Feind schnell wieder unschädlich zu machen.
Assumoff tat so, als ob er auch diesem neuen Befehl nachkommen wolle. Er kletterte aus dem Kahn an Land und bückte sich dann, um ihn abzustoßen. Scheinbar strengte er zu diesem Zweck alle seine Kräfte an. Der Nachen jedoch rührte sich nicht.
„Er muß auf ein Hindernis aufgefahren sein,“ rief der Leutnant Erna nach einer Weile keuchend zu. „Sie sehen, er liegt wie angekettet fest.“
Das junge Mädchen ließ sich wirklich täuschen, legte den Karabiner beiseite, ergriff die Stoßstange und drückte das Floß auf den Nachen zu. Trotzdem war sie aber so vorsichtig, ihr schwerfälliges Fahrzeug ein Stück von der Insel abzuhalten.
Was dann geschah, spielte sich mit einer solchen Geschwindigkeit ab, daß Erna erst zum Bewußtsein des Geschehenen kam, als Assumoff bereits Herr der Lage war.
Der Leutnant hatte dem Kahn einen gewaltigen Stoß versetzt und sich gleichzeitig hineingeschwungen. Der schwere Nachen prallte dann so kräftig gegen das Floß, daß Erna Hartwig das Gleichgewicht verlor und hintenüber taumelte. Da war Assumoff auch schon mit einem Satz neben ihr, entriß ihr den Karabiner und zwangen sie mit rohem Griff in den Kahn hinüberzusteigen, wo er ihr mit seinem Taschentuch die Hände auf dem Rücken zusammenband.
Wenige Minuten später fuhr er in dem Nachen, das Floß im Schlepptau hinterherziehend, an dem Hoffnungseiland vorüber. Dort standen am Ufer mit deutlich erkennbaren, entsetzten Augen das Ehepaar Günther und Grete Spelnik. Assumoff winkte ihnen höhnisch zu. Und zu Erna Hartwig sagte er mit grausamem Spott:
„Sie brauchen nicht fürchten, mein Fräulein, daß Ihre Gefährten, der gefesselte Bauer und die drei dort drüben, allzu lange allein bleiben werden. Ich sorge schon dafür, daß sie baldigst wieder mit Ihnen vereint sind und daß in Balki alles zu Ihrem Empfang vorbereitet wird.“ – –
Und wieder eine halbe Stunde später befand sich der Kosakenoffizieren mit seiner Gefangenen bereits auf dem Marsch durch die Wälder. Er beeilte sich nach Möglichkeit. Hatte er doch vorhin, als er gerade das feste Ufer erreicht und Kahn und Floß aufs Trockene gezogen hatte, von dem Hoffnungseiland her in kurzen Zwischenräumen den harten Knall von fünf Karabinerschüssen gehört, die ohne Frage von dem Pastor als Hilferufe an Pelchersen und Timuleits abgefeuert worden waren. Wenn er nun auch hoffte, daß die beiden jungen Deutschen bereits zu weit entfernt waren, um die Alarmschüsse noch hören zu können, so hielt er es doch ratsam, sich und seine schöne Beute schnellstens in Sicherheit zu bringen.
Aber so sehr er Erna Hartwig auch zur Eile zwang und so sehr er sich auch bemühte, in dem teilweise völlig unwegsamen Walde recht rasch vorwärts zu kommen, seine Unkenntnis der endlosen Forsten zwang ihn immer wieder zu langwierigem Suchen nach einem gangbaren Pfad. Dabei entging es ihm völlig, daß Erna sich alle Mühe gab, eine möglichst sichtbare Fährte zurück zu lassen, indem sie mit den Spitzen und Hacken ihrer Stiefel die Laub- und Nadelschicht des Bodens scheinbar absichtslos aufwühlte.
Zwei Stunden waren sie nun schon schweigend durch die Wälder gewandert. Die Sonne stieg höher und höher. Ein prächtiger Herbsttag war’s. Das Laub der Bäume bereits in allen Farben spielend, glänzte unter den Strahlen des Tagesgestirns wie mit einer feinen Silberschicht belegt. Einzelne Blätter schwebten lautlos aus ihrer luftigen Höhe zur Erde nieder. Sie hatten ihr kurzes Sommerdasein ausgelebt und gesellten sich ihren unzähligen Schwestern zu, die mit ihren kleinen, braun verfärbten Leichen den Waldboden zu düngen bestimmt waren.
Des öfteren hatte Assumoff versucht, mit Erna Hartwig ein Gespräch anzuknüpfen. Sie gab ihm keine Antwort. Stolz und aufrecht schritt sie bald vor, bald hinter ihm her. Und ständig drehte sie ihre Handgelenke mit zäher Kraft in der Fessel des guten verknüpften Tuches hin und her, das sich immer mehr lockerte, freilich viel zu langsam für des Mädchens angstvolle Ungeduld. –
Wenn Sie nur erst die Hände frei hätte …! –
Dieser Gedanke beschäftigte sie unausgesetzt. Und weiter drückte und zerrte sie um dem weichen und doch so zähen Stoff herum.
Dann machte Assumoff auf einer kleinen Waldwiese halt und befahl Erna, sich im Schatten der Randgebüsche niederzusetzen. Der eilige Marsch hatte gerade ihn, der an Gehen so wenig gewöhnt war, ganz außer Atem gebracht. Er fluchte leise vor sich hin, als er sich jetzt einige Schritte seitwärts von seiner Gefangenen ins Gras warf. Der Durst peinigte ihn, ebenso der Hunger. Bald erhob er sich wieder und pflückte von den nahen Sträuchern Haselnüsse, die er dann mit den Zähnen aufknackte.
Erna Hartwigs Hände waren durch das ständige Zerren an dem Tuch und die Behinderung der Blutzirkulation etwas angeschwollen. Ein dichtes, hohes Moospolster im Rücken des jungen Mädchens war genügend feucht und kühl, um die leichte Schwellung zu beseitigen. Ganz tief hatte Erna die Hände darin vergraben. –
Jetzt mußte sie frei werden – gerade jetzt! Der Karabiner lag neben Assumoff im Grase, keine drei Schritte entfernt. Einen Sprung würde sie in den Besitz der Waffe bringen. Und dann – dann …?! Würde sie es wirklich über sich bringen, auf den Feind zu feuern …?! Würde sie, die vorhin auf dem Wasser Assumoff so keck einzuschüchtern gesucht hatte, tatsächlich den Mut finden und abdrücken, wenn ein Mensch vor dem Lauf ihrer Schußwaffe als Ziel stand …?! – – Es mußte sein! Immer aufs neue wiederholte sie sich dieses „Es muß sein!“ Und schließlich glaubte sie selbst daran, daß sie Assumoff kaltblütig niederschießen könnte, falls er ihren Befehlen nicht sofort nachkam oder zu entweichen trachtete.
Da – jetzt glitt das Tuch mit seiner Doppelschlinge wirklich über den Handrücken ihrer Rechten weg. Es war geglückt … Und ihr Herz begann plötzlich schneller und schneller zu klopfen. Die Entscheidung nahte.
Ein kurzer Blick nach Assumoff hin. Der gähnte eben herzhaft. – – Mut, Erna, Mut …! Es wird gelingen! Jede Sekunde ist kostbar … Jede Sekunde kann der Feind sich erheben, um den Marsch fortzusetzen …
Da – sie schnellte durch ein Geräusch aufmerksam gemacht, mit dem Oberkörper herum – sah einen Mann mit langem Satz sich auf Assumoff stürzen, sah einen zweiten, der schon den Karabiner, auf den sie es selbst abgesehen gehabt hatte, ergriff …
In dem Grase rollten zwei menschliche Körper hin und her. Der Leutnant wollte den Angreifer von sich abschütteln, strengte alle seine Kräfte an. Aber Karl Timuleits Hand lag ihm nur zu fest an der Kehle.
Und Pelchersen stand dabei und wartete auf eine günstige Gelegenheit, um den Kolben des Karabiners dem Gegner Timuleits auf den Kopf zu schmettern.
Dann bekam Timuleit den Leutnant unter sich, kniete ihm auf dem Rücken. Ein Strick flog aus Pelchersens Hand dem Gefährten zu. Und im Augenblick war Assumoff wehrlos gemacht.
Mit weiten Augen hatte Erna die Szene verfolgt. Jetzt, wo sie gerettet war, ließ die furchtbare Spannung ihrer Nerven plötzlich nach. Ein Schluchzen stieg ihr in der Kehle hoch. Und ohne rechte zu wissen, was sie tat, nur getrieben von dem Wunsch, sich an der Brust des Mannes, den sie in diesen schweren Wochen achten und lieben gelernt hatte, ausweinen zu können, sprang sie auf und flog mit einem jubelnden, halberstickten Ruf, mit einem ihre Gefühle nur zu deutlich enthüllenden, zärtlichen „Erwin – Erwin …!“ in die Arme des jungen Apothekers.
Der umschlang sie fest, preßte sie an sich. Vergessen war die Nähe Timuleits und des gefährlichen Feindes, vergessen die seltsamen Umstände dieses schnellen Sichfindens. Der Wald rauschte so geheimnisvoll um sie her, jedes Blatt raunte dem anderen ein neues, zartes Geheimnis zu …
Wie im Märchen war das alles und märchenhaft war die Seligkeit, die Erna Hartwig empfand, als der Geliebte ihr zuflüsterte:
„So liebst du mich also wirklich, mich – den Krüppel?! – Oh – du ahnst ja nicht, was ich um dich gelitten habe! Ich merkte, daß du mir freundlicher, herzlicher gegenüber tratest in letzter Zeit. Ich glaubte, es sei Dankbarkeit, und die wollte ich nicht von dir – nein – das nicht! Mehr wollte ich. Liebe – heiße Liebe – – so, wie ich dich geliebt habe seit der Stunde, als ich dich zur ersten Male sah …“
Ganz scheu hob sie da den Kopf und schaute ihm tief in die Augen. Ihr Blick war verdunkelt vor Tränen. Und doch sah Erwin Pelchersen darin alles, was er wünschte, was er gehofft hatte … Fester drückte er sie an sich, und so fanden sich ihre Lippen zu einem langen, innigen Verlobungskuß … – –
10. Kapitel.
Karl Timuleits hatte inzwischen dem Leutnant die Hände noch fester zusammen geschnürt und ihn dann zu sitzender Stellung aufgerichtet.
In ohnmächtiger Wut begann Assumoff den jungen Deutschen jetzt mit den gemeintes Schmähungen zu überhäufen. Dann fiel sein Blick auf das junge Paar, das völlig weltentrückt sich den ersten scheuen Zärtlichkeiten hingab.
Da stieß er eine gelle Lache aus.
„Gratuliere, meine Herrschaften, – gratuliere! Hoffentlich feiern Sie Ihren Hochzeitstag gemeinsam am Galgen. Ihr Schuldkonto ist ja mittlerweile derart angewachsen, daß ein Todesurteil vor dem Feldgericht in Balki mit Sicherheit zu erwarten ist.“
Das höhnische Gelächter des Russen hatte Erna aus den Armen des Geliebten gescheucht. Tief errötend trat sie einen Schritt zurück
Pelchersen aber wurde bleich vor Zorn.
„Ehrloser, wortbrüchiger Wicht!“ donnerte er den Leutnant an. „Sie hätten alle Ursache, sich nicht in lächerlichen Drohungen zu ergehen. Jeden Anspruch auf Rücksichtnahme auf ihre Stellung als Offizier haben Sie verwirkt. Wir werden nicht weiter so töricht sein, Sie als Ehrenmann zu behandeln. Davon können Sie überzeugt sein …!“
Assumoff wollte etwas erwidern. Aber Pelchersen blickte ihn so durchbohrend an, daß er es vorzog zu schweigen.
Dann wurde der Heimweg nach den Tausend Inseln angetreten. Timuleit schritt voran. Hinter ihm mußte sich Assumoff halten, während Pelchersen und Erna den Schluß des kleinen Zuges bildeten.
Das junge Mädchen erfuhr jetzt auch, wie es gekommen war, daß die beiden Gefährten sie noch rechtzeitig aus den Händen des Leutnants befreit hatten. Die Alarmschüsse waren es gewesen, die den Apotheker und seinen treuen Hausdiener auf irgend eine außergewöhnliche Gefahr aufmerksam gemacht hatten.
Diese Auskunft überraschte Erna außerordentlich. Waren doch Pelchersen und Timuleits bereits mindestens zwei Stunden unterwegs, als Pastor Günther die Schüsse als verzweifelten Hilferuf abgefeuert hatte. Daher glaubte Erna ja auch, sich von diesem Notsignal wenig Erfolg versprechen zu dürften. –
Als sie dies ihrem Verlobten gegenüber aussprach, entgegnete der etwas zögernd:
„Es war kein Zufall, daß wir uns noch in der Nähe befanden. Denke dir, Liebling, – man hat uns die Pferde aus dem Versteck entführt. Du kannst dir vorstellen, wie bestürzt wir bei dieser Entdeckung waren, zumal in mir sofort die Befürchtung aufstieg, die Pferdediebe könnten nun auch versuchen, uns auf unserem Eiland aufzustöbern. Deshalb haben wir beide auch die vorhandenen Spuren aufs sorgfältigste untersucht um festzustellen, ob es Soldaten oder Bewohner aus der Umgegend waren, die unsere Reittiere mitnahmen. Dies hielt uns sehr lange auf. Kaum vernahmen wir dann die Schüsse, als wir eiligst nach unserem Schlupfwinkel zurückkehrten, wo der Pfarrer uns mit der Schreckenskunde empfing, daß Assumoff entflohen sei und dich mit fortgeschleppt habe. Nun – zum Glück hattest du ja für eine so deutliche Fährte gesorgt, daß eure Verfolgung uns keine Schwierigkeiten bereitete.“ –
Nach kurzer Pause fügte Pelchersen dann noch hinzu: „So glücklich ich nun auch über den Ausgang dieser Jagd bin, so beunruhigt mich doch andererseits der Gedanke nur zu sehr, daß Fremde in die Nähe unseres Schlupfwinkel gelangt sind und uns die Pferde gestohlen haben. Wer diese Fremden waren, haben wir mit Sicherheit nicht herausbringen können. Jedenfalls handelt es sich um Reiter, und zwar um fünf Mann im ganzen. Es ist mithin keineswegs ausgeschlossen, daß es Kosaken waren, die …“
Er kann nicht weiter.
Vorn hatte Timuleit plötzlich einen lauten Warnungsruf ausgestoßen. Man war gerade mitten auf einer Waldwiese, auf der nur vereinzelte Gruppen von Buchen standen. Und eben hatte Timuleit einen dieser kleinen Buchenhaine verlassen, als er keine hundert Meter vor sich im Schatten des Waldrandes einen Trupp Kosaken bemerkte, der sich dort neben den kleinen, struppigen Gäulen gelagert hatte.
Auch die Kosaken hatten ihn gesehen, ebenso den Leutnant, der mit gebundenen Armen hinter dem jungen Deutschen herschritt.
Einen Augenblick nur hatte der Schreck Karl Timuleit förmlich gelähmt. Dann schrie er laut dem ahnungslosen Paare zu:
„Vorsicht – Feinde!“ Und wollte gleichzeitig den Gefangenen in den Schutz der alten, starken Buchen zurückreißen.
Aber Assumoff wollte sich diese Gelegenheit zur Flucht nicht entgehen lassen. Mit großer Geistesgegenwart machte er einen Satz nach vorwärts und rannte dann geradeaus auf die Kosaken zu, die inzwischen die Sachlage richtig durchschaut hatten und jetzt das Entweichen des Leutnants durch lebhaftes Karabinerfeuer zu erleichtern suchten.
Pelchersen wieder hatte kaum gesehen, worum es sich handelte, als er Erna auch schon zu Boden zerrte und sich auch selbst lang auf sie hinwarf. Da pfiffen auch schon die ersten Kugeln über sie hinweg. Und gleich darauf Timuleits Stimme, die ganz ruhig klang:
„Es sind die fünf Kerle, die unsere Pferde mitgenommen haben, Herr Pelchersen. Mit denen werden wir schon fertig werden!“
Und waghalsig richtete er sich jetzt hinter dem Stamm der Buche auf, hob sein Gewehr, zielte sorgfältig und feuerte.
Von drüben fast gleichzeitig drei Schüsse. Timuleit taumelte zurück, ließ den Karabiner fallen, sank lang in die Farnkräuter hin. Seine Kugel, die Assumoff gegolten hatte, war fehl gegangen. Dafür hatte ein Geschoß ihm selbst den rechten Ellbogen durchbohrt.
Pelchersen kroch vorsichtig auf den Verwundeten zu, während Erna mit dem dem Leutnant wieder abgenommenen Karabiner nun die drüben im Walde steckenden Feinde unter Feuer zu nehmen begannen, indem sie zwischen zwei dicht beieinander stehenden Buchen Deckung suchte.
Assumoff hatte inzwischen glücklich den Rand der Waldwiese erreicht und war in Sicherheit. Die Lage der drei Deutschen erschien nach dem Ausscheiden des wackeren Timuleits als Mitkämpfer recht verzweifelt. Der Feind war jetzt dreimal so stark, und falls er auch vom rückwärts angriff, konnte der Ausgang des Feuergefechtes kaum zweifelhaft sein.
„Lassen Sie mich ruhig liegen, Herr Pelchersen,“ preßte Timuleit zwischen den Zähnen hervor, als der junge Apotheker sich über ihn beugte. „Suchen Sie mit Fräulein Hartwig zu entfliehen. Im Wald finden Sie schon irgendwo ein Versteck. – Zögern Sie nicht …! Jede Sekunde ist kostbar! Kriechen Sie immer an Stellen entlang, wo die Farnkräuter recht dicht stehen …“ –
Doch es kam anders. Von drüben her wildes Geschrei – ganz plötzlich, – Schüsse, lautes Hurra, unverkennbar aus deutschen Kehlen kommend. Und wenige Minuten später tauchten auch schon deutsche Dragoner, die zu der Armee gehörten, die die bei Tannenberg aufs Haupt geschlagenen Russen verfolgte, auf der Lichtung auf.
Erna Hartwig bemerkte sie zuerst. Und aus übervollem Herzen jubelte sie jetzt heraus:
„Erwin – Erwin, die Rettung ist da! Landsleute, die Unsrigen sind’s …!“
Ein blutjunger Leutnant jagte als vorderster auf den Buchenhain zu. Erna trat unter den Bäumen vor, den Karabiner noch in der Hand und wieder rief sie jetzt, und in ihrer Stimme lags wieder wie unaussprechlicher Jubel:
„Das war Hilfe zur rechten Zeit, Herr Leutnant!“
Der zügelte sein Pferd, grüßte höflich mit froh aufleuchtenden Augen und fragte kurz:
„Verschleppte Ostpreußen, meine Gnädige, – nicht wahr?“
Da kam auch schon Pelchersen herbei. Fragen und Antworten flogen hin und her. Die Namen Krapschaken, Tannenberg, Hindenburg wurden genannt. Und der schlanke Lieutenant mit dem braunen Gesicht erzählte, daß die Vorhut die Wälder nach versprengten Russen habe absuchen sollen und daß der Kosakenoffizier und die fünf Feinde da drüben am Waldrande mit ihrem Leben für die Schreckenszeit Ostpreußens hätten büßen müssen.
„Meine Leute sind nicht zu halten, wenn sie diese Mordbrenner vor sich sehen,“ sagte er mit verbissener Wut. –
Dann wurde für Timuleit schnell eine Tragbare aus Zweigen hergestellt, und eine Viertelstunde später schon führte Pelchersen die Retter und Landsleute durch den herbstlichen Wald den Tausend Inseln zu, wo die übrigen Leidensgefährten sicher in banger Sorge auf die Rückkehr der drei Freunde warteten.
* * *
In einem Königsberger Lazarett hat Grete Spelnik den wackeren Timuleits schnell gesund gepflegt. Freilich, dessen rechter Arm blieb steif – zur größten Trauer des braven jungen Menschen, der seinem Vaterlande nun nicht mehr mit der Waffe dienen konnte.
Aber auch so hat er sich als Schwiegersohn des reichen Spelnik noch reichlich um den Wiederaufbau des halbzerstörten Krapschaken verdient gemacht. Und treue Freundschaft verbindet dieses junge Paar mit den Bewohnern der unversehrt gebliebenen Storchnest-Apotheke, in der jetzt Erna Hartwig als Hausfrau eifrig schaltet und waltet.
