Hauptmenü
Sie sind hier
Ein Spiel ums Leben
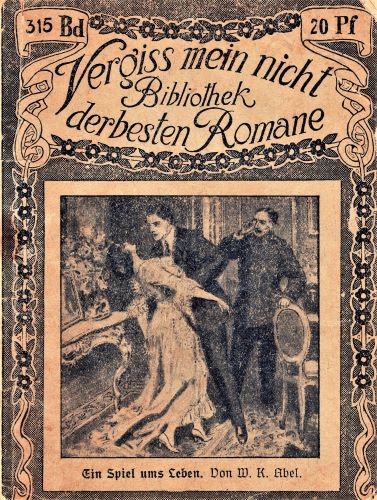
Vergiß mein nicht
Bibliothek der besten Romane
Band 315
Ein Spiel ums Leben.
Roman von
W. K. Abel.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.
Dresdenerstraße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.
1. Teil.
Das Haus der Rätsel.
1. Kapitel.
Mein „Roman“.
Vor drei Tagen wurde ich verhaftet. Abends um neun Uhr. Besser: gegen neun, denn die Uhren sind jetzt im Kriege merkwürdig unzuverlässig trotz europäischer Normalzeit, – genau wie die Menschen. – Wem soll man noch trauen? Am besten niemandem …! Ich glaube, damit kommt man am weitesten, – aber nicht ins Gefängnis, … wie ich!
Fast drei Tage habe ich gebraucht, ehe ich meine gesunden fünf Sinne nach dieser Katastrophe wieder beisammen hatte. Vor ein paar Stunden merkte ich, daß sich meine Gedanken klärten. Bis dahin glichen sie einem wirren Knäuel Garn, in dem man wohl das Fadenende glücklich erwischt hat, ohne es jedoch weiterverfolgen zu können in der Unmasse von Schlingen, Knoten und Verhedderungen.
Und als ich diese Besserung gemerkt hatte, da lief ich zur Zellentür und riß an dem Klingelzug mit aller Kraft.
Die zwei Beamten kamen herbeigestürzt.
„Was gibt’s? Wollen Sie ein Geständnis ablegen?“ fragte der eine voller Hoffnung.
Ich lachte bitter auf. – Richtig: Geständnis ablegen!! – Das hatte mir ja der Mann, der die Untersuchung gegen mich führte, in diesen drei Tagen bei dem Dutzend von qualvollen Verhören regelmäßig „wohlwollend“ geraten und strenger hinzugefügt: „Bedenken Sie – es geht um das Leben!“ Ja, qualvoll waren diese Vernehmungen gewesen, mehr noch als das! Eine Höllenpein! – Ich wußte ja nichts auszusagen, wußte keine Antwort auf all die Fragen, war wie stumpfsinnig, fühlte nur, daß man mein Schweigen für raffinierte Klugheit hielt, daß ich meine Lage durch meine Geistesverfassung und die daraus entspringende Verworrenheit meiner wenigen Angaben verschlimmerte. – –
Und nun kam mir der Beamte mit derselben Frage: Wollen Sie ein Geständnis ablegen? –!!
Welche Wichtigkeit mußte man also wohl dem, was ich angeblich wissen sollte, beilegen, daß man so darauf lauerte, mich endlich zum Reden zu bringen!!
Meine armselige Person war mit einem Male der Mittelpunkt des Wunschkreises einer Anzahl von Dienern des Staates geworden, die sich bis dahin den Teufel was um den Privatlehrer Doktor Alexander Werra gekümmert hatten; ich wurde beinahe mit liebevoller Fürsorge wie ein seltenes Wertstück behandelt, – ja, anders kann ich die Art und Weise meiner Unterbringung mit allem Drum und Dran nicht nennen.
Kerker – Gefängnis …! Die Bezeichnungen passen eigentlich nicht recht für den Raum, in den ich als Untersuchungsgefangener gebracht wurde, nachdem drei Leute mich in der stillen Villenvorstadt blitzschnell überwältigt und in ein Auto geworfen hatten, wo mir sofort eine Decke über das Gesicht gebreitet ward, die erst verschwand, als ich mich hier in diesem Zimmer befand.
Meine Zelle ist nämlich ein Zimmer, zwar klein, aber ganz behaglich eingerichtet. Vor dem einzigen Fenster sind von innen dicke, eiserne Laden befestigt, die stets geschlossen bleiben. Kein Lichtstrahl dringt durch die geringste Spalt zu mir herein. Tag und Nacht sind hier gleich. Am Tage brenne ich eine Petroleumlampe. Nachts lösche ich sie aus. Das ist der Unterschied.
Die Tür ist auch aus Eisen. Und dahinter gibt es noch eine zweite aus Holz. So höre ich nichts, was in dem Raum vor meiner Zelle geschieht, nichts, keinen Schritt – kein Sprechen – kein Hüsteln – nichts – nichts. In den Türen aber, die die eine nach außen, die andere nach innen schlagen und nur millimeterweiten Zwischenraum haben, ist oben ein Guckloch angebracht. Ich weiß, daß ich durch dieses ständig beobachtet werde – ständig, auch nachts. Das Gefühl, daß dort hinter Eisen und Holz stets ein Blick meine Bewegungen überwacht, macht mich nervös, krank. Vielleicht gewöhne ich mich allmählich daran.
Wo ich mich befinde, ich meine in welchem Gebäude der Stadt, davon habe ich keine Ahnung. Die Fahrt in dem geschlossenen Auto nach meiner seltsamen Verhaftung dauerte meiner Schätzung nach kaum fünf Minuten. Also kann es weder das Militär- noch das Gerichtsgefängnis sein. Beide liegen, von der Villenkolonie aus gerechnet, am anderen Ende des Ortes. Bis dahin hätte selbst ein sehr schnell dahinrasender Kraftwagen eine halbe Stunde gebraucht.
Meine beiden Wächter tragen keine Uniform. Es sind scheint’s sogar mittlere Beamte, würdige, ältere Herren, wie zusammengeleimt aus Aktenstaub, Tinte und Papier. Mir gegenüber spielen sie die Taubstummen, falls ich Fragen oder Wünsche äußere. Ein Nicken, ein Kopfschütteln waren bisher die einzigen Äußerungen, die sie mir spendeten. Nur vorhin, als ich fast den Klingelzug – elektrische Einrichtungen gibt es nicht – abriß, vergaßen sie die ihnen zweifellos erteilten strengen Befehle und bewiesen, daß sie sprechen konnten, – – weil sie hofften, ich würde … gestehen …!!
Wenn ich nur wüßte, was … was …?! – –
Das Essen ist hier vorzüglich. Auch sonst fehlt es mir an nichts. Ich bin leidenschaftlicher Raucher. Dort vor mir steht eine Kiste guter Zigarren und eine große Blechschachtel Zigaretten. – –
Wie enttäuscht waren meine beiden Aufseher, als ich erklärte, ich bäte um ein paar Lagen guten Schreibpapiers, eine Kugelspitzfeder, an die ich gewöhnt sei, und Tinte. Ich müßte mich irgendwie beschäftigen. Sonst würde ich verrückt werden. Einen Roman wolle ich schreiben. Das würde mich ablenken, meinen Geist wieder in normale Verfassung bringen.
„Einen Roman?!“ sagte der eine der würdigen Männer gedehnt.
Diesmal nickte ich – sehr energisch! – Sonst nickten sie …!
Dann gingen sie mit langen Gesichtern wieder hinaus.
Eine Stunde später hatte ich, was ich haben wollte, setzte mich an den viereckigen Tisch vor dem alten Ledersofa, schob die Tischdecke zurück, stellte die Lampe links neben mich und … tauchte die Feder ein.
Aber ich habe noch ein halbes Dutzend Zigaretten verraucht, bevor ich die große Erleuchtung hatte, bevor ich mit fester Hand als Titel die Worte mit Zierschnörkeln malte: Ein Spiel ums Leben.
Hat man den Federhalter in der Hand und vor sich einen reinen Bogen Papier, darf man dann noch dem sich kräuselnden Rauchschwaden der zwischen den Fingern der Linken glimmenden Zigarette nachschauen, wie der nach oben zu immer schwächer, undeutlicher wird, so kommen einem meist gute Gedanken, – wenigstens Menschen von meiner etwas träumerischen Veranlagung.
Mein guter Gedanke war der, daß ich dem Herrn, der die Untersuchung in meiner Sache leitete, mündlich nichts – gar nichts mitteilen, sondern alles nur in Form einer Erzählung zu Papier bringen wollte. – Dies hatte meiner Ansicht nach verschiedene Vorteile. Beim Nachdenken über die Ereignisse, die ich schriftlich schildern wollte, mußten mir notwendig weit mehr Einzelheiten einfallen, als wenn ich mündlich darüber Bericht erstattete oder auf Fragen Antwort gab. Außerdem hoffte ich auch, auf diese Weise leichter völlige Klarheit darüber zu gewinnen, was mich eigentlich in diese traurige Lage gebracht haben kann. Schließlich werde ich – vielleicht! – meine Häscher davon überzeugen (sie sollen diesen „Roman“ ruhig lesen!), daß ich tatsächlich ein ganz harmloser Sterblicher bin, der zwar merkwürdige Dinge erlebt hat, für die er keine rechte Erklärung findet, aber an diesem ganzen Erleben schuldlos ist. – –
Ich höre die äußere Tür aufschließen. – Richtig. Es ist vier Uhr nachmittags, also die Stunde, wo ich frisches Gebäck und ein Kännchen Kaffee erhalte.
Ich habe mich nicht geirrt: der Nachmittagskaffee – und als unwillkommene Zugabe der Untersuchungsrichter – falls es ein Richter ist …!
2. Kapitel.
Ich führe meine Mitbewohner vor.
Eine Stunde später.
Ich bin wieder allein. Mein Peiniger ist genau so enttäuscht abgezogen wie vorher die beiden Aufseher. Er hat meinen Romananfang gelesen, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, er würde mir einen Spezialarzt für Nervenleiden schicken.
Er hält mich für leicht verrückt.
Und doch quälte er diesen armen Halbirren mit einigen hundert Fragen, auf die dieser abwechselnd durch Kopfschütteln und ein „Nein – kann mich nicht darauf besinnen“ antwortete.
Der Peiniger ist ein gut gekleideter Herr von Mittelgröße. Mager, sehr gemessen und sehr schlau offenbar, läßt er sein glattrasiertes Gesicht stets in Güte und Wohlwollen leicht erstrahlen. Aber die Augen hinter den Gläsern der goldenen Brille bohren und tasten an meiner Seele herum.
Falls er mit einem freundlichen „Guten Abend“ sich verabschiedete, fügte er noch hinzu:
„Wirklich, Sie täten besser, Herr Doktor, das Spiel aufzugeben, bei dem Ihr Leben der Einsatz ist. Wir werden Sie klein kriegen, wie man zu sagen pflegt. Verlassen Sie sich darauf!“
Ich habe heute mit wachem Geist sehr genau alle seine an mich gerichteten Fragen kritisch geprüft. Aber ich bin auch dadurch nicht klüger geworden.
Weswegen hat man mich verhaftet …?! – Ich weiß es auch jetzt noch nicht. – –
Ich beginnen wieder zu schreiben. Es macht mir Vergnügen. – Ein Roman …?! Hm – bis jetzt sieht der Inhalt der ersten Blätter verdammt wenig danach aus. – –
* * *
Es gibt Romane, die in einem Phantasielande, wenn auch in Europa, spielen. Wozu soll ich’s nicht ebenso machen und alles vermeiden, was verräte, wo meine Geschichte beginnt, zumal ich mir dadurch überflüssige Schilderungen von Örtlichkeiten usw. sparen kann. Ich sage absichtlich: beginnt! Ihr Ausgang ist ja noch gar nicht abzusehen. Sie endet vielleicht … am Galgen …! –
Alexander Werra heiße ich, bin dreißig Jahre alt, habe neuere Sprachen studierte, es bis zum Doktor der Philosophie ohne Staatsexamen gebracht und mich als armer Teufel schlecht und recht durch Privatstunden ernährt, die ich minderbegabten Schülern billig, aber gründlich und gewissenhaft erteilte.
Der Krieg machte mich noch ärmer. Die Kreise, aus denen mein Dressurmaterial stammte, bekamen es mit der Sparsamkeit. In den Schulen wurde ja auch weniger verlangt. Mithin konnte man das Geld für Nachhilfe besser verwenden. So sanken denn meine Einnahmen bis auf die Hälfte der früheren langsam herab. Ich hatte Mühe, die Miete für meine zwei Zimmer zu bezahlen, die ich mir mit dem Hausrat meiner verstorbenen Eltern ausmöbliert hatte.
Alles wurde teurer. Wollte ich nicht noch schlechter essen, so mußte ich die beiden Zimmer, – eine kleine Küche gehörte auch dazu – aufgeben und mich mit einem Raume begnügen.
Ich ging auf Wohnungsjagd, fand schließlich auch in einem vierstöckigen, großen Hause an der Grenze der Stadt, wo die Villenkolonie begann, eine Mansardenstube mit zwei schrägen Fenstern und schöner Aussicht über den gegenüberliegenden Friedhof hin nach den fernen, bewaldeten Hügeln, vor denen sich der See wie ein glitzernder Strich hinzieht.
Am 1. April zog ich ein. Der Hauswart, ein plump vertraulicher Mensch mit vier üblen Früchtchen von heranwachsenden Söhnen, fragte mich gleich am ersten Tage aus, weswegen ich denn nicht zum Militär eingezogen wäre. Ich sei doch ganz kräftig und gut gebaut.
Von Netzhautablösung und ihrer Gefährlichkeit hatte er keine Ahnung. Eine solche krankhafte Veränderung des Auges war ihm gänzlich unbekannt. Ich hatte denn auch das Gefühl, daß er mich für einen Drückeberger hielt. Das war mir nicht ganz gleichgültig. Verbreitete er diese seine Ansicht über mich im Hause und in der Nachbarschaft, so würde man mich mit einer gewissen Verachtung strafen. Die Hoffnung auf neue Schüler in dieser Gegend wurde dadurch zweifellos geringer.
Das Haus hatte acht Wohnungen zu je vier Zimmern und zwei Mansardenstuben. In diesen letzteren hatte ich rechter Hand der Treppe, linker Hand aber ein Lohndiener, der nebenbei auch Fremdenführer, Kinoschauspieler in Bedientenrollen und noch manches andere war, Unterkommen gefunden. Im vierten Stock waren die beiden Wohnungen zu einer einzigen vereinigt worden. Diese acht Zimmer hatte ein Oberst a.D. seit zwei Jahren inne, der jetzt im Kriege wieder im Stabsgebäude der Stadt an leitender Stelle beschäftigt war. Ich will den Oberst Maklakow nennen. Das klingt bulgarisch. Mein Roman kann ja auch in Bulgarien spielen.
Mit mir zusammen zogen auch rechts in der dritten und zweiten Etage neue Parteien ein. Die Leute kamen von auswärts, und zwar hatte der gelähmte Herr Rentier Steiner mit seiner Tochter die freistehenden vier Zimmer des zweiten Stocks gemietet, während der frühere Gutsbesitzer von Blaschy, ein Junggeselle von künstlich herausgeputzter Jugendlichkeit, sich für den dritten entschied.
Steiner und Blaschy sind erfundene Namen, genau so wie Land und Stadt dieses meines Erstlingsromans.
Nach vierzehn Tagen bereits hatte ich dank der Geschwätzigkeit des Hauswarts über die Bewohner des Hauses weit mehr erfahren, als ich wollte.
In Betracht kommen hier nur der Oberst Maklakow, Steiners und Blaschy. Von ersterem habe ich bereits einiges erwähnt. Er war wohlhabend, hatte einen Sohn als Offizier an der Front, eine Tochter daheim und eine Frau, die sehr putzsüchtig war und einst Konzertsängerin gewesen sein sollte. Diese Dame fiel mir sehr bald durch ihren Toilettenluxus und ihr Parfüm auf, das man im Treppenflur noch roch, wenn sie ihn auch bereits vor fünf Minuten passiert hatte. –
Rentier Steiner war ein blasser, alter Herr mit grauem Patriarchenbart. Er wurde häufig von seiner Tochter im Rollstuhl spazieren gefahren. –
Herr von Blaschy ist gut mit „alternder Geck“ gekennzeichnet, sollte sein Gut durch Leichtsinn unter den Hammer gebracht haben und betätigte sich sehr bald nach seinem Einzug bei allerlei Wohlfahrtsvereinen in offenbar sehr selbstloser Weise, so daß man ihm den gefärbten Schnurrbart, das leicht gepuderte Gesicht und die sicher eine Billardkugel von Schädel verhüllende dunkelblonde Perücke gern verzieh.
Die beiden jungen Mädchen, Gisela Maklakow und Helene Steiner, habe ich mit Vorbedacht nicht näher geschildert. Sie kommen nachher ganz von selbst an die Reihe, nachdem ich noch den zweiten Mansardenbewohner, meinen Nachbarn jenseits der Treppe, erwähnt habe.
Der Lohndiener mit den zahlreichen Nebenberufen hauste auch erst ganz kurze Zeit in seiner hochgelegenen Stube. Nennen wir ihn Panszinski. Es war ein hagerer Mensch schwer bestimmbaren Alters. Er sah ganz wie ein Lakai oder Schauspieler für kleine Rollen aus. Um seinen Mund lag stets ein zuvorkommendes Lächeln. Wir lernten uns bald persönlich kennen – schon am dritten Tage, nachdem ich die Mansarde bezogen hatte. Er kam zu mir herüber, klopfte an und fragte, ob ich Hammer und Kneifzange besäße.
Diese Anknüpfung erschien mir etwas gemacht. Das Handwerkszeug sollte wohl nur seine Neugier bemänteln, seinen Nachbar aus nächster Nähe zu sehen und auch zu sprechen.
Panszinski machte auf mich sofort den Eindruck eines Menschen, der sich Mühe gibt, ungebildeter zu erscheinen als er es in Wirklichkeit ist. Er suchte die Ausdrucksweise einfacherer Volkskreise nachzuahmen, wurde in diesem Bestreben aber fast roh und gemein in seiner Rede, ohne verhindern zu können, daß er doch zuweilen Wendungen gebrauchte, die keinem Manne aus dem Volke geläufig waren.
Ich wurde nicht recht klug aus ihm, und er war mir recht unsympathisch. Er erzählte mir unaufgefordert, daß er erst drei Monate in der Stadt ansässig sei, aber schon infolge guter Zeugnisse bei dem jetzigen Mangel an Männern reichlich Beschäftigung habe.
Er blieb eine halbe Stunde, obwohl ich weder Hammer noch Kneifzange besaß und recht zurückhaltend zu ihm war. Er hinterließ bei mir den Eindruck, daß er mich habe aushorchen wollen. Vielleicht sah er in mir einen Drückeberger, den er zu denunzieren gedachte. Solche Anzeigen an die Militärbehörden waren ja auch ein Zeichen der Zeit. Kurz – ich wußte nicht, was ich aus ihm machen sollte.
Vier Tage nach seinem ersten Besuch kam er wieder zu mir. Dieses Mal abends. Er brachte mir kalten Braten und andere Eßwaren mit, erklärte, er könne mir die Sachen zu ganz geringem Preise als Gelegenheitskauf abgeben, und drängte sich mir förmlich auf, als ich dankend ablehnte. –
Ich gebe zu, daß mir seine Fürsorge wohltat. Ich hatte seit Tagen nur von trockenem Brot und dünnem Kaffee gelebt, da ich mir das Geld zu einem neuen Anzug zusammensparen mußte. Einen Stundenlehrer mit dürftiger Kleidung beschäftigt niemand gern.
Panszinski verabschiedete sich sehr bald wieder. Der Widerspruch in seiner Ausdrucksweise und in seinem Benehmen war derselbe geblieben. Er mußte fraglos eine bessere Schulbildung genossen haben. – Wozu verbarg er das vor mir …?! – –
Am 17. April machte ich dann die Bekanntschaft Helene Steiners auf folgende Weise.
Nach der Villenkolonie zu gab es in unserer Straße einen öffentlichen Park, der in seinem rückwärtigen Teile an einen Exerzierplatz grenzte. In dem Park war es jetzt im Frühling wunderschön. Ich habe von jeher die Natur geliebt. Und viele Stunden meiner leider nur zu ausgedehnten freien Zeit brachte ich dort unter den alten Bäumen auf einer Bank zu, einer ganz bestimmten, meinem Lieblingsplätzchen. Eines Vormittags fand ich sie besetzt. Helene Steiner saß dort und hatte den Rollstuhl ihres gelähmten Vaters dicht neben sich geschoben. Ich wollte kehrtmachen, um die beiden nicht zu stören, als der alte Steiner mich anrief und mit schwerer Zunge sagte, er wisse, daß dies mein Stammplatz sozusagen wäre. Er würde ihn daher sofort räumen.
So kamen wir ins Gespräch, und so habe ich zum erstenmal eine Stunde neben Helene gesessen und mit ihr und ihrem Vater geplaudert.
3. Kapitel.
Pik-Neun.
Ich habe hier meine schriftstellerische Tätigkeit für eine Stunde unterbrochen und mein Abendbrot verzehrt, das mir einer der auf Befehl taubstummen Männer wie immer mit dem Glockenschlage acht Uhr hereinbrachte.
Nun kann ich wieder beginnen. – –
* * *
Helene hat damals sofort auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. – Sie war hell gekleidet, so recht frühlingsmäßig. Ihr feines, zartes Gesicht, ihr reiches blondes Haar und ihr sanftes Wesen hätten wohl auch einem Manne, der mehr Frauen kannte als ich und daher ein schärferer Kritiker gewesen wäre, gefallen.
Ich bin dem weiblichen Geschlecht gegenüber stets etwas linkisch und schüchtern gewesen. Helenes ganze Art gab mir schnell meine Sicherheit zurück. Sie hatte so gütige, blaue Augen, die niemand in Verwirrung setzten und stets zu sagen schienen: „Ich meine es gut mit allen Menschen.“
Ihr Vater war seit Jahren infolge eines Schlaganfalls nur noch eine bedauernswerte Ruine, konnte nur mühsam die Worte herausbringen, hatte aber für alles Interesse und war keineswegs verbittert. Er war Kaufmann in einer anderen Stadt gewesen.
Diese erste Stunde des Beisammenseins mit Helene ließ mir die Welt in anderem Lichte erscheinen. Als ich daheim in meiner Dachstube ankam, habe ich ein Gedicht auf den Frühling gemacht, in dem eine Bank im Park, blondes Haar und blaue, seelenvolle Auge vorkamen.
Am Abend dieses selben Tages begann dann das Merkwürdige.
Ich hatte mit Steiners auch über unser Haus und seine Bewohner gesprochen, wobei Helene betont hatte, daß ihr Vater und sie noch niemanden von den anderen Leuten kennengelernt hätten, nicht einmal von Ansehen, weil sie so ganz für sich lebten. Bei dieser Gelegenheit war der alte Herr unruhig geworden und hatte sich die Bemerkung herausgequält, daß er es sehr gern sehen würde, wenn seine Tochter irgendwie Anschluß an eine Altersgenossin finden könnte.
„Helene ist jung. Und Jugend gehört zu Jugend. – Sie soll nicht ihre besten Jahre allein mit dem alten Vater vertrauern. Zu meiner Pflege ist ja unsere Köchin da, eine sehr zuverlässige Person, die schon viele Jahre bei uns dient.“ – So ungefähr hatte er gesagt. –
Ich erwähne dies alles nur, weil diese Äußerungen sehr bald eine gewisse Bedeutung gewannen.
Ich hatte bis neun Uhr zwei Knaben in die Geheimnisse der griechischen unregelmäßigen Steigerung eingeweiht und kam gegen halb zehn nach Hause, – hungrig, müde und doch mit froh bewegter Seele. Die Erinnerung an den frischgrünen Park und an Helenes weiche, gütige Stimme war noch so lebendig in mir.
Sehr langsam stieg ich die Treppe, die mit dicken Läufern belegt war, empor. Es ist ja überhaupt ein selten gut gehaltenes Haus. Der Besitzer knausert nicht. Er will den Einwohnern für den Mietzins auch etwas bieten.
Es war sehr still im Treppenflur, sehr. Die elektrischen Lampen in den blaugrünen Schalen – sehr geschmackvolle Beleuchtungskörper – brannten.
Dann hörte ich in der dritten Etage eine Tür öffnen und schließen – die Flurtür einer der beiden Wohnungen. Welcher, konnte ich nicht genau sagen, glaubte aber, daß jemand die Wohnung des Herrn Blaschy verlassen habe, und dieser Jemand kam jetzt auch sehr eilig die Treppe herab.
Ich war gerade stehen geblieben, um ein Taschentüchlein aufzuheben, daß auf einer der Stufen lag. Ein feines Spitzentuch, winzig klein, stark nach Veilchen duftend, hielt ich nun in der Hand. Mein erster Gedanke war: Vielleicht gehört es Helene! – Das wäre dann ein Grund gewesen, morgen Vormittag bei Steiners vorzusprechen.
Ich hatte das Tüchlein schnell in die Tasche gesteckt, um es wie ein kostbares Gut vor den Augen dessen, der mir von oben entgegenkam, zu verbergen.
Aber die Dinge nahmen einen anderen Verlauf – einen ganz anderen. Ich hätte das duftenden Tüchlein ruhig in der Hand behalten können. Die Person, die es so eilig hatte, tauchte nicht auf. Da beugte ich mich, dicht vor dem Treppenabsatz zwischen dem ersten und zweiten Stock stehend, vor und … prallte sofort wieder zurück.
Ich hatte Herrn von Blaschy hinter der fraglos nur angelehnt gewesenen Flurtür des Rentiers Steiner verschwinden sehen, hörte nun auch, wie diese Tür leise ins Schloß gedrückt wurde.
Ich war so sprachlos, daß ich eine ganze Weile regungslos dastand.
Was hatte das zu bedeuten?! – Blaschy, der alternde Geck, besuchte um diese späte Stunde noch den Rentier?! Und – er war doch fraglos erwartet worden …! Das bewies ja die Tatsache, daß die Flurtür nur angelehnt gewesen sein konnte. Hatte ich doch weder läuten noch aufschließen gehört!
Ich will hier einfügen, daß die Nebenwohnung des zweiten Stockwerks insofern zur Zeit leer stand, als die Mieter verreist waren, und zwar voraussichtlich für die ganze Kriegsdauer, wie mir der Hauswart erzählt hatte. –
Nachdem ich mich etwas gefaßt hatte, war mein erster Gedanke: „Steiners haben dich belogen! Ihnen sind die Mitbewohner des Hauses durchaus nicht unbekannt! Jedenfalls kennen sie diesen Blaschy sehr genau …!“
Dann ging ich in meine Mansardenstube hinauf, setzte mich im Dunkeln an das Fenster in den alten Lehnsessel und begann mein Erlebnis von allen Seiten kritisch zu beleuchten. –
Nein – Helene konnte mich nicht absichtlich belogen haben – niemals! Vielleicht war ihr Vater plötzlich erkrankt, und sie hatte in ihrer Angst die Köchin zu Blaschy nach oben geschickt, damit er ihr beistehe. – Ja – diese Möglichkeit war wohl die richtige Lösung dieser auffälligen Beobachtung, die ich auf der Treppe gemacht hatte …!
Mir wurde leichter ums Herz, Helenes in meiner Erinnerung bereits verdunkeltes Bild strahlte wieder in früherer Reinheit.
Ganz heiter schaltete ich die Lampe über dem Mitteltisch ein und öffnete dann nochmals meine Stubentür, um aus meinem draußen angebrachten Briefkasten die Zeitung herauszunehmen. Außerdem fand ich aber noch drei Briefe vor. Zwei waren von Bekannten, die an der Front standen, der dritte trug den Aufdruck eines Herrenartikelgeschäfts, – also war wohl eine Reklameanzeige der Inhalt.
Ohne auf die Aufschrift zu sehen, riß ich diesen Brief zuerst auf, damit er auch sofort in den Papierkorb wandern könnte.
Zu meinem Erstaunen enthielt der Umschlag jedoch nichts als ein Blatt aus einem neuen Spiel Karten, eine Pik-Neun. – Es war ein Blatt von sogenannten französischen Karten. Die Rückseite zeigte ein merkwürdiges Muster, das wie ein großer, blauer Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln auf dunklerem Grunde aussah. Die Pik-Neun war nicht gerade aus bestem Papier hergestellt, hatte aber tadellosen Glanz, Goldecken und konnte noch nie zusammen mit den anderen Blättern des Spiels zu einem gemütlichen Skat oder etwa einem gefährlichen Jeu benutzt sein.
Das war wirklich mal eine seltsame Sendung! – Als ich nun aber nochmals den Umschlag zur Hand nahm, da zuckte ich leicht zusammen. – Der Brief war gar nicht an mich, sondern „an den Kinoschauspieler Herrn Wladislaw Panszinski“ gerichtet …!!
Die Sache war mir sehr unangenehm. – Panszinski hatte sich trotz der billigen Nahrungsmittel meine Sympathie nicht zu erwerben vermocht. Deshalb wollte ich es auch vermeiden, ihn in seiner Stube aufzusuchen. Ich fürchtete, daß er noch vertraulicher werden könnte.
Die Briefklappe ließ sich zum Glück, ohne neuen Klebstoff zu verwenden, ganz gut und auch unauffällig wieder schließen. Bevor ich jedoch die Pik–Neun wieder in den Umschlag schob, betrachtete ich sie mir nochmals ganz genau.
Warum ich das tat? – Ich vermag es wirklich nicht zu sagen. Es war wohl so eine Eingebung des Augenblicks, der ich einfach folgte.
Auf diese Weise nun fand ich folgendes heraus. – Hielt man die Karte so, daß der Lichtschein sie im richtigen Winkel traf, um die Glanzschicht hell aufleuchten zu lassen, dann waren auf der Rückseite die offenbar mit einem spitzen Radiergummi geschriebene Zahl 10, dahinter aber ein stehendes Kreuz und die Zahl 1 und 18, getrennt durch ein Komma, zu erkennen.
Wenn ich sage „geschrieben“, so stimmt das nicht ganz genau. Der Gummi hatte eben nur von der Glanzschicht gerade so viel weggenommen, das die Zahlen und das Kreuz, die über die ganze Breite der Rückseite hingingen, sich bei einer bestimmten Stellung der Karte zu einer Lichtquelle leicht abhoben wie mattere Striche.
Jetzt gewann die Pik-Neun für mich doch erhöhte Bedeutung
Ich habe wahrhaftig nie das geringste Interesse für Kriminalwissenschaften und ähnliches gehabt. Detektivromane sind mir noch heute ein Greuel. Wenn ich in meinem Leben drei von derartigen am Schreibtisch feinausgeklügelten Geschichten gelesen habe, so ist es viel.
Aber damals regte sich zum erstenmal bei mir so etwas wie die Lust, allerlei Folgerungen aus diesem Kartenblatt und der Art seiner Versendung zu ziehen.
Der Umschlag war der eines bekannten Geschäftes der Stadt. – Herrenartikel …!! Wie unverfänglich! Wir haben ja jetzt im Kriege Briefüberwachung. Aber so ein Reklameschreiben oder eine Rechnung einer mit Krawatten und so weiter handelnden Firma hätte kein Mensch angehalten! – Und weiter: Wurde der Brief wirklich geöffnet, dann lag nichts weiter darin als eine einzelne Spielkarte, die – wer weiß aus welchem harmlosen Grunde – dem vielseitigen Lohndiener zugeschickt wurde. –
Ich glaube, mehr als diese Erwägungen stellte ich damals am Abend des 17. April nicht an. Aber sie genügten doch, mir klarzumachen, daß die Karte alles andere als harmlos sei. Ich merkte mir daher genau die Zahlen, das Kreuz und das Muster der Rückseite, klebte den Umschlag zu, zog mir die Stiefel aus und schlich sehr leise nach der anderen Mansardenstube hinüber, schaute durch das Schlüsselloch, sah, daß im Zimmer kein Licht brannte, und warf den Brief in Panszinskis Kasten.
* * *
Es ist elf Uhr. Ich werde schlafen gehen. Vor dem Einschlafen aber werde ich mir überlegen, wie ich meinen „Roman“ morgen fortsetzen soll. Jedenfalls macht mir das Schreiben sehr viel Vergnügen. Und – vielleicht werde ich, wenn ich mir alle Einzelheiten auf diese Weise nochmals gründlich ins Gedächtnis zurückrufe, Zusammenhänge zwischen den verschiedenen kleinen, eigenartigen Begebenheiten herausfinden, die mir endlich Klarheit über die Frage verschaffen, ob es lediglich ein Zufall war, daß die Mieter in unserem Hause teilweise so seltsame Geheimnisse und Gewohnheiten hatten.
4. Kapitel.
Gisela.
Es ist zehn Uhr vormittags.
Soeben hat mich mein Peiniger verlassen. Er erschien, als ich gerade beim Morgenkaffee den Anfang meiner Geschichte überlas. Sein Besuch hat mich einer kostbaren Stunde Arbeitszeit beraubt. Ich habe ja jetzt eine Arbeit – meinen Roman!
Der Peiniger ließ sich die eng beschriebenen Blätter geben und studierte sie sorgfältig durch. Dann reichte er sie mir zurück und sagte:
„Sie machen mir die Sache sehr schwer, sehr …! Sie sind noch geriebener, als ich glaubte! Diese schriftlichen Bekenntnisse sind in ihrer Art ein Meisterstück. Ich bin gespannt auf die Fortsetzungen, die ich mir jetzt jeden Morgen durchlesen werde.“
„Ein Meisterstück? Wie meinen Sie das?“ fragte ich. In mir regte sich der Stolz des Romanschreibers.
Der Peiniger lächelte eigentümlich.
„Die Antwort werde ich Ihnen später geben,“ erklärte er.
Dann begann er wieder mit dem üblichen Programm, das mir langweilig wurde: er wollte allerlei belanglose Dinge wissen, forschte und bohrte, – so, wie nur er das verstand.
Getreu meinem Vorsatze schwieg ich oder … redete absichtlich Unsinn.
Schließlich aber empörten mich seine Hartnäckigkeit und Geduld.
„Wollen Sie mir nicht endlich sagen, Herr, was man mir vorwirft, weshalb ich hier gefangen gehalten werde, wo ich mich befinde und wer Sie eigentlich sind?!“ schrie ich ihn an. „Ich habe ein Recht, dies alles zu erfahren! Verstehen Sie mich – ein Recht!! Ich bin Bürger eines Staates, der …“
Der Peiniger streckte kopfschüttelnd und sehr hoheitsvoll die wohlgepflegte Hand gegen mich aus und fiel mir ins Wort:
„Sie sind der beste Schauspieler, Doktor, den ich unter Leuten Ihres Schlages angetroffen habe.“
Dann ging er mit höflichem Gruß davon.
Ich schämte mich, daß ich ihn so angebrüllt, als sei ich ein betrunkener Bierfahrer. Der Peiniger war mir an Gemütsruhe unendlich überlegen – unendlich …! –
Um diese letzte Szene schnell zu vergessen, ergriff ich die Feder und begann zu schreiben.
* * *
Nachdem ich den Brief unbemerkt in Panszinskis Kasten befördert hatte, zeichnete ich mir in meiner Stube aus dem Gedächtnis ungefähr das Schmetterlingsbild auf ein Stück Papier und schrieb darüber hinweg:
10 + 1, 18
Alles in den richtigen Größenverhältnissen.
Dann ging ich zu Bett.
Morgens, als ich mir vom Bäcker wie immer um halb acht mein Weißbrot holte, begegnete ich auf der Treppe der Köchin des Rentiers Steiner.
Daß sie Maruschka hieß, wußte ich schon. Sie war eine kleine, schwarzhaarige Person mit gelblicher Gesichtsfarbe, und nicht mehr ganz jung. Am auffälligsten an ihr waren die dunklen, blitzenden Augen. Wirklich – die reine Zigeunerin …!
„Maruschka,“ sprach ich sie an, „Ihr Herr war wohl gestern Abend plötzlich recht krank geworden? Geht es ihm schon besser?“
Sie schaute mich einen Moment ziemlich verständnislos an. Dann fragte sie ihrerseits:
„Woher wissen denn der Herr Doktor schon davon?“
„Weil ich gestern Herrn von Blaschy gegen halb zehn sehr eilig hinter Ihrer Flurtür verschwinden sah,“ erklärte ich und berichtete dann auch die Geschichte von dem Spitzentüchlein, das ich auf der Treppe gefunden und das mich zum Stehenbleiben veranlaßt hatte.
Maruschka nickte traurig mit dem Kopf.
„Ja, Herr Steiner hat gestern wieder eine neue Schlagberührung gehabt,“ sagte sie. „Und da hat Fräulein Helene mich in ihrer ersten Angst zu Ihnen nach oben geschickt, Herr Doktor. In meiner Verwirrung hörte ich aber nicht recht hin und klingelte bei Herrn von Blaschy an. Als dieser zu uns kam, war der gnädige Herr jedoch schon wieder bei Bewußtsein, und heute morgen ist ihm kaum noch etwas anzumerken.“
„Oh – das freut mich,“ meinte ich ehrlich. „Grüßen Sie also bitte die Herrschaften von mir, und ich lasse auch gute Besserung wünschen.“
Der Morgenkaffee und die trockenen Brötchen schmeckten mir heute doppelt gut. – Helene hatte zu mir geschickt …!! Ich jubelte! – Meine Hilfe hatte sie gewollt, – und alles war nun wirklich so aufgeklärt, wie ich es mir gleich zurechtgelegt hatte, – alles! Helene eine Lügnerin …!! Ich bat sie wegen dieser Gedankensünde von gestern tausendmal im Stillen um Verzeihung …! – –
Ich hatte Maruschka auch das Spitzentuch gezeigt. Sie erklärte, es gehöre ihrem gnädigen Fräulein bestimmt nicht. Aber vielleicht Fräulein Gisela Maklakow aus dem vierten Stock. Jedenfalls sei es ein recht kostbares Tüchlein. Die Spitzen seien echt Brüsseler.
Erst nachher fiel mir ein, daß eine Köchin für gewöhnlich kaum wissen dürfte, ob es sich um Brüsseler oder andere Spitzen handele. – Dieses „nachher“ war um elf Uhr vormittags, als ich mich bereits in meinen schwarzen Gehrock geworfen hatte, um das Tüchlein persönlich bei Oberst Maklakow abzugeben.
Warum ich es nicht einfacher durch den Hauswart hinschickte? – Sehr einfach. Not macht auch die bescheidensten Menschen aufdringlich. – Ich hoffte, daß ich so Gelegenheit finden würde, Frau oder Herrn Maklakow zu bitten, mich in ihren Kreisen als Privatlehrer zu empfehlen. –
Ich hatte einerseits Pech – anderseits Glück. Nur die Tochter des Hauses empfing mich. Sie war sehr liebenswürdig. Das Tüchlein sei Eigentum ihrer Mutter, und diese habe es schon sehr vermißt, da es zu einem Dutzend ähnlicher feiner Arbeiten gehöre, die ihr der verstorbene König Leopold von Belgien einst persönlich als Geschenk überreicht habe.
Einst …! – Ich dachte daran, daß Frau Maklakow ja einmal Sängerin und Leopold, der ewig junge, ein großer Verehrer von Frauenschönheit gewesen war. – –
Gisela als das zweite Weib, das bisher in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, verdient etwas näher beschrieben zu werden.
Sie war das, was man eine rassige Schönheit nennt. Unter einer edelgeformten, von aschblondem, gescheiteltem Haar umrahmten Stirn glühten ein paar frohe, lebenslustige Augen. Die Nase, vielleicht etwas zu groß, verriet mit ihren dünnen, fast durchsichtigen Flügeln ebenso viel Temperament wie der volle, rote Mund. Die Kinnpartie wieder war fast zu energisch geformt. Dazu noch eine volle, schlanke Figur mit lebhaften, aber stets graziösen Bewegungen: das war Gisa Maklakow. Von den ihrigen wurde sie nur Gisa genannt.
Diesem jungen Mädchen gegenüber schämte ich mich, meine Bitte um Empfehlung bei Bekannten vorzutragen. Und mitten im Gespräch fragte sie mich dann plötzlich, als wenn sie sich an etwas Besonderes erinnerte, ob ich vielleicht die russische Sprache beherrsche.
Ich bejahte der Wahrheit gemäß.
„Das trifft sich gut, Herr Doktor,“ meinte sie eifrig. „Mein Vater äußerte gestern die Absicht, russischen Unterricht zu nehmen, da er im Stabsgebäude jetzt viel mit Aktenstücken zu tun hat, die man in der eroberten Festung Brest Litowsk gefunden hat.“
Jetzt schlug sie sich mit den Fingern ärgerlich auf den Mund.
„Wie kann ich nur!! Da habe ich ja eben ein Staatsgeheimnis verraten! Aber – Sie versprechen mir doch, Herr Doktor, von diesen Akten niemandem etwas zu sagen, nicht wahr?“
Ich gab ihr sogar mein Ehrenwort. Das beruhigte sie völlig.
Gleich darauf erschien das Stubenmädchen und begann mit Gisela an der Tür nach dem Flur eifrig zu flüstern. – Der Salon, in dem wir uns befanden, war nicht allzu groß. Und ich habe gute Ohren, sehr gute.
So hörte ich, wie das Stubenmädchen etwas von einer Schneiderrechnung sagte, von einem Boten, der das Geld unbedingt mitbringen solle, und ähnliches mehr.
Gisela entschuldigte sich und ging hinaus.
Es dauerte eine geraume Weile, ehe sie zurückkehrte. Sie sah nicht mehr so heiter aus wie vordem. Offenbar hatte sie Mühe gehabt, den Boten loszuwerden.
Ich wollte mich nun endlich verabschieden. Aber sie bat mich, noch zu bleiben, sagte dann ganz offen, daß sie mich gestern mit Steiners im Park zusammen gesehen habe, und bat mich daher, ihr Näheres über Fräulein Helene Steiner mitzuteilen, die auf sie einen sehr sympathischen Eindruck mache.
Vielleicht habe ich Helene etwas zu eifrig gelobt. Jedenfalls schaute Gisela mich verschiedentlich so seltsam prüfend an.
Dann kam Frau Markdorf von ihren Besorgungen aus der Stadt zurück. – Gisela und ihre Mutter hätte man für Schwestern halten können. Wahrscheinlich würden Frauenkenner sogar der reifen Schönheit der ehemaligen Sängerin den Vorzug vor der heiteren Jugendfrische der Tochter gegeben haben.
Die Frau Oberst war sehr gnädig zu mir, doch auch so etwas herablassend.
Als ich ging, war mir zugesichert worden, daß Herr Maklakow sich von mir sehr wahrscheinlich im Russischen unterrichten lassen würde. –
So, wie ich von Maklakows kam, eilte ich nach dem Park und meinem Lieblingsplätzchen.
Helene war da, saß lesend auf meiner Bank.
Ganz kameradschaftlich streckte sie mir zur Begrüßung die Hand hin, dankte für die Maruschka aufgetragenen Grüße und erzählte mir dann von der Erkrankung ihres Vaters, schalt ein wenig auf die nachlässige Köchin, die ihr den wildfremden Herrn von Blaschy zu Hilfe geholt habe und fügte schließlich hinzu, daß der frühere Gutsbesitzer ein ziemlich aufdringlicher Mensch sei, den sie gestern nur schwer wieder losgeworden wäre.
„Obwohl ich ihm in gewisser Weise ja zu Dank verpflichtet bin,“ meinte sie, „– ein fader Geselle bleibt es doch. Es war taktlos von ihm, eine ganze Stunde sich in unserer Wohnung aufzuhalten und mich mit Schmeicheleien über mein Äußeres zu überhäufen.“
Wie mußte Helene sich über Blaschy geärgert haben, wenn sie, die sanfte, gütige, so scharf sich ausdrückte …!!
Dann fragte sie mich, ob das Spitzentüchlein wirklich Fräulein Maklakow gehört habe.
Ich erzählte, daß ich es persönlich in der vierten Etage abgegeben habe und erwähnte auch, daß der Oberst vielleicht bei mir russischen Unterricht nehmen würde. Von den Brest Litowsker Akten schwieg ich natürlich. –
Wir blieben bis gegen ein Uhr zusammen und sagten uns erst vor ihrer Flurtür Lebewohl und … auf Wiedersehen.
„Auf Wiedersehen!!“
Das hatte Helene mir zugerufen, als ich schon eine halbe Treppe höher war. Ich war selig, überselig …! Und mein selbstzubereitetes Mittagessen schmeckte mir besser als ein Diner von sechs Gängen. –
Um zwei Uhr kam der Burschen des Herrn Oberst zu mir und bestellte, ich möchte doch, falls es meine Zeit erlaube, gegen sechs Uhr nachmittags bei den Herrschaften vorsprechen wegen der russischen Stunden.
So lernte ich auch Maklakow kennen, eine straffe, soldatische Erscheinung, etwas geradezu, aber sonst ebenso liebenswürdig wie seine Tochter. Wir verabredeten für jeden Tag eine halbe Stunde Unterricht. Die Zeit sollte immer für den nächsten Tag näher vereinbart werden.
* * *
Es ist halb eins, und ich bekommen mein Mittagessen vorgesetzt, – wieder von einem der würdigen taubstummen Herren.
Ich bin heute sehr guter Laune – sehr guter, und mache mir ein Vergnügen daraus, den Mann zu ärgern, indem ich das Essen für ungenießbar erkläre.
Soeben ist er mit dem großen Anrichtebrett wieder verschwunden.
5. Kapitel.
Helene und ich.
Nach einer halben Stunde brachte der Würdige andere Speisen.
Ich habe mit Appetit gegessen, bin eine halbe Stunde in meiner Zelle auf und ab gelaufen, um mir Bewegung zu machen, und sitze nun wieder am Tisch vor meinem „Roman“.
Das Schreiben macht mir immer mehr Spaß. Ich glaube, ich werde mich hier noch zum Schriftsteller ausbilden.
* * *
Den Oberst Maklakow eingerechnet hatte ich jetzt sechs Schüler, die mir täglich gerade genug einbrachten, um „von der Hand in den Mund zu leben“, wie man zu sagen pflegt.
Maklakows Arbeitszimmer, in dem der Unterricht stattfand, war ein sehr gediegen mit hellen, schweren Eichenmöbeln ausgestatteter Raum.
Der Oberst zeigte sich sehr fleißig und machte schnelle Fortschritte. Während der halben Stunde wurde er oft an das auf seinem Schreibtisch stehende Telephon gerufen, immer in dienstlichen Angelegenheiten. Auch brachten zuweilen Ordonnanzen in versiegelten Ledermappen eilige Depeschen, auf die hin der Oberst schnell eine Entscheidung treffen mußte.
Er war ein peinlich ordentlicher Mensch.
Alle Notizen, die er sich in Dienstsachen machte, alle ihm zugegangenen Schriftstücke schloß er sofort in einen kleinen Panzerschrank ein, der zwischen den Fenstern rechts von seinem Schreibtisch stand.
Der Unterricht litt durch diese Unterbrechungen natürlich erheblich. Meist wurden aus der halben eine ganze Stunde, die ich dann auch voll bezahlt erhielt.
So ging etwa eine Woche hin. Es war eine Woche recht schlechten Wetters. Viel Regen gab’s, so daß ich Helene nur ein einziges Mal allein flüchtig auf der Treppe sprach. Und daher sehnte ich mich so sehr nach ihr.
Daß ich sie liebe, war mir gerade in diesen Regentagen klar geworden.
Dafür trat ich wieder Gisela Maklakow näher. Dreimal hatte der Oberst mich nach dem Unterricht gebeten, an der Abendtafel der Familie teilzunehmen.
So hatte ich Gelegenheit herauszumerken, daß zwischen der schönen, putzsüchtigen Frau Maklakow und ihrem Gatten ein recht kühles Verhältnis bestand.
Gisa war sehr musikalisch. Ich spiele ebenfalls leidlich Klavier. Und vierhändige Sonaten waren es, die uns zu Freunden machten.
Dann erzählte mir Gisa eines abends strahlend, sie habe Helene Steiner in der Loge des Hauswarts unten kennen gelernt und sei entzückt von dieser Altersgenossin, die gleich ihr für klassische Musik schwärme.
Am folgenden Abend traf ich Helene bereits bei Maklakows an. Die jungen Damen waren sehr schnell Freundinnen geworden. Der Oberst erklärte mir bald ebenfalls, er finde Fräulein Steiner einfach reizend und sei froh, daß seine Gisa hier im Hause ein so selten feingebildetes und bescheidenes junges Mädchen zu näherem Verkehr gewonnen habe.
Ich war eifersüchtig auf Gisa. Fürchtete ich doch, daß, wenn wieder schöne Tage kamen, die Bank im Park auch von Gisa benutzt werden würde.
Zunächst hielten aber noch der Regen und … meine schlechte Laune an. –
In dieser Woche war es auch, als sich eines Abends Herr Panszinski wieder einmal bei mir blicken ließ.
Er kam mit einem besonderen Anliegen, bei dem freilich für mich Geld zu verdienen war. Daher nahm ich seinen Besuch auch geduldig hin.
Er brachte mir ein Filmdrama in Schreibmaschinenschrift, ein dreiaktiges Schauspiel, aus dem ich ihm seine Rolle – er hatte einen Diener zu spielen – herausschreiben sollte.
Panszinski blieb eine Stunde. Wir unterhielten uns über die Kinokunst. Und wieder stellte ich fest, daß der Mensch mit dem glatten Lakaiengesicht und der absichtlich rüden Redeweise öfters entgleiste und verriet, wie wenig diese Ausdrucksweise des Rowdy-Viertels zu seiner offenbaren Geistesbildung paßte.
Dieser Besuch erinnerte mich auch wieder an die beinahe schon vergesse Pik-Neun.
Als Panszinski gegangen war, zündete ich mir eine Zigarre an und legte mich ins offene Fenster. Die Luft war lau, und ein feiner Regen rieselte herab.
Ich grübelte wieder über diesen merkwürdigen Menschen und die noch merkwürdigere, an ihn gerichtete Botschaft – denn das war die Pik-Neun ja fraglos gewesen – nach.
Etwas Geheimnisvolles umgab diese Person. – Daß er Pole war, wenn auch nur von Geburt, leugnete er nicht. Weshalb auch?
Ich hatte das Licht in meiner Stube ausgedreht. Bevor ich dann im Dunkeln zu Bett gehen wollte (um die Elektrizitätsgesellschaft weniger verdienen zu lassen!), öffnete ich meine Stubentür, damit der Zigarrenrauch sich schneller verziehen sollte.
Ich zog mir, mich an einen Stuhl lehnend, die Stiefel aus.
Gerade hatte ich den zweiten auf den Teppich gestellt, als ich hörte, wie drüben Panszinskis stets etwas knarrende Tür geöffnet wurde, wie zwei Personen schnell noch einige leise Worte wechselten und die Tür dann wieder sachte zugezogen wurde.
Neugierig, wer der späte Besucher meines Nachbars gewesen sein könne, glitt ich auf Strümpfen – meine Stubentür war ja noch offen – auf den Bodenraum hinaus und eilte nach der Treppe hin.
Panszinskis Gast stieg, ohne die Nachtbeleuchtung einzuschalten, die Treppe fast lautlos abwärts. Dann vernahm ich in der herrschenden Stille ganz deutlich wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch eingebracht wurde.
Seltsam! – Wer konnte der Besucher sein?! Doch nur Herr von Blaschy – nur der!!
Dem Gehör nach war Panszinskis Gast in der dritten Etage zu Hause. Und dort wohnten außer Blaschy nur noch zwei alte Damen mit ihren zwei fettwanstigen Möpsen.
Blaschy?! – Was hatte der verkrachte Gutsbesitzer aber mit dem Polen zu tun? Ich hatte doch gestern noch unten im Hausflur gesehen, daß sie ohne Gruß aneinander vorübergingen …!
Während ich noch grübelnd am Treppengeländer stand, hörte ich im dritten Stock wieder ein Türschloß schnappen, darauf flüchtige Schritte die Treppe nach unten eilen, bis in die zweite Etage, und … dann war alles still.
Ich wartete noch mindestens eine halbe Stunde. Die Uhr der Kirche der Villenkolonie schlug Mitternacht, als ich endlich in mein Zimmer zurückkehrte, sehr, sehr vorsichtig meine Stubentür einklinkte, abschloß und mich dann in den Lehnstuhl am Fenster warf.
Was in aller Welt bedeuteten diese meine neuesten Beobachtungen …?! Was hatte der, der zuletzt die Treppe vom dritten zum zweiten Stock hinabgegangen war, so spät bei Steiners zu suchen, die hier ja einzig und allein in Betracht kamen …?! Und dieser „der“ konnte nur Blaschy gewesen sein – nur; dafür gab es genug Beweisschlüsse.
Mir war ganz wirr im Kopf. Sicher war ja das eine: hier im Hause gingen Dinge vor sich, die, wenn sie nicht geradezu das Licht des Tages zu scheuen hatten, doch jedenfalls nicht ganz reinlicher Natur waren. – Oder – sah ich etwa zu schwarz, handelte es sich doch um harmlose Vorgänge, die mir … die Eifersucht in meinem Hirn in ein anderes Licht rückte…?! – Ich dachte an jenen Abend, als der Rentier erkrankt war. Auch damals hatte ich mich zwecklos aufgeregt.
Und diese Erinnerung warnte mich: Urteile nicht vorschnell! Gib es auf, lediglich auf Grund von Erwägungen und scheinbar ineinandergreifenden Beweisgründen diese Vorgänge aufzuklären, die hier deine Seelenruhe stören, die dir das Bild der Geliebten mit verdunkelnden Schatten des Argwohns umgeben! –
Beobachte sie…!!
Das war das Hauptergebnis dieser Nacht, in der ich noch bis gegen drei Uhr wach lag und grübelte und grübelte.
Nicht nur über das Geheimnisvolle, das sich hier im Hause abspielte. Nein – auch über meine Liebe zu Helene suchte ich vor mir selbst offen Rechnung zu legen.
War es nicht eine Torheit, mich diesem Herzenstaumel hinzugeben …?! War es nicht die aussichtsloseste Neigung, die je im Herzen eines Mannes aufgekeimt war?! – Was war ich – was hatte ich einem Weibe zu bieten?! – Ein Privatlehrer, der schon allein für sich selbst kaum sorgen konnte und dessen Zukunft von den grauen Schleiern von Not und Dürftigkeit verhüllt waren.!!
Jedenfalls durfte ich es als anständiges Charakter nie wagen Helene meine Gefühle zu offenbaren, durfte sie auch nicht merken lassen, wie es um mich stand …!!
Mit einem Male freute ich mich so gar nicht mehr auf die sonnigen Tage im Park, die ja schließlich kommen mußten, nicht mehr auf meine Bank im Grünen mit der Aussicht auf den Exerzierplatz, wo die wehrhaften Männer, Alt und Jung, in die Geheimnisse militärischen Drills eingeübt wurden.
Endlich schlief ich ein. Ich träumte von Helene. Ich glaube, ich habe auch im Traum geweint vor Sehnsucht. Ich war ja seit meinem achtzehnten Lebensjahr ganz einsam gewesen. Wirkliche Freunde besaß ich nicht. Und nun, wo mein Herz mich zu einem jungen Weibe hindrängte, hieß es … verzichten!
Seltsam – seltsam, wie so vieles in meiner Geschichte: ich träumte auch von Gisa Maklakow! Welche Rolle sie in meinen Scheinerlebnissen jener Nacht spielte, weiß ich nicht mehr …
6. Kapitel.
Eine neue Karte im Spiel.
Ich habe soeben Kaffee getrunken.
Der Würdige, der mir heute den Nachmittagstrunk in meine Zelle brachte – die beiden wechselten sich bei meiner Bedienung ab –, geruhte heute plötzlich zu sprechen.
Der Herr Untersuchungsrichter (also der Peiniger) würde erst abends kommen, erklärte er.
Mir nur angenehm! Da werde ich in meinem „Roman“ wieder ein paar Seiten weiter sein.
Beim Kaffee habe ich mir überlegt, wie ich meine Niederschrift fortsetzen soll. Meine Vermutung, daß allerlei geringfügige Einzelheiten durch diese Art von „Geständnis“ in meiner Erinnerung wieder auftauchen würden, trifft zu, wie ich stündlich besser merke. Ich kann sogar die Tage genau auseinanderhalten, an denen dies und jenes passierte, vermag die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge zu schildern.
* * *
Nach jenen neun Regentagen – es waren neun im ganzen, und nicht eine Woche, wie ich vorher angegeben habe – brachte die Nacht vom neunten zum zehnten einen heftigen Sturm, der am besten die Feuchtigkeit von den Straßen, Bäumen, Büschen und Blumen wegnahm.
Als ich morgens erwachte, schien die Sonne strahlend in meine Stube. Der Wind hatte sich plötzlich auch gelegt. Es wurde ein wunderbarer Frühlingstag.
Um elf Uhr wollte ich nach dem Park. Eigentlich schon früher. Aber Panszinski hatte mich aufgehalten, seine Rolle und das Kinoschauspiel abgeholt und mir eine anständige Bezahlung in die Hand gedrückt.
„Sie könnten mir noch einen Gefallen tun, Herr Doktor,“ hatte er dann gesagt. „Ich weiß, daß Oberst Maklakow in der nächsten Woche einen Herrenabend gibt und dazu eines Lohndieners benötigt. Empfehlen Sie mich bitte den Herrschaften. Ich stehle keine Zigarren, betrinke mich nicht und nehme auch keine Bratenreste oder dergleichen in den Taschen mit.“
Ich versprach es ihm und fügte hinzu, ich müßte jetzt leider zu einer Verabredung.
Er verstand und ging.
Kaum war er weg, gab’s einen neuen Aufenthalt.
Es klopfte. Es war … Herr von Blaschy, tadellos angezogen wie immer, zu tadellos, mit offenbar frisch gefärbtem, leicht aufgedrehtem Schnurrbart, rosig gepudertem Gesicht und Einglas vor dem linken Auge.
Seine süßliche Liebenswürdigkeit stieß mich zuerst ab. Aber bald merkte ich, daß er ein sehr, sehr harmloser, nur von dem Werte der eigenen Person etwas zu stark überzeugter Mensch war, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, zumal er, wie er unter einem Schwall von poetischen Phrasen mir beichtete, in … Gisa Maklakow sterblich verliebt sei.
Er wollte von mir nun nichts anderes, als daß ich ihn mit dem Oberst oder der gnädigen Frau auf unauffällige Weise bekannt mache.
„Ich bin hier in der Stadt ganz fremd, erst April hergezogen,“ sagte er. „Wenn Sie mir nicht helfen, Herr Doktor, gehe ich zugrunde! – Sie wissen … „Vom Stamme jener Afra, die da sterben, wenn sie lieben.“[1]
War er mir gegenüber ehrlich, so wollte ich es auch sein.
„Haben Sie auch den Unterschied der Jahre bedacht, Herr von Blaschy,“ sagte ich. „Fräulein Maklakow schätze ich auf zwanzig. Und ob ein so junges Mädchen einen Herrn auch nur als Bewerber dulden wird, der gut doppelt so alt ist, erscheint mir recht fraglich.“
Er reichte mir die Hand.
„Ich danke Ihnen für diese Aufrichtigkeit, Herr Doktor. Gewiß, ich bin sechsundvierzig. Aber ich fühle mich wie dreißig. Und das ist die Hauptsache. – Außerdem: es gibt junge Damen, die vielleicht von der Mutter her einen gewissen Hang zum Luxus geerbt haben und die es sich gern gefallen lassen, von einem auch um viele Jahre älteren, reichen Gatten sich verwöhnen zu lassen. Ich bin reich – besser, wieder reich geworden. Durch den Krieg. Glückliche Spekulationen, aber nicht etwa Wuchergeschäfte, haben mir ein großes Vermögen in kurzem in den Schoß geworfen.“
„Alles sehr schön. Aber Sie irren wohl, Herr von Blaschy, wenn Sie annehmen, Fräulein Maklakow lege Wert auf äußeren Putz. Ich beurteile die junge Dame anders.“
„Nun – mag sein. – Also, bester Herr Doktor, wollen Sie nicht so ein wenig Vorsehung spielen? Ich bitte Sie herzlich darum.“
„Ja – gern!“ Ich dachte an meine Liebe zu Helene. Nur weil auch ich verliebt war, ging ich auf seine Wünsche ein.
Er hatte auch schon einen ganzen Plan bereit, wie wir zum Ziele gelangen könnten, ohne daß der Oberst die Absicht merkte. Dieser Plan war einfach genug.
Blaschy beschäftigte sich so nebenbei auch mit Erfindungen. Er hatte einen Schützengrabenofen konstruiert, den er der Heeresverwaltung kostenlos zur Verfügung stellen wollte. Zum Schein würde er nun gleichfalls bei mir russische Stunden nehmen. Dann sollte ich gelegentlich Maklakow gegenüber erwähnen, daß ich den Ofen bei Blaschy gesehen hätte und für außerordentlich praktisch hielte. Der Oberst, der sich für alles interessierte, würde dann wohl auf diesen Köder anbeißen. –
Endlich – endlich verabschiedete Blaschy sich, und ich nahm Hut, Stock und Mantel und eilte nach dem Park.
Aber … die Bank war leer!
Wie enttäuscht war ich …! Hatte ich doch bestimmt gehofft, daß Steiners diesen ersten schönen Tag benutzen würden, um wieder im Freien sich aufhalten zu können.
Trotzdem: ich gab die Hoffnung noch nicht auf. Vielleicht kamen sie noch.
Eine halbe Stunde wartete ich. Schon wollte ich heimkehren, als ich hinter den Büschen das mir schon bekannte leise Quietschen der Federn des Krankenfahrstuhls hörte. Ich sprang auf und eilte Helene entgegen.
Welch’ rührendes Bild war es doch, dieses schöne, anmutsvolle junge Mädchen in der Rolle der zärtlichen Pflegerin und Tochter des armen, gelähmten Vaters vor sich zu sehen …! Sie schob den eleganten, auf Gummirädern und in Kugellagern laufenden Krankenstuhl stets selbst. Und ihr Benehmen dem stillen Dulder gegenüber konnte kaum aufmerksamer und liebevoller sein.
Wir begrüßten uns wie alte Bekannte. Und auch der Rentier schien sich zu freuen mich wiederzusehen.
Nachdem wir dann eine Weile – Helene und ich auf der Bank sitzend, der Kranke in seinem bequemen Wagen dicht daneben – geplaudert hatten, schickte uns Steiner fort.
„Helene soll Bewegung haben,“ meinte er. „Wandern Sie mit ihr etwas durch den Park, Doktor. Ich werde inzwischen hier meine Zerstreuung an den summenden Bienen und den bunten Faltern haben.“
Eine halbe Stunde waren wir allein. Helene war lieb und gütig wie immer. Aber ich dachte an das, was ich mir vorgenommen hatte. – Ihr fiel es bald auf, daß es über meinem Wesen und sich Geben wie ein Zwang lag. Sie liebte keine Winkelzüge. Und daher fragte sie mich gerade heraus, warum ich heute so verändert sei und ob ich ihr etwas übelgenommen habe.
„Ihnen – Ihnen?! Einem solchen Engel an Güte!“ fuhr es mir gegen meinen Willen heraus.
Aber noch mehr als meine Worte verrieten wohl meine Augen, die den ihren zum erstenmal mit heißem Wünschen begegneten.
Sie wurde verwirrt, schritt schneller aus.
Wir waren jetzt in der Ostecke des Parkes angelangt. Von dem Exerzierplatz trennte uns nur noch der weitmaschige Drahtzaun.
Helene blieb stehen und sah dem Treiben der Soldaten zu. Abwechslungsreich genug war ja dieses Bild. Aber es fehlte auch nicht an dem nötigen militärischen Lärm. Maschinengewehrtrupps schossen gerade vor uns mit Platzpatronen. Daneben übten Infanteristen das Werfen mit Handgranatenmodellen. Weiterhin war eine moderne Hindernisbahn: ein Streifen Land, der in den Ausschnitt einer zerschossenen Stellung verwandelt war. Sturmtrupps nahmen die Hindernisse, alle Mann mit Gasmasken vor den Gesichtern.
„Schrecklich, wenn man bedenkt, daß die Menschen jetzt nur darauf sinnen, wie sie einander am schnellsten vernichten können!“ sagte Helene leise.
So kamen wir auf den Krieg zu sprechen. Doch das Gezwungene blieb zwischen uns. – Wir gingen weiter, und auf entlegenen Wegen führte ich Helene nach unserer Bank zurück.
Der alte Herr Steiner kehrte uns den Rücken zu. Er saß vornübergebeugt und schien durch die Lücke in der Baumkulisse nach dem Exerzierplatz hin das Militär voller Interesse zu beobachten.
Mit einem Male rief Helene ganz unvermittelt:
„Wir sind schon wieder da, Vater …!“
Der Kranke schnellte den Oberkörper erschreckt herum, wobei ein großer Schreibblock mit daran gebundenem Bleistift, ein Fernglas, das ein Stück auseinandergeschraubt war, und … und eine einzelne Spielkarte von seinem Schoße herabglitten und zu Boden fielen.
Ich lief vorwärts, bückte mich und … bekam nur noch die Karte zu fassen. Schreibblock und Glas waren in Helenes Händen.
Ein einziger Blick genügte mir …
Es war Treff-As, – – und die Rückseite der Karte zeigte genau dasselbe Muster wie jene Pik-Neun …
Einen Moment war ich ganz fassungslos.
Dann hörte ich Steiner ruckweise, offenbar höchst aufgebracht, hervorstoßen:
„Mich so zu erschrecken …!! Den Tod hätte ich davon haben können …! Wirklich den Tod!“
Helene riß mir die Karte jetzt förmlich aus den Fingern.
„Gehen Sie, Herr Doktor, – gehen Sie! Mein Vater leidet an Wutanfällen. Dann beruhige ich ihn am besten allein,“ raunte sie mir zu.
Ich schaute nach Steiner hin. Das Gesicht des alten Mannes sah ganz verwandelt aus, so hatte die Wut es zur Fratze verzerrt.
Ich zog also verlegen den Hut und drückte mich, wie man in solchen Fällen zu sagen pflegt.
Erst daheim in meinem Stübchen fand ich die nötige Sammlung, um mir die häßliche Szene mit all ihren Einzelheiten wieder zu vergegenwärtigen. Und nun fiel mir verschiedenes auf, was ich zunächst nicht recht bedacht hatte.
Wir, Helene und ich, hatten den Alten offenbar vollkommen bei irgend einer Beschäftigung überrascht, die seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte. Wozu er aber das Fernglas benutzt, und was er sich auf dem großen Schreibblock vermerkt hatte – denn dieser war auf dem vordersten Blatt ganz eng beschrieben gewesen! – diese Frage vermochte ich mir nicht zu beantworten. Es kommt ja hier auch weniger auf das „was“, als vielmehr auf das „wie“ an, insofern nämlich, als ich bisher des Glaubens gewesen war, der alte Steiner könne seine Arme und Hände kaum noch genügend heben, um einem schwerfällig die Hand zur Begrüßung hinzustrecken. Demnach schien er also doch Tage zu haben, an denen es ihm gesundheitlich bedeutend besser ging. –
Aber dann das Kreuz-As!! Diese Karte mit genau derselben eigenartigen Schmetterlings-Rückseite wie jene Pik-Neun!! – Sie war aus dem Schreibblock herausgeglitten. Und Helene hatte sie mir dann eigentlich in recht, ja – recht unpassender Weise weggerissen – richtig gerissen …! Etwas mehr Selbstbeherrschung hatte ich ihr doch zugetraut …! – Hm – eigentlich war man geradezu gezwungen anzunehmen, daß Helene nicht nur das Treff-As[2], sondern auch den Schreibblock und das Fernglas nicht oder doch nicht lange hatte in Händen lassen wollen …! Die letzteren beiden Gegenstände hatte sie ja auch wirklich noch schneller aufgelesen als ich. Wie mußte sie mir nachgelaufen sein, da ich aus Höflichkeit mich doch recht beeilt hatte, die Sachen wieder aufzuheben! – –
Merkwürdig all das, sehr merkwürdig …! – Und schließlich noch des Alten Zornesausbruch …! Und nur deswegen, weil wir ihn erschreckt hatten, besser weil Helene ihn so unvermittelt von rückwärts schon aus ein paar Schritt Entfernung angerufen hatte …?! –
Bisher war mir nie aufgefallen, daß Steiner so leicht in Wut geriet oder sich überhaupt aufzuregen vermochte, nie …! Im Gegenteil! Ich hatte stets seine ruhige Gelassenheit bewundert, mit der er seine Leiden trug.
Ich besinne mich genau, daß an jenem ersten Tage nach der langen Regenperiode, als diese peinliche Szene sich abgespielt hatte, mein Lehnstuhl am Fenster einem Menschen als Sitz winkte, in dem so etwas wie erneutes Mißtrauen gegen Helene und auch gegen ihren Vater aufsteigen wollte. Dieser Mensch war ich, ich, der Helene liebte, mehr noch, der sie anbetete, vergötterte, und der doch das Gefühl zunächst nicht loswurde, daß die Aufregung von Vater und Tochter einen ernsteren, tieferen Grund gehabt habe. War mir’s zu verargen, wenn solche Zweifel an der Harmlosigkeit, der Aufrichtigkeit dieser beiden Personen abermals sich mir aufdrängten, da ich doch schon im Anfange unserer Bekanntschaft an jenem Abend Herrn von Blaschy bei Steiners in der Wohnung hatte verschwinden sehen, ein Vorfall, der sich nachher freilich aufklärte, und da ich weiter denselben Blaschy – vermutlich war er’s doch gewesen! – ein andermal nachts um zwölf Uhr offenbar nach dem zweiten Stock zu dem Rentier hatte hineilen hören, – gerade Blaschy, der wieder zu dem Polen in geheimnisvollen Beziehungen stand, zu Panszinski, dem in unauffälligem Umschlag eine Pik-Neun mit demselben Muster auf der Rückseite zugeschickt worden war, wie ich es heute auf dem Treff-As wieder zu Gesicht bekommen hatte.
Ja, das war ein vollständiger Kreis, der diese vier Personen einschloß, die in demselben Hause wohnten und die sich doch nicht näher zu kennen schienen!
Mir wurde, als ich mir dies alles überlegte, noch wirrer im Kopf als damals in jener Nacht, wo ich oben im Treppenflur im Dunkeln gestanden und Blaschy belauscht, und in der ich dann den Entschluß gefaßt hatte, die Augen gut offen zu halten und die Menschen heimlich zu beobachten, die mir so viele Rätsel aufgaben.
Noch wirrer im Kopf …!! – Kein Wunder, daß ich immer niedergeschlagener wurde, je länger ich über diese Dinge nachgrübelte. – Helene, meine sanfte, gütige Helene mußte ich auf eine Stufe mit diesem Panszinski und diesem Blaschy stellen, mußte ihr Heuchelei und andere wenig schöne Charaktereigenschaften zutrauen und sie für eine … Komödiantin halten, die mit ihrem süßen, lieben Lächeln nur die Flecken ihrer Seele verdeckte …!!
Mein Gott – wo war ich plötzlich mit meinen Gedanken hingeraten! Ich liebte sie und – hob doch so leichtsinnig den ersten Stein gegen sie auf …!! Ja, konnten denn nicht alle diese Vorkommnisse eine höchst harmlose Erklärung finden – wie damals der erste Besuch Blaschys bei Steiners …?! Waren das wirklich Beweise gegen die Ehrenhaftigkeit dieser Leute, – konnten es nicht alles Scheinbeweise sein …?!
Ich erhob mich schnell aus dem alten Lehnstuhl, fuhr mir mit der Hand über die Stirn, als wolle ich etwas fortwischen.
Helene hatte gesiegt! Ich war ein Narr, daß ich mir hier soeben aus unwesentlichen Vorfällen ein Mosaikbild zusammengestellt hatte, das die Wirklichkeit nie wiedergab, nicht wiedergeben konnte! Die Zeit würde mich schon belehren, wie bitter ich Helene unrecht getan hatte, ihr, der sanften, weichen, einzigen, – ihr, meiner ersten Liebe …
7. Kapitel.
Auf dem Gipfel des Glücks.
Mein Peiniger ist heute ausgeblieben. Dafür erlebte ich aber etwas ganz Neues: ich wurde, nachdem ich mein Abendbrot verzehrt hatte, mit verbundenen Augen von den beiden Würdigen ins Freie geführt, damit ich frische Luft schnappen könne.
Ich hatte dagegen nichts einzuwenden. Im Gegenteil. – Im Kopf war es mir bisweilen doch schon recht dumpf und verworren von dem tagelangen Aufenthalt in dem Zimmer, wo ständig die Lampe brennen mußte und in das nie ein Lichtstrahl von draußen hereindrang.
Wie ein Kind führten die beiden Würdigen mich, indem jeder eine meiner Hände ergriff, über hallende Gänge und Treppen mit Steinstufen in einen Garten. Es mußte ein Garten sein. Ich roch den Duft der Blumen, hörte das Rauschen und Wispern der Blätter von Bäumen und Sträuchern. Wir schritten über weiche Wege hin. Ganz von fern vernahm ich den Lärm der Großstadt wie ein fortwährendes Brausen, mehr in der Nähe das Rattern von Wagen und das Läuten elektrischer Straßenbahnen. Die mir wohlbekannten Klänge der Turmuhren verkündeten in kurzen Zwischenräumen nacheinander die achte Abendstunde. Dann schlugen sie ein viertel, ein halb neun.
Es war der merkwürdigste Spaziergang den ich je gemacht habe. Meine Begleiter waren stumm. Mein Gesicht war mit einem breiten, seidenen, schwarzen Tuche umgeben. Ich hatte versprochen, es nicht gewaltsam zu entfernen. Die Augen hatte man bei mir also ausgeschaltet. Desto schärfer war mein Gehör. Ich hätte zu gern festgestellt, wo ich mich eigentlich befand.
Mit einemmal ertönte ein besonderer Pfiff. Einer der Würdigen an meiner Seite beantwortete ihn durch den Zuruf: „Gut – gut!“
Gleich darauf führte man mich wieder in mein Zimmer zurück.
Dort hatte sich nichts geändert, nichts. Ich merkte nur, daß es gründlich gelüftet worden war.
Dann war ich allein, – wenn man eben in meiner Lage dies überhaupt sagen darf …! Die Augen draußen vor dem Guckloch der Doppeltür waren ja immer da, immer! In der ersten Zeit meiner Haft hatte ich mir zuweilen das Vergnügen gemacht, mit der Petroleumlampe in das verglaste Guckloch hineinzuleuchten. Dann glänzte dahinter stets ein starres menschliches Auge.
Ich setze mich an den Tisch, um an meinem „Roman“ weiter zu schreiben.
Die weißen Bogen sind schon recht zahlreich, die meine dünne, zierliche Schrift bedeckt. Wer weiß, was ein Handschriftendeuter aus meinen Buchstaben herausklügeln würde. Ich glaube, die Charakteristik würde lauten: gutmütig, etwas unselbständig im Urteil, etwas zur Pedanterie neigend, aber im ganzen – ein guter Kerl …!!
Ich wollte schon zur Feder greifen, als ich beschloß, das bisher Geschriebene nochmals zu überlesen.
Ich tat’s, und so kam es, daß ich hier und da am Rande, auch auf der Rückseite der Bogen, verschwommene Fingerabdrücke in Gestalt runder, leicht geschwärzter Stellen fand.
Sehr bald war ich mir über die Entstehung dieser Flecken im klaren: man hatte mein Manuskript mit der Schreibmaschine abschreiben lassen und zwar gleich in mehreren Exemplaren. Und von dem Kohlepapier, das zwischen den Durchschlägen gelegen hatte, war durch die Fingerspitzen des Maschinenschreibers die Farbe auf meinen Roman stellenweise übertragen worden.
Diese Entdeckung erschien mir sehr wichtig. Die Bemerkung des Peinigers, meine schriftlichen Bekenntnisse seien in ihrer Art ein Meisterstück, konnte kaum ironisch gemeint gewesen sein. Hätte man sonst wohl, wenn man diesen Bekenntnissen eben keinerlei Bedeutung beimaß, davon eine bzw. mehrere Abschriften fertigen lassen …?!
Nun – ich würde ja wohl später erfahren, zu welchem besonderen Zwecke dies geschehen war. –
Ich schreibe also weiter …
* * *
Dieser erste schöne Tag nach den neun Tagen Regen überschüttete mich förmlich mit neuen Erlebnissen.
Am Vormittag war erst der Pole bei mir gewesen, um seine Rolle abzuholen, dann Herr von Blaschy, der mir beichtete, daß er in Gisela verliebt sei. Hierauf kam die häßliche Geschichte im Park, der eine Stunde ernsten Nachdenkens in meinem Lehnstuhl folgte und … der Sieg Helenes über meine törichte Zweifelssucht.
Aber das Beste brachte der Nachmittag.
Nie werde ich diesen Nachmittag vergessen – nie! Mein Herz tut mir fast weh vor heißer Sehnsucht nach der Geliebten, wenn ich an die Einzelheiten dieser Stunden zurückdenke. Ich glaube ein Paar weiche, süße Lippen noch auf den meinen zu fühlen, glaube noch eine liebe, zärtliche Stimme zu hören und …
Nein – nein! Ich darf mich in diese Erinnerungen nicht zu sehr versenken! Wie soll ich wohl sonst hier auf dem Papier Wort an Wort fügen, wenn meine Augen schon jetzt so stark tränen, – – von dem Zigarettenrauch natürlich! – Männer dürfen ja nicht weinen …!! – –
Um ein halb fünf kam ich von einer Privatstunde. In meinem Briefkasten fand ich ein Briefchen von Helene.
„Mein Vater bedauert seine heutige Heftigkeit sehr, lieber Herr Doktor. Kommen Sie doch bitte so bald als möglich zu uns. – Gruß – Helene Steiner.“
So bald als möglich!!
Fünf Minuten später läutete ich also bereits an der Flurtür.
Maruschka, die Zigeunerin, die sich auf Brüsseler Spitzen verstand, öffnete und führte mich in eines der bescheiden eingerichteten Vorderzimmer.
Dort saß Steiner in seinem Krankenstuhl am Fenster. Ein besonders konstruierter Tisch, der mit seiner Platte über den Stuhl hinüberreichte, ermöglichte es dem Gelähmten, sich trotz der schweren Beweglichkeit seiner Arme und Hände zu beschäftigen.
Der Rentier hatte sich gerade mit Helene durch ein Kartenspiel zerstreut.
Als ich ihn begrüßte, warf ich einen schnellen Blick über die Karten.
Es war ein Spiel mit … Schmetterlings-Rückseiten.
Ich wurde ordentlich verwirrt bei dieser Entdeckung. Aber diese Verwirrung ging schnell in ein Gefühl der Beschämung über.
Steiner entschuldigte sich bei mir wegen des peinlichen Vorfalls vom Vormittag, besser, er wollte sich entschuldigen. Ich schnitt ihm aber das Wort ab und ersparte es ihm, als alter Mann mich um Verzeihung zu bitten.
Ich wurde dann noch aufs liebenswürdigste mit Kaffee und Kuchen bewirtet, mußte aber nachher auch eine Zigarre anzünden und erfuhr im Laufe des Gesprächs, daß der Rentier sich sehr gern mit dem Lösen von Skataufgaben die Zeit vertriebe. Ganz niedergeschlagen fügte er hinzu, daß er sich am Vormittag, als wir ihn so etwas durch unsere frühzeitige Rückkehr erschreckt hätten, gerade wieder mit einer Skataufgabe befaßt hätte, die er aber nicht zu lösen imstande wäre. –
Er holte dann unter dem Tisch den Schreibblock hervor und reichte ihn mir.
„Das ist die Aufgabe, und darunter stehen auch meine Berechnungen, wie das Solo-Spiel gegangen sein muß. Aber, wie gesagt, – es ist alles falsch – falsch!“ Das sagte er so recht im Tone eines Menschen, der sein Herz an eine unmögliche Sache gehängt hat und dies auch einsieht.
Ich hätte dem alten Herrn am liebsten die Hände gedrückt und ihn jetzt meinerseits um Verzeihung gebeten, daß ich je auf den Gedanken gekommen war, der Schreibblock sollte vor mir verborgen werden – aus irgendwelchen Gründen.
Aber ich schwieg, zeigte mich jedoch doppelt zuvorkommend und liebenswürdig.
Nachdem wir das Thema Skat genügend behandelt hatten, kamen wir auf Stahlstiche zu sprechen. Steiner war es, der diesen neuen Gegenstand berührte und dabei bewies, daß er in der Kunstgeschichte recht bewandert war.
Helene führte mich dann ins Nebenzimmer, einen kleinen Salon, wo an den Wänden mehrere vorzügliche Stiche holländischer Meister hingen, darunter ein Bild, vor dem ich längere Zeit stehen blieb, weil ich in der weiblichen Figur darauf eine gewisse Ähnlichkeit mit Helene feststellen zu können glaubte. Es war eine Liebesszene zwischen einem Edelmann aus der Zeit um 1600 und einem Bürgermädchen, das einen Korb Rosen abwehrend zwischen sich und den feurigen Liebhaber hielt.
Helene lachte mit einemmal leise und melodisch auf, legte mir leicht die Hand auf den Arm und sagte:
„Finden Sie auch, Herr Doktor, daß ich dieser Holländerin ein wenig ähnlich sehe? – Das haben nämlich schon viele Bekannte von uns behauptet.“ –
Ich muß an dieser Stelle eine vielgebrauchte Romanphrase zu Hilfe nehmen. Anders vermag ich nicht auszudrücken, was ich empfand, als Helene jetzt auch mit ihrer Schulter die meine berührte.
Es war wirklich, als fließe plötzlich ein Strom betörenden Verlangens aus ihrem Körper in den meinen über. Vor meinen Augen begannen feurige Sternchen aufzublitzen …
Ich wußte, daß wir allein waren, daß Helene die Tür hinter sich ins Schloß gedrückt hatte.
Ich verlor jede Selbstbeherrschung, umfing dieses frische, junge Weib, preßte sie an mich und suchte ihre Lippen mit meinem heißen, bebenden Munde.
Sie wehrte sich nicht. Nur wie ein Stöhnen, wie ein ängstlicher Seufzer kam es aus ihrer Brust. – –
Sie hielt mich lange umschlungen. Dann machte sie sich frei, hielt aber meine Hände in den ihren und sagte leise:
„Du weißt, daß ich dich liebe … Aber nie wieder darf sich das wiederholen, was eben geschehen. Ich bin arm, du desgleichen. Wir haben keine Aussicht, uns je anzugehören. Also sei du stärker als ich, handele du als Ehrenmann, indem du mir das Verzichten nicht noch schwerer machst. Wir wollen gute Freunde bleiben – nichts weiter! Sonst müßte ich mich vor mir selbst schämen. – Versprich mir, daß du auf ein schwaches, kleines Mädel Rücksicht nehmen wirst.“
Ich versprach es.
Noch einmal küßte Helene mich.
Dann gingen wir wieder zu dem Kranken hinüber, der schon die Karten für seine Skataufgabe eifrig hin- und herschob und kaum aufblickte.
* * *
Ich habe nicht weiterschreiben können.
Der Zigarettenrauch war wieder schuld daran.
Eine halbe Stunde lang bin ich in meiner Zelle wie ein Tier im Käfig auf und ab gegangen. – Was die Sehnsucht nicht alles macht …! – Bisher war ich doch so ergeben in mein Schicksal …! – –
Ich bin jetzt wieder zahm, ganz zahm.
Und deshalb setze ich meine Bekenntnisse fort.
8. Kapitel.
Was der Abend dieses Tages brachte.
Bis gegen sieben blieb ich bei Steiners.
Inzwischen war Gisela Maklakow noch zu einem Plauderstündchen erschienen. Die beiden jungen Mädchen hatten sich schon sehr angefreundet.
Ich fühlte mich eigentlich überflüssig, widmete mich mehr dem Kranken und half ihm bei seiner Skataufgabe, worüber er sehr glücklich war.
Dann mußte ich hinauf zu Maklakows, dem Oberst russischen Unterricht erteilen.
Ich saß in seinem Arbeitszimmer und wartete. Er war noch nicht nach Hause gekommen, wie mir das Stubenmädchen meldete.
Nach etwa fünf Minuten hörte ich, wie die Flurtür aufgeschlossen wurde, vernahm auch Schritte und Stimmen aus dem Korridor.
Neben dem Arbeitszimmer Maklakows lag das kleine, lauschige Boudoir seiner Gattin. Eine Flügeltür, unter Portieren verschwindend, verband beide.
Von dort her erklang nun ein erregter Wortwechsel. Ich verstand alles ganz deutlich.
„Heraus mit der Sprache, Melitta!“ begann der Oberst, offenbar in mühsam beherrschter Wut. „Und – keine Ausflüchte, keine neuen Lügen …! Ich warne dich! Meine Geduld ist zu Ende! – Wo hast du den Brillantschmuck, mein Verlobungsgeschenk, gelassen! Versetzt – verkauft …?“
„Ich möchte dich doch bitten, nicht so zu schreien!“ erwiderte die ehemalige Sängerin weinerlich. „Sollen etwa die Dienstboten hören, daß …“
„Die Dienstboten …?!“ Er lachte bitter auf. „Die wissen längst, daß hier jeden Tag für die gnädige Frau Rechnungen ins Haus gebracht werden für allerlei überflüssigen Tand, daß diese Rechnungen zum Teil unbezahlt bleiben, weil eben der Gatte nicht mehr imstande ist, die Unsummen aufzutreiben, die du – du allein verschwendest …!! – Nochmals, Melitta: wo ist der Schmuck …?“
„Ich … ich weiß nicht. Er muß mir gestohlen …“
Maklakow unterbrach sie mit Donnerstimme.
„Weib – du lügst schon wieder, genau so, wie du mich mit der Brosche, dem Erbstück meiner seligen Mutter, belogen hast.“
Da wollte ich nicht länger den Lauscher spielen, verließ leise das Zimmer, ging nach der Küche, rief mir das Stubenmädchen heraus und sagte ihr, sie solle verschweigen, daß ich schon dagewesen wäre. Ich würde nach zehn Minuten wiederkommen.
Sie lächelte verständnisinnig, zeigte mit der Hand nach der Tür des Boudoirs hin und nickte. –
Ich wollte diese Zwischenzeit benutzen, um mir bei Herrn von Blaschy dessen Schützengrabenofen anzusehen. Aber ich läutete vergeblich. Während ich noch vor seiner Tür stand, kam der Hauswart die Treppe herauf.
„Da werden Sie wenig Glück haben, Herr Doktor. Der Herr von Blaschy ist fast nie daheim,“ meinte er. „Und eine Bedienung hält er sich auch nicht, wenigstens keine eigene. Der schwarze Teufel von Steiners, die Maruschka, bringt ihm die Wohnung gegen hohe Bezahlung mit in Ordnung.“
Er kniff das eine Augen zu und fuhr leiser fort:
„Mein Geschmack wäre die Maruschka ja gerade nicht. Aber – Temperament hat sie sicher!“ – –
Als ich wieder bei Maklakows nach einer Weile vorsprach, war dem Oberst nichts mehr anzumerken.
Ich benutzte dann einen gute Gelegenheit während des Unterrichts, Maklakow den Polen Panszinski als Lohndiener zu empfehlen. Er erwiderte, er würde an den Mann denken.
Nachher machte es sich ganz von selbst, daß wir auf Blaschy zu sprechen kamen. Der Oberst wußte, daß dieser sich bei allerlei Wohltätigkeitsbestrebungen beteilige und fragte, ob ich Blaschy persönlich kenne und was für ein Mensch diese „herausgeputzte Ruine“ eigentlich sei.
So konnte ich denn auch die Ofengeschichte unauffällig vorbringen, erwähnte, daß Blaschy seine Erfindung kostenlos der Heeresverwaltung überlassen, sie aber vorher einem höheren Militär vorführen möchte.
Maklakow biß wirklich an.
„Da soll der Herr doch zu mir kommen,“ meinte er. –
Kurz vor acht Uhr abends war der Unterricht zu Ende.
Ich mußte mich sehr beeilen, wenn ich mir noch vor Ladenschluß etwas zum Abendbrot einkaufen wollte. Aber das Geschäft war nicht weit entfernt, in dem ich Kunde war – sicher einer der schlechtesten, da ich mich stets mit ein paar Scheiben Aufschnitt begnügte.
Auf dem Rückwege traf ich vor unserem Hause den Briefträger. Es war ein altes Männchen, der nur jetzt im Kriege noch zu diesem Austragsdienst verwendet wurde. Das Treppensteigen wurde ihm schon höllisch sauer. So fragte ich ihn denn, ob ich nicht die Postsachen für die einzelnen Mietparteien mitnehmen könne. „Ich wohne ja doch unterm Dach,“ meinte ich, und muß also ohnehin die vier Treppen hinauf.“
Er hatte nur zwei Briefe. Einen für Oberst Maklakow und einen für Blaschy.
Der für Blaschy bestimmte hatte einen blaugrauen Umschlag mit dem Aufdruck einer Papierfabrik und kam aus der nächsten größeren Stadt. Er war recht dick und schwer. Durch Befühlen glaubte ich feststellen zu können, daß er ein flaches Pappschächtelchen enthielt. Der Umschlag war nur durch eine Klammer verschlossen.
Ich habe mich dann einer Verletzung des Briefgeheimnisses schuldig gemacht. Das Schreiben für den Oberst wanderte in den richtigen Kasten, den zweiten Brief aber nahm ich mit in meine Stube hinauf.
Weshalb ich das tat? – Weil der Aufdruck der Papierfabrik auch die Worte: „Spielkarten in einfacher und feinster Ausführung“ enthielt.
Spielkarten!! Ich hatte die Pik-Neun doch noch nicht vergessen.
Wie ein Dieb schloß ich meine Tür ab, hängte sogar noch ein Tuch über das Schlüsselloch.
Dann öffnete ich die Klammer, hob die Briefklappe und zog ein in weißes Papier eingewickeltes Päckchen heraus, um das ein Gummiband gelegt war.
Das Umschlagpapier zeigte keinerlei Aufdruck, nichts – nichts. Darin lag ein neues … Spiel Karten, – – Karten mit der mir nun schon weidlich bekannten blau abgetönten Schmetterlings-Rückseite.
Ich stieß unwillkürlich einen leisen Pfiff aus.
Das hatte ich doch nicht zu finden erwartet …!!
Wieder begegneten mir diese verd… Karten!
Ich hielt einzelne gegen das Licht, so, daß die Rückseite grell beleuchtet war.
Ah – dieselben matten Zahlen und Zeichen, – genau wie auf jener Pik-Neun …!! Und hier hatte jede Karte ihre kaum wahrnehmbare Aufschrift – jede …!
Ich schrieb die Zahlen und Zeichen schnell der Reihe nach von jedem Kartenblatt ab. Dann packte ich das Spiel sorgfältig wieder ein, schlich die Treppe hinab und warf den Brief in Blaschys Kasten. – –
Ich hatte mir heute ja eigentlich vorgenommen, nachdem ich bei Steiners die harmloseste Aufklärung für das Treff-As und den Schreibblock erhalten, nie wieder meine Zeit mit ebenso fruchtlosen wie in ihrem Endergebnis beschämenden Kombinationen zu verschwenden.
Aber jetzt nach dieser neuen Entdeckung begann das Nachsinnen, das Suchen nach Schlußfolgerungen doch wieder.
Ich hatte das Papier mit den Zahlen und Zeichen, die ich von den zweiunddreißig Kartenblättern abgeschrieben, vor mir liegen und wollte das, was ich für eine Geheimschrift hielt, entziffern.
Die Mühe war vergeblich, und der hungrige Magen ließ mich endlich das Blatt Papier wegschließen und zu einer bekömmlicheren Tätigkeit übergehen: zum Essen! –
Gegen halb zehn klopfte es. Draußen stand Herr von Blaschy.
Ich empfing ihn, als ob ich das beste Gewissen von der Welt hätte.
Als ich ihm berichtete, daß Maklakow sich gern den Ofen ansehen wolle, drückte er mir dankbar die Hand.
Dann bat er, ich solle doch gleich heute mit dem russischen Unterricht beginnen.
„Damit es keine allzu dicke Lüge ist, die Sie dem Oberst über die Art, wie Sie von meiner Erfindung erfuhren, aufgetischt haben,“ meinte er. „Übrigens möchte ich wirklich ganz gern meine Kenntnisse der russischen Sprache auffrischen.“
Nun – ich war froh, etwas zu verdienen. Die Lebensmittel wurden infolge des Krieges immer teurer und ich … immer magerer.
Blaschy lernte auffallend schnell die richtige Aussprache. Etwas Vorkenntnisse besaß er ja.
Erst gegen elf Uhr verabschiedete er sich.
Ich hatte mir es schon, bevor er kam, bequem gemacht, und Hausschuhe und -rock angezogen.
Erstere streifte ich schnell ab, als ich ihn die Treppe hinabsteigen hörte, öffnete lautlos meine Tür, eilte bis zum Treppenflur und paßte auf, wo er eine Flurtür aufschließen würde – ob in der dritten oder der zweiten Etage.
Auch heute schaltete er die Nachtbeleuchtung nicht ein. Ich zählte die Stufen mit, die er hinabschritt. In der nächtlichen Stille hörte ich trotz der dicken Läufer genug, um mich nicht zu irren.
Zweiter Stock – ohne Frage! – – zweiter Stock!
Ich war wie versteinert.
Wieder begab sich Blaschy also zu so später Stunde zu dem Rentier – zu Helene!!
Eifersucht griff mit scharfen Krallen nach meinem Herzen – wildeste Eifersucht!
Und daher setzte ich mich auch auf die oberste Stufe und wartete, wann Blaschy wieder seine eigene Wohnung aufsuchen würde.
Es schlug draußen halb zwölf, zwölf, halb eins!!
Dann hörte ich unten die Haustür öffnen. Jemand kam nach Hause, kam höher und höher – zweiter Stock – dritter – vierter …
Da schlüpfte ich in meine Stube. – Es war der Pole.
Ich hatte schnell das Licht bei mir angedreht, meinen Rock und die Kleiderbürste ergriffen, und bearbeitete nun vor der offenen Stubentür das Kleidungsstück, indem ich leise dazu pfiff.
Panszinski rief mir zu:
„Noch so fleißig?! – Na – gute Nacht, Herr Doktor!“
„Gute Nacht! Sie sind mir aber ein Bummler!!“
Er lachte.
„Wir haben Kinoprobe mit nachfolgendem Schlußtrunk gehabt …!“
Auch ich ging zu Bett. Aber viel geschlafen habe ich nicht.
Die Frage, was Blaschy so spät noch bei Steiners trieb, lastete mir wie ein Alp auf der Brust.
Und an diese Frage reihten sich immer mehr.
War es zum Beispiel wirklich ein bloßer Zufall, daß der Rentier genau ein gleiches Spiel Karten besaß wie das, von dem ich heute die Zahlen und Zeichen abgeschrieben hatte …?!
Endlich schlief ich ein. Der Morgen graute schon. Aber als ich, erst gegen neun Uhr, munter wurde, da sah ich die Ereignisse des vergangenen Tages schon wieder in anderem Licht.
Helene hatte mir ja gestern wieder bei irgend einer Gelegenheit bestätigt, daß weder sie noch ihr Vater mit Blaschy von früher her bekannt seien.
Und Helene log nicht. Also mußte ich mich doch wieder verhört und verzählt haben. Natürlich, wenn die Eifersucht einen quält, können solche Sinnestäuschungen schon vorkommen …!!
9. Kapitel.
Als Gisela weinte.
Die Kapitel meines „Romans“, die ich gestern geschrieben habe, sind wirklich recht spannend. Ich habe sie mir soeben beim Morgenkaffee als Lektüre gegönnt.
Ich finde, ich werde immer mehr „routinierter“ Schriftsteller. Schade nur, daß sich die in diese meine schriftlichen Bekenntnisse gesetzte Hoffnung immer noch nicht erfüllen will. Und diese Hoffnung ging doch dahin, daß ich über den inneren Zusammenhang aller dieser meiner zum Teil doch recht seltsamen Erlebnisse und Beobachtungen jetzt endlich hier zwischen diesen vier Wänden meines Kerkers volle Klarheit gewinnen würde.
Ich fürchte fast, ich verbrauche ganz umsonst Bogen und Bogen Papier und viel Tinte, Zigaretten und Zigarren. Rauchmaterial gehört bei mir nämlich auch zu den Schreibutensilien.
Ich will mich daher jetzt auch kürzer fassen, zumal meine Geschichte sich ihrem Ende nähert.
Der Peiniger ist auch heute bisher nicht erschienen, obwohl es schon zehn Uhr vormittags ist.
Merkwürdig! Und kam er doch meist dreimal am Tage. – Ob er etwa erst die Schreibmaschinenabschrift meines Romans genau durchstudiert oder auswendig lernt …?! – –
Ich werde also wieder an die Arbeit gehen.
* * *
Nach jenem ereignisreichen Tage trat eine längere Ruhepause ein, in der nichts wesentliches geschah.
Helene sah und sprach ich selten. Sie war jetzt viel mit Gisela Maklakow zusammen, und meist fuhr jetzt Maruschka den alten Herrn Steiner in den Park.
Ich merkte: die Geliebte wich mir aus!
Wie sehr litt ich darunter – namenlos! – aber ich verargte es ihr nicht. Ich sah ein, daß diese Liebe aussichtslos war. Und zu einer Liebelei gab ein Mädchen wie Helene sich nicht her. –
Der Oberst hatte sich Blaschys Ofen angesehen und die Erfindung mit höflicher Umschreibung für „noch nicht ganz gebrauchsfähig für Heereszwecke“ erklärt.
Immerhin war der frühere Gutsbesitzer auf diese Weise mit Maklakows bekannt geworden. Mir fiel jedoch bald auf, daß er sich eigentlich bei seiner heißen Liebe für Gisela um diese weit weniger als um Frau Melitta, die schöne Verschwenderin, kümmerte.
Oder huldigte auch er der Ansicht, daß man erst die Mutter erobern müsse, wenn man es auf die Tochter abgesehen hatte …?! –
Zu dem Herrenabend, an dem Panszinski so gern bei Maklakows Lohndiener spielen wollte und schließlich auch dank meiner Empfehlung spielte, hatten auch Blaschy und ich Einladungen erhalten.
Es waren außer uns nur Offiziere da, sogar zwei Generäle. Wir beiden Zivilisten paßten in den Kreis nicht recht hinein. Die Herren sprachen, was ja so nahelag, zumeist über den Krieg. Da störten wir nur. Blaschy verabschiedete sich denn auch bald. Ich blieb nur, weil Gisela, mit der ich schon ganz kameradschaftlich stand, mich mit Beschlag belegte, ins Musikzimmer nahm und hier mit mir über alles mögliche plauderte. Frau Melitta hatte sich frühzeitig zurückgezogen. Sie war jetzt meist recht gereizter Stimmung. Nur Blaschy brachte sie durch seine Schnurren zum Lachen. Im Erzählen witziger Geschichten war er Meister. –
Ich bin nun auf meine äußere Erscheinung gewiß nicht eingebildet, obwohl ich auf der Straße oft genug merke, daß Frauenaugen mich mit besonderen Blicken streifen. Der Spiegel sagt mir auch, daß ich zu einer schlanken Gestalt das habe, was man einen Charakterkopf nennt. – Aber an jenem Herrenabend der Maklakows tauchte zum erstenmal die Vermutung in mir auf, daß Gisela wärmer für mich empfinden könnte, als ich es bisher ahnte.
Wie dieser Gedanke bei mir zur Entstehung gelangte? – Ja, – das waren viele Kleinigkeiten, die mir auffielen, mich erst stutzig machten und daher veranlaßten, Giselas Benehmen mir gegenüber kritischer zu betrachten.
Ich merkte, daß sie mich immer so prüfend ansah, wenn wir damals im Musikzimmer von Helene sprachen.
Als ich Helene einmal etwas sehr begeistert lobte, traten ihr Tränen in die Augen, und ihr Mund zuckte schmerzlich. – –
In der Stille meiner Dachstube habe ich dann nach jenem Herrenabend noch lange bei einer Zigarre über Gisela nachgedacht. – Ich mochte sie gern, so, wie man eine Schwester liebt, die einem besonders nahesteht.
Und weiter habe ich mich gefragt, was es wohl sein kann, das mir, dem doch eigentlich Frauen gegenüber so unbeholfenen Menschen, gleich die Herzen dieser zwei frischen, lieben Geschöpfe zugewendet hat. Ich besann mich da auf eine Äußerung Maklakows, der mir etwa folgendes bei irgend einer Gelegenheit sagte:
„Ihnen, Doktor, braucht man nur in die Augen zu sehen, um sofort zu wissen, daß Sie ein hochanständiger, gediegener Charakter sind. Selten sah ich Augen von so sprechendem Ausdruck wie die Ihren. In diesen Augen liegt Ihre Seele, und – in Ihrer Stimme die Reinheit und Güte Ihres Herzens.“
Ich war damals verlegen wie ein Backfisch geworden, als er mich so herausstrich. Immerhin: der Oberst ist ein guter Menschenkenner, und vielleicht sind es wirklich meine Augen und meine Stimme gewesen, die mir die Zuneigung Helenes und Giselas einbrachten. – –
Nach dem Herrenabend vergingen abermals drei Wochen, ehe sich etwas ereignete, was erwähnenswert wäre.
Dann aber folgten aufregende Vorgänge geradezu Schlag auf Schlag.
Bevor ich aber über diese drei letzten Tage vor meiner Verhaftung einen kurzen Überblick gebe, muß ich doch noch einschalten, daß ich, obgleich mein Mißtrauen gegen den Polen und Blaschy wegen der geheimnisvollen Spielkarten sich nicht mehr beschwichtigen ließ und mich zu steter Wachsamkeit veranlaßte, keinerlei Beobachtungen machte, die die Dinge irgendwie klärten. Panszinski und Blaschy spielten weiter die einander völlig Fremden. Letzterer war häufig in Gesellschaft Frau Maklakows zu sehen, ohne daß er sich um Gisela besonders kümmerte. Die russischen Stunden bei mir behielt er bei und bezahlte dafür so reichlich, daß ich zunächst das Geld ablehnte. Er drängte es mir schließlich halb mit Gewalt auf.
Mein Verhältnis zu Helene und Gisela blieb beinahe dasselbe. Ich sage absichtlich „beinahe“. Einige Male hatte ich in diesen Wochen vor den drei Entscheidungstagen Gisela im Park getroffen, wo ich auf Helene umsonst wartete. Wir waren dann zusammen durch die Maienpracht des nahenden Sommers gegangen, und ich hatte Gisela sehr wohl angemerkt, wie glücklich sie war, mit mir allein sein zu können.
Dann kam der erste der drei Tage, der Auftakt des Verhängnisses, das über mich hereinbrach.
Ich hatte mir morgens gegen acht wie immer meine Brötchen zum Kaffee geholt, als mir auf dem Rückwege der Oberst begegnete. Er schien es sehr eilig zu haben und war sehr aufgeregt. Seine Blässe fiel mir schon von weitem auf. Er stürmte an mir vorüber, grüßte kaum, blieb dann aber plötzlich stehen und rief meinen Namen.
Nun stand er mir gegenüber. – Wie verstört er aussah …!!
„Hören Sie, Herr Doktor, tun Sie mir bitte den Gefallen und gehen Sie sofort zu meinen Damen. Bestellen Sie ihnen, daß ich ihnen sagen ließe, wenn sie nicht über die Geschichte schweigen, so …“
Er brach mitten im Satz ab und fügte, mit der rechten Hand herumfuchtelnd hinzu:
„Nein – lassen Sie es lieber! Ich danke Ihnen schön. – Guten Morgen!“
Er rannte schon weiter.
Man muß Oberst Maklakow so kennen, wie ich auf Grund des russischen Unterrichtes, um auch so überrascht, so entsetzt zu sein, wie ich es nach dieser Begegnung war.
Maklakow hatte ich bisher nur ein einziges Mal erregt gesehen – besser gehört: als er mit seiner Frau die laute Szene im Boudoir hatte. – Sonst nie. Er war die Ruhe selbst. Gerade diese überlegene Gelassenheit hatte ich stets an ihm bewundert. – Was mußte wohl geschehen sein, um ihn so völlig zu verändern …?!
Ich dachte an Frau Melitta, die schöne Verschwenderin. Natürlich! Das mußte es sein …!! Die ehemalige Sängerin hatte wieder Schulden gemacht oder vielleicht wieder ein wertvolles Schmuckstück … „verloren“ …! –
Mittags traf ich dann Gisela oben in der Mansarde. Sie hatte gerade nach der auf dem Trockenboden hängenden Wäsche gesehen.
Sie war verweint. Ich wagte nicht zu fragen, was ihr fehle. In der großen Hausschürze sah sie reizend aus.
Wir wechselten nur wenige Worte. Ganz plötzlich brach sie ohne jede unmittelbare Ursache in Tränen aus.
Als sie so fassungslos schluchzend vor mir stand, überkam mich ein großes Mitleid mit diesem zu Lebensfrohsinn und Heiterkeit geradezu vorbestimmten jungen Weibe, dem doch die unglückliche Ehe der Eltern die besten Jahre des Lebens verdarb. Wie sehr Gisela unter den unglücklichen Verhältnissen in ihrer Familie litt, hatte ich längst erkannt, obwohl sie es stets tapfer zu verbergen suchte.
Ich nahm ihre beiden Hände in die meinen und sprach ihr Trost zu.
Wie es kam, weiß ich nicht. Mit einem Male lag ihr Kopf an meiner Brust, ich streichelte ihr das schöne, volle Haar und küßte sie sogar auf die Stirn.
Da schien sie zur Besinnung zu kommen, machte sich hastig los und floh, über und über rot, die Treppe hinab. –
Nach dem Kaffee besuchte mich gegen fünf Uhr nachmittags Herr von Blaschy und erzählte mir, er wolle auf ein paar Tage verreisen, eine Bergtour machen. Der Unterricht müsse also vorläufig ausfallen. –
Zwei Stunden darauf kam das Stubenmädchen von Maklakows mit einem Briefe. Der Oberst schrieb, er könne wegen dringender Arbeiten bis auf weiteres keine Stunden mehr nehmen.
Das Mädchen sagte noch zu mir: „Bei uns steht heute alles auf dem Kopf, Herr Doktor! Weshalb, weiß ich nicht.“
Damit war ich wieder allein.
Nicht für lange. Ein Dienstmann brachte mir ein Schreiben eines Majors v. Z.; ich solle sofort zu ihm kommen. Er wolle seine beiden Söhne von mir unterrichten lassen, die, wie er heute festgestellt habe, gerade in den Hauptfächern in der Schule ganz ungenügendes leisteten.
Bei Herrn v. Z. blieb ich bis gegen zehn Uhr abends.
Als ich wieder daheim war, glaubte ich aus verschiedenen kleinen Anzeichen schließen zu dürfen, daß irgend jemand meine Abwesenheit dazu benutzt hatte, um meine sämtlichen Behältnisse zu durchwühlen.
Diese Entdeckung beunruhigte mich nicht wenig. –
Am folgenden Tage traf ich Helene im Park. Sie saß jedoch nicht auf unserer alten Bank. – Ich wollte sie freudig begrüßen. Aber sie war kalt und ablehnend.
„Ich bitte Sie, lassen Sie mich allein, Herr Doktor,“ sagte sie, ganz fremd tuend. „Ich habe Kopfweh und kann mich nicht unterhalten.“ –
Nachmittags gewann ich dann die Gewißheit, daß zwei wie Arbeiter gekleidete Leute auf der Straße stets hinter mir blieben.
Mir war diese Verfolgung gleichgültig. Mich bewegte nur der eine Gedanke: weswegen hat dich Helene heute so schlecht, so kalt behandelt …?! – –
Dann brach der dritte Tag an.
Gegen Mittag begegnete ich Gisela in der Villenkolonie. Als sie mich sah, ging sie schnell in ein Geschäft hinein. Es war ein Zigarrenladen …!! Also wollte sie nicht mit mir zusammenkommen.
Da wurde ich stutzig, da tauchte plötzlich eine ungewisse Vorahnung in mir auf, daß sich über meinem Haupte ein Gewitter zusammenballte.
Ich schlich bedrückt nach Hause. Heute waren nicht zwei Arbeiter, sondern zwei Soldaten hinter mir her – wie getreue Wächter oder … wie Häscher …
Unlustig gab ich nachher meine Stunden. Ich war zerstreut. Und das Herz war mir schwer vor Weh …
Helene … Helene …!!
Und abends – abends wurde ich dann verhaftet, im Auto weggebracht. Wohin? – Ja, wenn ich das ahnte …!!
* * *
Eigentlich ist mein „Roman“ jetzt aus.
Jedenfalls weiß ich nichts mehr hinzuzufügen, was ich erlebte, als ich noch frei war.
Aber ich gedenke diese Aufzeichnungen doch fortzusetzen. Sicherlich werde ich hier in diesen Mauern ja mancherlei durchmachen …
2. Teil.
Treff-As.
1. Kapitel.
Major Dallström.
Die letzten Sätze des ersten Teiles von „Ein Spiel ums Leben“ hatte ich ziemlich eilig niederschreiben müssen, weil einer der Würdigen mir bereits das Mittag gebracht hatte.
Und – oh Wunder! – als ich gespeist hatte, da öffnete der Würdige sogar den Mund. Er fragte, ob er meine schriftlichen Aufzeichnungen vielleicht für den Herrn, der die Untersuchung führe, mitnehmen dürfe. Dieser lasse darum bitten.
Wirklich – der Würdige sagte: bitten. – Ja, man war hier zu dem Manne, dem der Galgen drohte, außerordentlich höflich.
Trotzdem wollte ich mich so etwas an dem Peiniger für die anfangs so endlosen Verhöre rächen.
„Ah – der Herr wünscht mein Manuskript,“ meinte ich lächelnd. „Wahrscheinlich, um davon auch das, was noch nicht mit Schreibmaschine vervielfältigt ist, ebenso abschreiben zu lassen.“
Der Würdige wurde rot, erwiderte aber nichts.
Ich gab ihm den blauen Deckel mit dem „Roman“ und legte mich dann auf das alte, bequeme Ledersofa, um ein paar Stunden zu schlafen. Ich fühlte mich nämlich doch recht abgespannt. Wenn man beim Schreiben einer Geschichte alles nochmals so deutlich miterlebt wie ich, kostet das Nerven.
Ich sollte nur zu bald geweckt werden. Jemand rief mich an.
„Herr Doktor – Herr Doktor!“ Dann rüttelte auch eine Hand meine Schulter.
Schlaftrunken schreckte ich empor. Es dauerte eine Weile, ehe ich ganz munter wurde.
Der Peiniger stand vor mir.
„Entschuldigen Sie, Herr Doktor, daß ich Sie gestört habe,“ begann er noch liebenswürdiger als sonst, ja beinahe vertraulich. „Aber die Sache, derentwegen ich komme, duldet keinen Aufschub.“
Jetzt erst sah ich an der Tür einen der Würdigen mit dem großen Anrichtebrett in den Händen, darauf die weiße Porzellankaffeekanne, all das übrige und … zwei Tassen, zwei …!!
Der Würdige mußte dann den Kaffeetisch eilig decken und nachher verschwinden. – Wir waren allein, der Peiniger und ich. Wir saßen uns gegenüber. Er füllte die Tassen.
„Trinken Sie, Herr Doktor. Ich habe den Kaffee heute extrastark aufbrühen lassen. Wir werden beide eine Anregung für unser Hirn brauchen,“ sagte er. Er hatte tadellose Umgangsformen. Man hätte ihn trotz des Zivilanzuges für einen höheren Offizier halten können.
Ich leerte zwei Tassen hintereinander, reichte ihm dann die Zigarettenschachtel.
„Bitte, Herr …“ Ich dehnte dieses „Herr“ absichtlich. Ich wollte ihn zwingen, die Maske zu lüften.
Und er tat’s, erhob sich halb vom Stuhl, verbeugte sich etwas und sagte:
„Major Dallström, – von der Nachrichtenabteilung des Kriegsministeriums.“
Ich hatte keine Ahnung, was das war – Nachrichtenabteilung. Das klang so etwas die Pressebureau.
Immerhin war ich einen gewaltigen Schritt vorwärtsgekommen. Ich wußte, wer der Peiniger war. Aber diesen Namen soll er nicht mehr führen. Er hat ja nur seine Pflicht getan. –
Der Major schob seine Tasse beiseite. Bisher hatten wir tatsächlich nur die Sätze bzw. Worte gewechselt, die ich hier angeführt habe. Dann zündete er sich eine Zigarette an, nachdem er mir vorher das brennende Streichholz gereicht hatte.
„Herr Doktor,“ begann er sehr verbindlich, „ich bin nun doch zu einer anderen Ansicht über Sie gelangt. Ihrem Roman haben Sie das zu danken. Um aber ganz sicher zu gehen: wollen Sie mir Ihr Ehrenwort geben, daß alles, was in dem Manuskript steht, buchstäblich wahr ist?“
„Ich gebe es,“ erwiderte ich ohne Zögern.
Da streckte er mir die Hand über den Tisch hin.
„Ich glaube Ihnen. Und von jetzt an sind wir Verbündete, wenn Sie es wollen,“ meinte er ernst.
„Verbündete? Gegen wen? Zu welchem Zweck?“
„Um die Leute zu strafen, die Sie auf eine schier teuflisch raffinierte Art an diesen Ort gebracht haben.“
„Und – wo ist das?“
„Das alte Kloster vor der Stadt, das erst während des Krieges für militärische Bureaus hergerichtet wurde.“
Bisher war ich ganz ruhig geblieben. Nun packte mich aber doch eine seltsame Erregung. Ich ahnte, daß ich bald frei sein würde. Und mein erster Gedanke war … Helene!! Ich würde Helene wiedersehen …!
Da sprach Major Dallström schon weiter:
„Zuerst hielt ich Ihre Bekenntnisse für einen sehr schlauen Versuch Ihrerseits, mich auf eine falsche Fährte zu locken. Aber je weiter Sie mit Ihrer Arbeit kamen, desto stutziger wurde ich. Ich besitze vielerlei Erfahrungen und bin wohl auch ein schwer zu täuschender Menschenkenner. – Ihre Aufzeichnungen hatten nun zwei besondere Eigenschaften, die mir allmählich auffielen. Einmal machten sie in überzeugender Weise den Eindruck des Selbsterlebten, dann aber waren sie so eigenartig, daß ich mir sagte, die Phantasie eines Privatlehrers, selbst wenn er nebenbei noch andere gefährliche Dinge treibt, hätte nicht ausgereicht, all diese Einzelheiten zu erfinden. Kurz: ich habe Ihren „Roman“, Herr Doktor, schließlich nicht als Phantasieerzeugnis, sondern als wahre Erlebnisse gewürdigt und geprüft; vor einer Stunde auch die letzten Seiten, die Schilderung der vier Tage vor Ihrer Verhaftung. Und da habe ich, so hoffe ich, endlich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begebenheiten, die Ihnen noch immer unklar sind, herausgefunden, freilich nur deshalb, weil ich eben wußte, an welcher Stelle ich den Faden aufzunehmen hatte, um diesen Knäuel zu entwirren.“
Ich lehnte mich weit über den Tisch. Meine Stimme zitterte leicht, als ich fragte:
„Herr Major, – darf ich nun endlich erfahren, was man mir vorwirft? – Ich fiebere förmlich, ich bin so verwirrt von alldem, was hier jetzt geschieht, daß ich …“
„Beruhigen Sie sich, lieber Doktor,“ unterbrach er mich herzlich. „Es liegt für sie jetzt kein Grund mehr vor zu irgend welchen Befürchtungen. – Also Sie ahnen noch immer nicht, daß … daß ich Sie für schuldig des … Landesverrates hielt …?!“
„Landesverrat …?!!“ Ich saß einen Augenblick wie erstarrt da. Dann war es mir, als nähme mir jemand eine Schleierbinde von den Augen, als sähe ich plötzlich all meine Erlebnisse in ganz anderer Beleuchtung.
Aber zu langem Nachdenken ließ mir der Major keine Zeit, da er bedächtig fortfuhr:
„Ich will Ihnen reinen Wein einschenken, Doktor. Hören Sie. – Schon seit einiger Zeit merkten wir Militärs, daß Rußland über so ziemlich alles, was unsere Heeresleitung an Neuigkeiten einführte oder in strategischer Hinsicht plante, unheimlich gut unterrichtet war. Einzelheiten will ich hier aus bestimmten Gründen übergehen. Jedenfalls deutete eine Unmenge für uns sehr schädlicher Vorfälle darauf hin, daß in unserem Lande Spionage in ebenso großzügiger wie schlauer Weise getrieben wurde. Nach vieler Mühe gelang es uns dann festzustellen, daß es sich offenbar um einen förmlichen Geheimbund von Spionen handelte, der, aufs glänzendste von einer Zentralstelle aus geleitet, seine Mitglieder in allen Garnisonstädten und auch dicht hinter der Front sitzen hatte. Einige Male hofften wieder schon, diese gefährliche Bande unschädlich machen zu können. Aber leider: griffen wir zu, und wir taten’s stets mit aller Vorsicht und nach langen Vorbereitungen – so war’s stets, als haschten wir nach Nebelgebilden. Nichts blieb in unseren Händen, nichts – nichts! Es war, als ob wir gegen Gespenster kämpften. – In der Hauptsache lag uns natürlich daran, hinter die Organisation dieser Leute zu kommen und herauszubringen, wo sich die Zentralstelle befand, nach der alle Fäden des weitverzweigten Netzes zusammenliefen. Wir haben alles versucht, was in unseren Kräften stand. Und wir besitzen in solchen Dingen große Routine, verstehen es, Schlingen zu legen, in denen auch der Klügste sich fangen muß. Ein ungeheurer Apparat von erfahrenen und erprobten Beamten war an der Arbeit. Jede Behörde mußte mithelfen – jede! Galt es doch das Wohl des Vaterlandes, die Erfolge unseres Heeres! – Aber anderseits mußten wir auch, wie ich schon andeutete, überaus vorsichtig zu Werke gehen. Die, denen wir nachstellten, durften nicht ahnen, daß der Kampf gegen sie schon begonnen hatte.“
Der Major machte eine kurze Pause und zündete sich eine Zigarre an.
„Anfang April dieses Jahres,“ fuhr er dann fort, „hatten wir endlich einen ganz, ganz winzigen Erfolg zu verzeichnen. Wir ermittelten drei Personen in der Nachbargarnison, die zweifellos mit zu der Spionenbande gehörten, aber anscheinend nur ganz untergeordnete Rollen spielten. Wir hüteten uns natürlich, sie zu verhaften, ließen sie vielmehr Tag und Nacht beobachten und ihren Briefwechsel überwachen. Aber – wir kamen trotz allen Eifers nicht von der Stelle, gewannen nur immer mehr die Überzeugung, daß wir es mit Gegnern zu tun hatten, die … schlauer als wir waren. Nur eins brachten wir durch die stete Aufmerksamkeit, die wir den dreien schenkten, heraus: die Zentralstelle des Geheimbundes, dieser Musterorganisation von Spionen, konnte sich nur hier in unserer Stadt befinden. Wir verlegten daher unsere Haupttätigkeit nach hier. Doch – ebenso gut hätte ich mich auch mit meinem zahlreichen Stabe von Beamten zur Sommerfrische ins Gebirge begeben können. Dort hätten wir genau so viel oder so wenig Neues entdeckt – eben nichts! – Und dabei erfuhren wir, daß der russische Generalstab schon wieder in den Besitz von Geheimnissen gelangt war, die wir ganz sicher verborgen zu haben glaubten …!! Ich war dem Verzagen nahe. Meine Vorgesetzten warfen mir Unfähigkeit vor. Ich sollte einem anderen Platz machen, von dem man besseres erwartete. – Ich bin nicht ehrgeizig, Herr Doktor, wirklich nicht. Aber mich beiseiteschieben zu lassen, obwohl ich meine Pflicht bis zum äußersten getan hatte, – das machte mich fast trübsinnig. Aber – das Schicksal wollte nicht, daß ich meinen Posten verlor, an dem ich mit ganzer Seele hing. Die … Menschenjagd ist ja vielleicht ein besonderer Geschmack. Aber für mich gibt es nichts, was größere Reize hat, als meine Verschlagenheit mit der anderer zu messen. Und dieser Umschwung trat an dem Tage ein, als Sie, Herr Doktor, dem Oberst, den Sie in Ihrem „Roman“ Maklakow genannt haben, morgens in so verstörtem Zustande begegneten.“
2. Kapitel.
Die Beweise meiner Schuld.
Dallström schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein.
„Sie sehen, Doktor, mich selbst regt die Geschichte sogar jetzt noch auf,“ meinte er und trank die Tasse mit einem Zuge aus.
„Doch weiter. – Der Oberst wird hier im Stabsgebäude mit den wichtigsten Arbeiten beschäftigt. Er ist Leiter einer Abteilung, in der man so ziemlich alles weiß, was bei dem obersten Heereskommando vorgeht. – Maklakow – bleiben wir bei dem Phantasienamen – hatte nun ein Schriftstück von größter Bedeutung für die für den Herbst geplanten Operationen mit nach Hause genommen, um es dort in aller Ruhe durchsehen zu können. Er schloß es stets in den kleinen Stahlschrank ein, der in seinem Arbeitszimmer stand und zu dem er den Schlüssel stets mit anderen zusammen an einem Ringe vereint bei sich trug. An jenem Morgen, als er so verstört war, hatte er nun zu seinem Entsetzen festgestellt, daß das Schriftstück fehlte, daß es über Nacht aus dem Schranke verschwunden war. In seiner ersten Aufregung teilte er Frau und Tochter das Furchtbare mit. Deshalb hatte Gisela auch so verweinte Augen, als Sie sie vor dem Trockenboden mittags trafen. Sie konnte sehr wohl ermessen, welche Folgen dieses Unglück für ihren Vater nach sich ziehen mußte. Maklakow setzte mich sofort persönlich von dem Vorgefallenen in Kenntnis. Ich begleitete ihn in seine Wohnung, nahm auch zwei meiner besten Beamten mit. Wir stellten fest, daß der kleine Tresor mit einem Nachschlüssel geöffnet und der Dieb durch das eine Fenster vom Dache aus ins Zimmer gelangt war. Ich fragte Maklakow nun genau aus, wer als Täter in Frage käme beziehungsweise wer dem Täter Nachricht gegeben haben könne, daß ein wichtiges Aktenstück gerade jetzt in dem Schranke liege. Sie wissen, Doktor, wie ich zu fragen und zu forschen verstehe, haben mich ja deswegen auch „den Peiniger“ getauft. – Jedenfalls brachte ich schnell heraus, daß Sie bei Maklakows häufig genug im Arbeitszimmer des Hausherrn allein gewesen, daß Sie durch das Spitzentuch russischer Lehrer Maklakows geworden waren, also immerhin auf eine nicht alltägliche Weise, hinter der ich sofort einen fein ausgeklügelten Plan witterte. Jedenfalls waren Sie der einzige Mensch, gegen den ich sofort Verdacht schöpfte. Ich ließ Sie daher am Abend durch einen Beamten, den ich einweihte, durch den Major v. Z., aus Ihrem Zimmer für zwei Stunden entfernen. Sie wissen – Sie sollten neue Stundenschüler erhalten. In diesen zwei Stunden wurde Ihre Stube durchsucht und zwar so, wie nur meine Beamten dies verstehen. – Wissen Sie, was wir fanden? – Oh – nicht nur die Zeichnung der Rückseite der Pik-Neun und die Abschrift der Zeichen und Zahlen von dem an Blaschy adressierten Kartenspiel, – weit, weit mehr! – Unter Ihrem Fenster war außen unterhalb des weit vorspringenden Gesimses ein Mauerstein gelockert und sauber wieder eingefügt worden. Er verdeckte so eine Höhlung, in der wir außer einer sehr beträchtlichen Summe Geldes auch ein Päckchen Zettel, bedeckt mit einer Geheimschrift, sowie drei Depeschen fanden, die letztens einem Stabsoffizier, den man im Eisenbahnzuge betäubt hatte, abgenommen worden waren. Bleiben Sie sitzen, lieber Doktor! Ich begreife Ihr Erstaunen. Ja, ja – ich sagte schon: Sie sind das Opfer raffinierter Ränke geworden. Meine Beamten hüteten sich, irgend etwas von diesen Dingen mitzunehmen, ließen vielmehr alles an Ort und Stelle. Sie haben trotzdem gemerkt, daß Ihre Sachen durchstöbert worden waren, nachher auch, daß Sie ständig beobachtet wurden. Ich selbst stand nun vor der schwierigen Frage, was sollte ich mit Ihnen anfangen? – Verhaften oder in Freiheit belassen, um durch Ihre stete Überwachung festzustellen, mit wem Sie verkehrten, was Sie trieben und so weiter. Daß ich in Ihnen ein hervorragendes Mitglied der Spionenbande vor mir hatte, stand bei mir fest. Aber gerade deswegen, eben weil ich fürchtete, Sie könnten, wenn ich mich Ihrer Person nicht versicherte, noch mehr Unheil anrichten, ohne daß wir imstande waren dies zu verhindern, entschloß ich mich, Sie … verschwinden zu lassen. Kein Mensch sollte wissen, wo Sie geblieben waren, und Ihre Verbündeten daher ebenfalls völlig ahnungslos sein, was mit Ihnen geschehen war, so daß sie auch annehmen konnten, Sie seien im Interesse der Sache des Bundes verreist. Nun – Ihre unauffällige Verhaftung glückte uns tadellos. Die Zeitungen der Stadt erörtern noch heute in langen Notizen das Verschwinden des Privatlehrers Doktor Alexander Werra, und die Kriminalpolizei sucht Sie aufs eifrigste. Die Öffentlichkeit hat ja nichts von dem Diebstahl des Schriftstückes aus Maklakows Tresor erfahren, auch die Polizei nicht, so daß niemand in der Lage ist, diese beiden Ereignisse miteinander in Verbindung zu bringen. Die ersten Verhöre mit Ihnen bestärkten dann bei mir den Eindruck, daß ich einen überaus wertvollen Fang gemacht hatte. Gerade weil Sie so vorzüglich meiner Ansicht nach den völlig Harmlosen spielten, hielt ich Sie für doppelt gefährlich. Mir mußte nun daran liegen, Sie womöglich zu einem umfassenden Geständnis zu bewegen. Dabei verfolge ich seit langem besondere Methoden. Und mit hierzu gehörte, daß Sie dieses Zimmer erhielten, gut verpflegt und behandelt wurden. – Ich versuchte dann weiter durch Drohungen, durch stundenlanges, ermüdendes Ausfragen und auch durch Zusicherung von hohen Summen und milder Bestrafung Sie gefügig zu machen. Alles umsonst! Plötzlich begannen Sie dann Ihren „Roman“ zu schreiben. Erst hielt ich Sie für leicht übergeschnappt, als ich die ersten fertigen Seiten las. Dann aber, je mehr ihre merkwürdigen Aufzeichnungen an Umfang zunahmen, glaubte ich wieder, wie schon erwähnt, an eine bestimmte Absicht, die Sie mit der Niederschrift Ihrer für mich damals noch fein ausgeklügelten Erlebnisse verfolgten. Schließlich gelangte ich jedoch zu einer besseren Überzeugung. Und um Ihr Manuskript in aller Ruhe prüfen zu können, ließ ich es abschreiben. Diese Abschriften – es waren gleichzeitig vier Durchschläge gemacht worden – gab ich auch den tüchtigsten meiner Beamten zur Begutachtung. Auch sie erklärten mir, wir hätten vielleicht doch „den Falschen gegriffen“, zumal wir ja, was sie sehr betonten, inzwischen festgestellt hatten, daß die in dem Mauerloche gefundenen Zettel zwar eine Chiffreschrift enthielten, aber offenbar eine, die keinen Sinn hatte und nur zur Irreführung durch wahlloses Aneinanderreihen von Buchstaben und Zahlen hergestellt war, während im Gegensatz hierzu das für Blaschy bestimmt gewesene Kartenspiel auf der Rückseite der einzelnen Blätter nach der bei Ihnen gefundenen Abschrift zu Mitteilungen in einer wirklichen Chiffreschrift benutzt worden war – zu Mitteilungen von größter Tragweite, die aber doch nicht besagten, wo wir weitere Mitglieder der Spionenbande zu suchen hätten. Schließlich wiesen meine Beamten noch darauf hin, daß Sie, lieber Doktor, diese Abschrift der Kartenspiel-Benachrichtigungen nie und nimmer so offen in eine Schublade eingeschlossen haben würden, wenn Sie gewußt hätten, um was es sich dabei handelte. – Nun, es gab also eine solche Menge von Beweisen für Ihre tatsächliche Harmlosigkeit, nachdem wir Ihren „Roman“ erst richtig gewürdigt, daß beschlossen wurde, in aller Eile einmal zunächst nachzuforschen, ob dieser Herr von Blaschy aus X. stammte, wie er in der polizeilichen Anmeldung angegeben hatte. Das sollte sozusagen die Stichprobe sein, ob wir Ihnen vertrauen dürften oder nicht. Depeschen flogen hin und her, und … der Erfolg war überraschend. In X. hatte es einen Gutsbesitzer von Blaschy allerdings mal gegeben, der war aber seit Jahren verschollen. Es sei ein kleiner, unansehnlicher Herr gewesen, mit stark alkoholischen Neigungen und dementsprechender Nase, der jetzt, wenn er noch lebe, 72 Jahre alt sein müsse. Na – Ihnen geht wohl schon ein Licht auf, lieber Doktor: wir standen vor der Tatsache, daß Ihr Blaschy der echte Blaschy nicht war. Und das genügte uns! Sie sind nun also frei, Herr Doktor Werra, und können, wenn Sie darauf bestehen, dieses Zimmer sofort verlassen. Ich sage: wenn Sie darauf bestehen. Ich bitte Sie nämlich im Interesse unseres Landes, freiwillig noch so lange hier zu bleiben, bis wir das Netz, das wir jetzt der Spionenbande stellen werden, zuziehen können. Erscheinen Sie jetzt wieder in dem Hause, das Sie „das Haus der Rätsel“ – mit gutem Recht – genannt habe, so würden die, die den Verdacht auf Sie gelenkt haben, um selbst nicht beargwöhnt zu werden, sich sofort sagen, daß diese Freilassung besondere Gründe haben müsse und daß sie selbst nun vielleicht in Gefahr seien. Ihre Rückkehr in Ihr Heim, lieber Doktor, wäre also sicherlich eine Warnung für die Häupter des Spionenbundes, die – das ist meine felsenfeste Überzeugung – gerade in Ihrem Hause zu suchen sind. – Nochmals: ich darf Sie hier nicht mehr festhalten, aber ich hoffe, daß Sie als guter Patriot noch weiter den halben Gefangenen spielen werden.“
Ich dachte an Helene – und zögerte mit der Antwort. Die Sehnsucht nach ihr war übermächtig geworden, seit ich mich frei wußte.
Doch der Patriot siegte. Ich streckte dem Major die Hand hin und sagte:
„Gut – ich bleibe, so lange Sie es für nötigt halten, wenn Sie vielleicht auch begreifen werden, was mich am meisten nach dem Rätsel-Hause hinzieht.“
Dallström drückte meine Finger kraftvoll und sah mich ernst, fast traurig an.
„Helene?“ fragte er leise.
Ich nickte. Er kannte ja mein Herzensgeheimnis aus meinem „Roman“.
Da sagte er, indem er an mir vorbei sinnend auf die brennende Petroleumlampe blickte:
„Wissen Sie noch, was Sie gleich in den ersten Zeilen Ihres Manuskriptes geschrieben habe…? – Etwa folgendes: „Die Uhren sind jetzt im Kriege unzuverlässig wie … die Menschen. Wem soll man noch trauen?“ –“
Dann erhob er sich schnell und ging mit einem „Auf Wiedersehen“ hinaus.
Ich aber schaute ihm nach wie einem bösen Geist.
„… unzuverlässig wie … die Menschen …!!“ Hatte er damit etwa Helene gemeint …?!
3. Kapitel.
Ein Frühlingsrausch.
Seine Bemerkung hatte jede Spur von Freude über diese glückliche Wendung, über den Nachweis meiner Schuldlosigkeit, in mir schnell wieder ausgelöscht.
Ich saß da und grübelte, hörte kaum, daß einer der Würdigen kam, das Kaffeegeschirr abräumte, ein Paket Zeitungen vor mich hinlegte und mich verschiedentlich ansprach – ohne Antwort zu erhalten.
Ich grübelte und betrachtete alles, was ich erlebt und was mit Helene zusammenhing, mit ganz anderen Augen, mit denen eines Untersuchungsrichters, der sich nicht durch ein schönes Lärvchen weiter täuschen läßt.
Mir wurde ganz wirr in Kopf. – Hatte ich nicht so und so oft Helene schon für eine Heuchlerin gehalten, und hatte immer wieder nur die Liebe solche Gedanken verscheucht, übertönt …?!
Ich sprang auf, rannte im Zimmer auf und ab.
Nein, rief mir mein Herz zu, – nein, so – so kann ein Weib nicht lügen …! Ein Weib, das ich doch in den Armen gehalten und geküßt, das doch mit heißen Lippen meine Zärtlichkeiten erwidert hatte …!!
Ich ertrug diesen Zustand der Ungewißheit nicht länger.
Die Tür war halb offen geblieben – die innere. Die äußere war eingeklingt. Ich trat in den Flur hinaus. Es war ein gewölbter Klostergang. Er war leer. Kein Mensch zu sehen. Ich rief. Niemand kam.
Da riß ich am Glockenzug. Und gleich darauf stürzte diensteifrig einer der Würdigen herbei.
„Ich will Major Dallström sprechen – sofort!“
„Bedauere, Herr Doktor. Der Herr Major ist nach der Stadt gefahren und kommt erst abends wieder. Er läßt Ihnen noch bestellen, Sie möchten aufbleiben. Er würde wohl erst gegen zehn zurück sein.“
Ich war bitter enttäuscht. – Da – ein Gedanke.
„Wie heißen Sie? Sind Sie ebenfalls Beamter der Nachrichtenabteilung des Kriegsministeriums?“
„Jawohl, Herr Doktor. Mein Name ist Angern – Kommissar Doktor juris Angern.“ Er lächelte etwas.
Also hatte ein Doktor juris einem Doktor der Philosophie das Zimmer gesäubert und die Mahlzeiten gebracht.
„Haben Sie meinen „Roman“ gelesen, Herr Angern?“ fragte ich, nachdem wir uns die Hand gereicht hatten.
„Ja. Ich gehöre zu den Vertrauten des Majors.“
Das hieß: zu den besten Beamten. – Er drückte es nur bescheidener aus.
„Wie denken Sie über Fräulein Steiner?“ fragte ich zögernd.
Er zuckte die Achseln und meinte:
„Hat der Major Sie nicht schon so etwas vorbereitet? Wenn nicht, so dürften Sie vielleicht noch heute Abend genauen Aufschluß erhalten. Der Major beabsichtigt, Panszinski in aller Stille sofort verhaften zu lassen. Der Pole dürfte am leichtesten zum Verrat an seinen Genossen zu bewegen sein. Er ist Spieler. Und Jeuratten lieben das blanke Gold über alles.“
Ich sank in den nächsten Stuhl. Mir gellte der eine Satz förmlich in den Ohren: „Hat der Major Sie nicht schon so etwas vorbereitet …?“
Vorbereitet … vorbereitet auf die Enttäuschung, daß … Helene eine … Verbrecherin war …! – Nur das konnte Angern ja meinen …!! –
Als ich nach einer Weile aufblickte, war der Kommissar leise hinausgegangen. Er war ein zartfühlender Mensch … –
Ich nahm meine Aufzeichnungen vor und begann sie langsam von Anfang an zu lesen, wollte prüfen, was ich darin an Schuldbeweisen gegen Helene jetzt finden würde, nachdem mir die Augen endlich gründlich geöffnet worden waren.
Daß Panszinski, Blaschy, die beiden Steiner und auch Maruschka unter einer Decke steckten, war sicher.
Panszinski hatte mir seine Bekanntschaft richtig aufgedrängt, als er sich damals Hammer und Nägel holen kam, mir vier Tage später die billigen Nahrungsmittel anbot und mich dann sogar durch die Abschrift der Rolle Geld verdienen ließ. Er war sicherlich beauftragt gewesen, mich auf Herz und Nieren zu prüfen, ob ich für die weiteren Pläne des Bundes ein taugliches Objekt war.
Und die Bekanntschaft mit Helene? – Es war so leicht herauszubringen, daß ich stets dieselbe Bank im Park benutzte. Diese Bank hatte uns dann ja auch zu … Freunden gemacht …! – Dann die Geschichte mit Steiners Erkrankung und Maruschkas Versehen, die Blaschy statt meiner geholt hatte! – Natürlich alles Lug und Trug! – Oh – was war ich nur blind gewesen!! Alles Schwindel, um den späten Besuch Blaschys bei Steiners harmlos zu erklären. Und denselben Blaschy hatte Helene nachher mir gegenüber als faden, taktlosen Gesellen gezeichnet!! Alles Absicht – alles! In Wirklichkeit ging Blaschy als guter Freund und Mitspion bei Steiners aus und ein – wenn auch nur nachts! Das hatte ich ja genugsam belauscht! – –
Weiter damals die Szene im Park, als der Kranke über unsere vorzeitige Rückkehr so sehr erschrak. Der Alte hatte einfach mit dem Fernglas den Exerzierplatz beobachtet und sich Notizen über die Übungen der Soldaten gemacht. –
Ich Narr – ich verliebter Narr – wie geschickt hatten Vater und Tochter gleich am Nachmittag jeden in mir vielleicht aufsteigenden Argwohn zu zerstreuen gewußt!! – Skataufgabe, Benutzung der eigentümlichen Karten, von denen ich das Treff-As im Parke gesehen hatte, und des Schreibblocks für diese Skataufgabe, – wie harmlos …!! Und um mich ganz einzulullen, folgten die Küsse im Nebenzimmer …!! –
Und Helene hatte sich mit Gisela natürlich auch nur zu dem Zweck angefreundet, um mit dem Oberst bekannt zu werden, dort in der Wohnung verkehren und Gelegenheit zur Spionage auszukundschaften zu können. –
Schließlich noch ihr Verhalten in den letzten Tagen vor meiner Verhaftung …!! Welch’ Abgrund von Verworfenheit!! Sie hatte gewußt, was mir bevorstand, – daß alles vorbereitet war, um mich ins Verderben zu stürzen. Sie brauchte mich nicht mehr für die Zwecke der Bande – und wurde kühl und ablehnend, sagte sich von mir los, warf mich wie ein abgenutztes Werkzeug beiseite …!!
Das war also die wahre Helene, – das – das!
Mir graute jetzt fast vor ihr. Und unwillkürlich fuhr ich mir mit dem Handrücken über die Lippen, als wenn ich auch die letzten Spuren ihrer Küsse fortwischen wollte …
Der Rausch dieser kurzen Liebe war verflüchtigt – ganz und gar. Ich wunderte mich selbst, daß ich jetzt auch nicht den geringsten Schmerz über das klägliche Ende dieser Leidenschaft empfand. Ich konnte an Helene mit einemmal wie an eine Wildfremde denken, die mir nie nahegestanden hatte, die mich jetzt nur als … raffinierte Spionin interessierte.
War das also wirklich echte Liebe gewesen …?! War’s nicht nur ein Aufflackern eines heißen Gefühls, das der Frühling mit seinem Zauber und meine Einsamkeit mir halb vorgetäuscht hatten …?! –
Weg mit den Gedanken! Helene ist für mich erledigt. – Wenn es Dallström doch nur gelingen würde, die ganze Bande gründlich unschädlich zu machen …!!
4. Kapitel.
Panszinskis Geständnis.
Major Dallström kam früher, als ich vermutet hatte. Etwa um neun Uhr schon. Und nicht allein. Die beiden Würdigen und noch ein dritter, mir unbekannter Mann betraten gleichzeitig mein Zimmer. „Zelle“ paßt jetzt nicht mehr. Ich war ja frei und hier im alten Kloster nur noch Staatspensionär oder Gast sozusagen.
Den dritten, es war ein gebückter, ärmlich gekleideter Alter mit wirrem, grauem Bart – stellte mir Dallström, nachdem wir uns begrüßt hatten, mit den Worten vor:
„Hier der Mann, lieber Doktor, den Sie Wladislaw Panszinski genannt haben, – in einer seiner vielen Verkleidungen. Wenn man Kinoschauspieler ist, versteht man sich darauf; und wird man mal so schön vermummt abgefaßt, so kann man sich leichter unter Hinweis auf eine Filmaufnahme irgendwie herausreden, was die künstliche Veränderung des Äußeren anbetrifft.“
Ich hätte Panszinski nie von selbst erkannt. – Der Major brachte in seine Worte eine gewisse Verachtung hinein, die deutlich herauszumerken war.
Wir nahmen dann alle Platz, worauf Dallström fortfuhr:
„Ich habe Panszinski ehrenwörtlich Straffreiheit und eine gewisse Summe zugesagt, wenn er uns restlos das ganze Treiben seiner Genossen verrät. Er ist auch bereit, sich seine Freiheit auf diese Weise zu erkaufen.“
„Man hat nur ein Leben zu verlieren, Herr Major,“ warf der Pole ein. „Und bei mir ging’s sicher um das Leben.“ Er suchte so seinen Verrat zu entschuldigen.
Dallström beachtete die Zwischenbemerkung nicht weiter.
„Bitte, beginnen Sie,“ meinte er befehlend. „Aber fassen Sie sich kurz, Herr!“
Ich will nun hier von dem Gespräch des Polen nur das erwähnen, was zur Aufklärung der Vorgänge im Rätsel-Haus dient, und allen Personen die Namen lassen, die ich ihnen in meinem Roman gab.
Der Spion berichtete folgendes:
„Unsere Organisation wurde von einer Frau, einer russischen Adligen, geleitet. Der Herr Doktor kennt sie als die angebliche Tochter des gelähmten Herrn. Die Befehle an die Mitglieder wurden durch Spielkarten übermittelt, deren Rückseite ganz unauffällig beschrieben war. Jedes Mitglied – wir waren zweiunddreißig – hatte eine bestimmte Karte, mit der es bezeichnet wurde. Namen wurden nie genannt. Ich war Pik-Neun, unser Oberhaupt Treff-As. Zu einer Besprechung bestellte man uns stets durch Zusendung unserer Spielkarte, die dann nur noch Zeit und Ort enthielt. Zum Beispiel bedeutete für mich eine Pik-Neun mit den Zahlen: 11, +, 1, 17 –, daß ich mich um elf Uhr abends bei Treff-As – As galt 1 – am 17. des betreffenden Monats einzufinden hätte. – Wir wußten nun, daß der Oberst Maklakow in sehr wichtige Dinge stets eingeweiht war. Deshalb bezogen wir auch das betreffende Haus: der Kranke mit seiner Tochter, Blaschy, ich und die Maruschka. Größte Vorsicht in allen Dingen war bei uns oberstes Gebot. Daher mußte ich auch den einzigen Junggesellen, der im Hause wohnte und der mit Steiners und Blaschy gleichzeitig eingezogen war, um jeden Preis näher kennen lernen. Ein alleinstehender Herr konnte immer ein Spitzel oder Geheimbeamter sein, besonders wenn er, wie Sie, Herr Doktor, einen so harmlosen Beruf zu haben schien. Nun, ich hatte sehr bald die Überzeugung erlangt, daß wir Sie nicht zu fürchten brauchten, mehr noch, daß es vielleicht sogar möglich war, Sie als Werkzeug für unsere Pläne zu benutzen. Als ich letzteres der Frau mitteilte, die dank ihrer hervorragenden geistigen Fähigkeiten sich wie selten ein Mensch zum Oberhaupte einer solchen Organisation eignete, wußte sie sehr bald auch selbst Ihre Bekanntschaft zu machen, um auch ihrerseits festzustellen, inwieweit Sie, Herr Doktor, sich nach Ihrer ganzen Charakterveranlagung für unsere Zwecke eigneten. Helene Steiner, unser Treff-As, war dann sofort entschlossen, Sie uns, ohne daß Sie es ahnten, dienstbar zu machen und durch Ihre Vermittlung zunächst Blaschy und mir unauffällig Zutritt zu der Wohnung Maklakows zu verschaffen. Hierzu war nötig, eine Verbindung zwischen Ihnen und der Familie des Obersten herzustellen. Maruschka hatte nun auf der Treppe ein Spitzentüchlein gefunden, und dieses Tüchlein wurde Ihnen in die Hände gespielt. Es war ein bloßer erster Versuch, ob diese Brüsseler Arbeit, die Maruschka – nebenbei bemerkt stammt sie aus bester Familie und spielte bei Steiners nur im Interesse der Sache die Köchin – sofort als äußerst wertvoll erkannt hatte, Beziehungen zwischen Ihnen und Maklakows anbahnen würde. Es gelang. Ja – Sie wurden sogar der Lehrer des Obersten und kamen fast täglich in dessen Arbeitszimmer. Und auf diese Tatsache baute unser Oberhaupt sofort einen neuen Plan auf, der nichts anderes im Auge hatte, als Sie als Spion hinzustellen, falls Maklakow einmal merken sollte, daß sein Tresor noch anderen zugänglich war.“
„Ein Teufel von Weib!!“ sagte Major Dallström laut.
Panszinski nickte. „Sehr richtig bemerkt, Herr Major. Ein Teufel, ein schöner Teufel, und natürlich eine Komödiantin, die die Kunst der Verstellung in der Vollendung verstand. Wir alle haben sie gefürchtet. Ihr entging nichts, nichts! – Doch zurück zu meinem Bericht. – Blaschy und ich kamen durch Sie, Herr Doktor, wirklich in die Wohnung des Obersten. Erster als Erfinder des famosen Schützengrabenofens, ich als Lohndiener. Und an jenem Herrenabenden bei Maklakows habe ich von dem Schlüsselloch des Panzerschränkchens dann Wachsabdrücke genommen und auch den Verschluß des einen Fensters des Arbeitszimmers so hergerichtet, daß er sich auch von außen öffnen ließ. Nebenbei verfolgte Blaschy aber noch seine besonderen Absichten in der Familie des Obersten. Nicht auf Fräulein Gisela hatte er es abgesehen, oh nein! Das sagte er nur Ihnen, Herr Doktor, weil er annahm, daß ein Verliebter dem anderen eher helfen würde. – Kurz: wir hatten – und auch dieser Gedanke stammte von unserem weiblichen Oberhaupte her – an die verschwenderische, in ständigen Geldnöten befindliche Frau Melitta, die ehemalige Sängerin, als geheime, von uns bestochene Verbündete gedacht. Die Frau war für eine halbe Million – und was kam es uns auf Geld an!! – sicher zu allem fähig. – Ich will nun gleich hier einschalten, daß wir es bisher nicht nötig gehabt haben, uns die Bereitwilligkeit dieser Dame zu kleinen Diensten zu erkaufen. Frau Maklakow ahnt heute noch nicht, weswegen Blaschy ihr so ein wenig den Hof machte. Ich sage: wir hatten es nicht nötig! Der Tresor im Arbeitszimmer des Obersten, den ich jetzt jede Nacht, vom Dache aus ins Zimmer gelangend, mit einem gut gearbeiteten Nachschlüssel aufschloß, um von wichtigen, dort verwahrten Papieren stenographische Abschriften zu fertigen, lieferte uns so reiche Ausbeute, daß wir vorläufig auf die Mithilfe Frau Melittas verzichteten. Dann kam der Tag, besser die Nacht, wo uns das Glück verließ. Ich hatte im Tresor ein Aktenstück von allergrößter Wichtigkeit vorgefunden. Es stellte eine Beute dar, die Millionen wert war. – Ich nahm es mit auf meine Stube in die Mansarde und begann es abzuschreiben. Aber es war zu umfangreich. Ich durfte schließlich nicht länger zögern, es an Ort und Stelle zurückzubringen, ehe der Morgen graute und meine Kletterpartie unmöglich machte. Ich merkte mir den Inhalt des nicht abgeschriebenen Restes möglichst genau und wollte dann gerade meine Strickleiter wieder benutzen, als ich noch in letzter Minute zwei Telegraphenarbeiter bemerkte, die auf dem Nachbardach einen sicher sehr dringlichen Schaden am Telephonleitungsnetz ausbesserten. Der Weg zum Zimmer des Obersten war mir abgeschnitten, und nur dieser Umstand war schuld daran, daß Maklakow morgens das Aktenstück vermißte. Ich meldete die Sache sofort Treff-As, – Helene Steiner. Sie schickte Blaschy mit dem Aktenstück in die Nachbargarnison zu einem anderen Mitgliede des Bundes. Von dort sollte Blaschy ins Gebirge zu einer kurzen Vergnügungstour, damit die Reise nicht auffiel. Inzwischen hatte ich schon längst unter Ihrem Fenster, Herr Doktor, und zwar in der Außenwand ein Versteck angelegt, in das außer einer großen Geldsumme auch scheinbar chiffrierte Mitteilungen und ein paar Depeschen hineingelegt worden waren. Banknoten in solcher Höhe mußten Sie, als armen Hauslehrer ja ebenso verdächtig machen wie mit Chiffren bedeckte Zettel und gestohlene Depeschen. Wir rechneten damit, daß diese Sachen bei einer Haussuchung bei Ihnen sicher gefunden werden würden. Und der Verlauf der Dinge zeigte, wie richtig unser Oberhaupt alles berechnet hatte. Auf Sie, der Sie im Arbeitszimmer Maklakows so oft allein waren, lenkte sich sofort der Verdacht, das Aktenstück gestohlen zu haben. Das merkte ich schon am Abend desselben Tages, als der Diebstahl entdeckt wurde, da ich beobachtete, daß Sie auf der Straße heimlich überwacht wurden. Und zwei Tage später erfolgte dann Ihre Verhaftung.“ –
Das, was Major Dallström dann noch durch Fragen von Panszinski erfuhr, will ich aus bestimmten Gründen hier teilweise nicht erwähnen. Jedenfalls genügte aber das Geständnis des Polen vollauf, nun die ganze Bande unschädlich zu machen. Auch das Geheimaktenstück konnte noch abgefangen werden, bevor es ins Ausland gelangte.
Über seine Person hüllte Panszinski sich jedoch in hartnäckiges Schweigen. Aber sowohl sein Benehmen als auch seine Ausdrucksweise, die er heute nicht wie früher absichtlich denen der untersten Volksschichten anzupassen suchte, verrieten den Mann von guter Erziehung und beträchtlicher Weltgewandtheit.
Dallström verlangte im Laufe dieses halben Verhörs von dem Polen auch näheren Aufschluß über Steiners und Blaschy.
Die Antwort Panszinskis verdient hier wörtlich wiedergegeben zu werden.
„Herr Major,“ sagte er mit einem seltsamen Lächeln, „es steht Ihnen hinsichtlich dieser drei Personen noch eine große Überraschung bevor, die ich Ihnen nicht verderben möchte. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, was die Verhaftung der drei und auch Maruschkas anbetrifft, so schlage ich folgendes vor …“
Wie er sich die Sache dachte und warum er Dallström die „große Überraschung nicht verderben“ wollte, geht aus dem Schluß meines „Romans“ hervor.
5. Kapitel.
Helenes letzte Mahnung.
Die erste Nacht, die ich wieder als freier Mann, wenn auch noch in einer Zelle in dem alten Kloster, zubrachte …!!
Ich sage absichtlich „zubrachte“, nicht etwa „durchschlief“, – denn geschlafen habe ich nach dem Tage mit all seinen Aufregungen sehr, sehr wenig. Und war ich wirklich einmal eingeschlafen, so weckten mich wilde Traumgesichte sofort wieder auf. In all diesen Träumen spielte Helene eine Rolle, – Helene, wie ich sie jetzt kannte. Sie erschien mir, mit irgend einer Waffe in der Hand, jagte mich vor sich her, – ich wähnte mich dem Tode verfallen … Da tauchte Gisela als meine Retterin auf …
Und dieser Traum wiederholte sich mit den mannigfachsten Veränderungen.
Ich war froh, als durch die eisernen, jetzt nur angelehnten Fensterläden die Sonne ins Zimmer lugte und ich aufstehen konnte. –
Um elf Uhr kam Major Dallström. Er brachte einen Mann mit, der sich als Friseur entpuppte und der mir einen üppigen blonden Bart vorkleben und mit Hilfe von Schminke mein ehrliches Antlitz noch weiter unkenntlich machen mußte. Der Friseur gehörte zu Dallströms Beamten. Ein Fremder hätte plaudern können.
Während dieser Mann mich in Arbeit hatte, erzählte mir der Major, daß die vier Leute im Hause der Rätsel noch heute Vormittag verhaftet werden sollten.
„Das Haus ist ständig beobachtet worden. Steiners sind vor zehn Minuten in den Park gegangen – oder gefahren, wie man es ausdrücken will. Blaschy bleibt vormittags regelmäßig zu Hause. Von seiner Bergtour ist er längst wieder zurück. – Draußen wartet ein verschlossenes Auto auf uns, das uns an unser Ziel bringen soll. Ein Dutzend von meinen Beamten befinden sich bereits in allerlei Verkleidungen im Hause.“ – So sprach Dallström; und er rauchte dabei seelenruhig eine Zigarette nach der andern.
Wir beide und Doktor Angern waren punkt halb zwölf vor dem Hause der Rätsel – vor meinem Hause. Wir stiegen aus, gingen an der Loge des Hauswarts vorüber, dessen großes, starkknochiges Weib gerade die Treppenläufer bürstete. Die Frau erkannte mich nicht.
Mit recht eigenartigen Empfindungen stieg ich die Stufen empor. In den Zeitungen stand zu lesen, der Doktor Werra müsse einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein; anders sei sein Verschwinden nicht zu erklären. – Und dieser selbe Herr stand jetzt mit zwei anderen vor Blaschys Flurtür.
Der Major läutete. Nach dem dritten, endlosen Schrillen der Flurglocke öffnete sich die Tür. Maruschka, die Zigeunerin, empfing uns. – Herr von Blaschy sei vor kaum zehn Minuten ausgegangen, sagte sie.
„Wir sind die Herren von der städtischen Baukommission,“ meinte der Major. „Wir wollen den baulichen Zustand der einzelnen Räume prüfen.“
Das war heller Blödsinn. Aber in solchen Dingen besaß Maruschka keine Kenntnisse. Sie glaubte an die Kommission.
Wir wußten genau, daß Blaschy daheim sein mußte, und waren daher erstaunt, als die angebliche Köchin, die ja auch dem Junggesellen die Wohnung in Ordnung hielt, uns ohne weiteres einließ.
In den elegant eingerichteten Räumen befand sich Blaschy tatsächlich nicht.
Im Speisezimmer winkte Dallström Doktor Angern mit den Augen zu. Der verstand, ging hinaus und kam mit zwei Arbeitern in blauen Blusen zurück.
Maruschkas Blicke verrieten jetzt schon eine gewisse Unruhe. Sie hörte auch, daß in den anderen Zimmern mehrere Personen leise hin und her eilten.
„Wo ist Herr von Blaschy?“ sagte der Major jetzt nochmals. „Lügen Sie nicht! Er kann nicht ausgegangen sein. Das Haus wird seit gestern abend so scharf bewacht, daß keine Maus ungesehen hinausschlüpfen kann.“
Maruschka wurde kreideweiß. Ihre Lippen bebten.
„Blaschy ist wohl bei Treff-As unten im zweiten Stock,“ meinte Dallström schneidend.
Da sank Maruschka vornüber in die Knie, rang die Hände und winselte … „Gnade … Gnade …!! Ich will alles gestehen …!“
Der Major lachte verächtlich auf.
„Panszinskis Kaliber!!“ sagte er zu mir. „Feige – käuflich …!“
Maruschka wurde gefesselt und geknebelt. Ohne jede Rücksicht auf ihr Geschlecht.
Wir nahmen ihr den Schlüssel zur Steinerschen Wohnung ab, gingen in die zweite Etage hinab und betraten das Heim des … Oberhauptes der Spionenbande.
Dallström beunruhigte es stark, wo Blaschy geblieben sein könne. Denn auch hier bei Steiners fanden wir ihn nicht, obwohl drei Beamte außer uns suchten. –
* * *
Eine halbe Stunde später hörten wir schwere Schritte die Treppe heraufkommen. Es waren der Hauswart und seine Frau, die wie immer den Gelähmten trugen, um ihn dann im Vorderzimmer neben dem kleinen Salon auf das Sofa zu setzen, bis sie auch den Krankenfahrstuhl nach oben gebracht hatten.
Wir standen jetzt im Salon hinter der nur angelehnten Tür. Hier hatte ich damals Helene geküßt …
Und jetzt …?! –
Wir hörten nebenan des Hauswarts Stimme:
„So, Herr Steiner. Da haben wir Sie glücklich wieder oben. Der Fahrstuhl kommt auch gleich.“
Jetzt Helenes Stimme, weich, einschmeichelnd wie immer:
„Lassen Sie ihn heute bitte unten. Bei dem schönen Wetter wollen wir auch nachmittags in den Park.“
Das Ehepaar verließ die Wohnung. Kaum war die Flurtür eingeschnappt, als Steiner auch schon mit gänzlich veränderter, sehr frischer und energischer Stimme sagte:
„Wo nur Panszinski stecken mag? Mich beunruhigt es stark, daß er gestern abend nicht wie befohlen erschien.“
Und Helene antwortete, – kalt, schneidend:
„Der Mensch ist ein Spieler. Und alle Spieler sind unzuverlässig. Es ist Zeit, daß er verschwindet – für immer. Unsere Sicherheit verlangt es. Jedenfalls mußt du gleich zu ihm hinaufgehen und sehen, ob er inzwischen nach Hause gekommen ist. Ich werde dir deine Sachen bringen, damit Blaschy wieder auferstehen kann.“
Sie ging nach dem Hinterzimmer.
Dallström drückte die Tür etwas auf.
Der Kranke stand vor dem zwischen den Fenstern hängenden Spiegel und nahm Bart und Perücke ab, rieb sich dann mit einem Tuche die Schminke vom Gesicht m…
Ich konnte sein Gesicht im Spiegel deutlich sehen.
Es war … Blaschy … Blaschy!!
Mir fiel es wie Schuppen von den Augen … – Niemals hatte ich Steiner und Blaschy gleichzeitig gesehen – niemals, – aus einem sehr einfachen Grunde: beide waren ein und dieselbe Person! – Also das war die Überraschung, auf die Panszinski uns vorbereitet hatte …!!
Wir hörten Helene zurückkommen.
Da stieß Dallström die Tür ganz weit auf. Und Doktor Angern blies in seine Trillerpfeife …
Einen Augenblick war Helene wie zur Salzsäule erstarrt.
Beamte drangen ins Zimmer, fesselten den Mann mit dem doppelten Gesicht. Und ich riß mir den falschen Bart ab.
„Ich glaube, das Spiel ist aus,“ sagte die, die ich einst geliebt hatte, kalt. Und ihre Stimme zitterte nur kaum merklich.
Und dann schnellte sie sich plötzlich nach der offenen Salontür hin, schlug diese hinter sich zu und drehte von innen den Schlüssel ab.
Aber keine fünfzehn Sekunden später hatten die Beamten die Tür schon eingedrückt.
Der Major und ich stürmten als erste in den Salon.
Helene stand ruhig vor dem Stahlstich – demselben Stahlstich, dessen weibliche Figur ihr so ähnlich sah. Ein rätselhaftes Lächeln spielte um ihren Mund.
„Herr Doktor,“ sagte sie laut und sah mich dabei lieb und gütig an, „ich bin eine Verbrecherin in Ihren Augen. Aber es gibt Verbrechen, die man für sein Vaterland begeht … Und, hören Sie auf meine Mahnung …“
Sie schwankte plötzlich. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Sie ruhte wieder an meiner Brust, … und sie flüsterte mit ersterbender Stimme mir zu:
„Gisela liebt Sie! … Sie sollen mit ihr glücklich werden … Leben Sie wohl … Ich … ich …“ – –
So starb Helene in meinen Armen, – in wenigen Sekunden …
„Gift!“ sagte Dallström leise. – –
* * *
Der Mann mit dem Doppelgesicht war Helenes Gatte … Er wurde gehängt. – –
Dallström verschaffte mir eine gute Stellung in einem Ministerium. Außerdem zahlte der Staat mir zum Dank für die endliche Unschädlichmachung des gefährlichen Spionenbundes eine hohe Summe aus.
Ich glaube, aus Gisela und mir wird wirklich sehr bald ein Paar werden. – –
Anmerkungen:
Täglich ging die wunderschöne
Sultanstochter auf und nieder
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern.
Täglich stand der junge Sklave
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern;
Täglich ward er bleich und bleicher.
Eines Abends trat die Fürstin
Auf ihn zu mit raschen Worten:
„Deinen Namen will ich wissen,
Deine Heimath, deine Sippschaft.“
Und der Sklave sprach: „Ich heiße
Mohamet, bin aus Yemmen,
Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.“
- ↑ In Deutschland wird diese Spielkartenfarbe als Kreuz bezeichnet, in Österreich hingegen fast ausschließlich in Anlehnung an die französische Bezeichnung als Treff. Der französische Name ist Trèfle (deutsch: Klee), das Kartensymbol stellt ein dreiblättriges Kleeblatt dar.
