Hauptmenü
Sie sind hier
Die Landstreicher

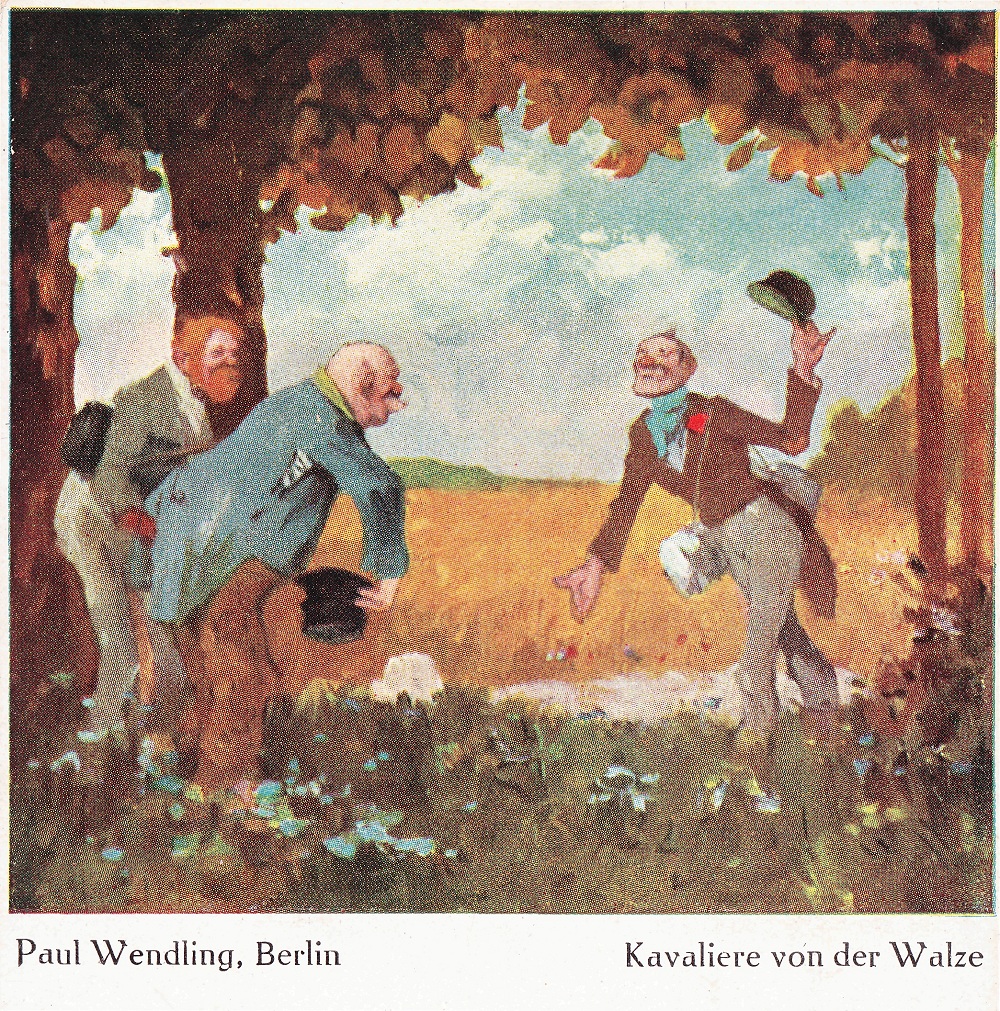
Vergiß mein nicht
Bibliothek der besten Romane
Band 325
Die Landstreicher.
Roman von
W. Lersa.
Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.
Dresdenerstraße 88–89.
Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.
Teil I
Sommernachtstraum.
1. Kapitel.
Der neue Schloßherr von Elgenstein gab ein Parkfest.
Sechzig Einladungen hatte er dazu ergehen lassen, an die Honoratioren der nahen Kreisstadt, die Geistlichen der umliegenden Dörfer und die Besitzer der Nachbargüter.
Dreißig Absagen waren gekommen. Der Adel hatte geschlossen diesem Herrn Hübner, der da vor einem Vierteljahr nach Ostpreußen gekommen war und gleich die Unverfrorenheit besessen hatte, überall Besuche zu machen, sehr deutlich gezeigt, daß man mit ihm keinen Verkehr wünsche. Nur der Bezirksoffizier der Kreisstadt, Major z. D. Graf Schalk Edler von Argelunxen, ließ sich durch den offenbar gut gefüllten Weinkeller des jetzigen Eigentümers des alten Rittergutes zu einem Abfall von der Gemeinschaft seiner Standesgenossen verleiten und sagte zu.
Die dreißig Erschienenen bedauerten es nicht, die Einladung angenommen zu haben. Herr August Hübner wußte es seinen Gästen recht behaglich zu machen, und Ellen Hübner, sein einziges Kind, verstand für die frühzeitig verstorbene Mutter in einer Weise die Hausfrau zu spielen, wie es selbst die Fürstin Loschau nicht besser konnte. So behauptete jedenfalls Bürgermeister Lankner. Und der mußte hierüber wohl ein Urteil haben, da er außer dem Kreisarzt und dem Amtsgerichtsrat der einzige war, der hin und wieder zu den Gesellschaften Ihrer Durchlaucht zugezogen wurde.
Um sechs Uhr nachmittags hatte das Parkfest begonnen. Die Dragonerkapelle aus der nächsten Garnison spielte auf der Terrasse vor dem Schloß. Und auf der weiten Rasenfläche des Vorplatzes hatte man unter den uralten Kastanien die Tische aufgestellt sowie einen gedielten Tanzplatz geschaffen.
August Hübner in hellem Sommeranzug mit weißer Weste und braunen Schnürschuhen – auf dem gedruckt Einladungen hatte es geheißen: „Bitte nicht Gesellschaftsanzug!“ – stand mit einigen Herren am Ufer des großen Parkweihers. Er war ein Mann, dem man die Fünfzig wahrhaftig nicht ansah. Ein straffer, etwas zu Fülle neigender Körper von über Mittelgröße trug einen Charakterkopf von so energischen Linien, daß schon die Kurzsichtigkeit – geistige wie wirkliche – der bei dem Landadel tonangebenden Gräfin Palwitzki dazu gehörte, um zu behaupten, der neue Besitzer von Elgenstein sehe wie ein plebejischer Emporkömmling aus.
Das Stadtoberhaupt von Schöneck, der bei Durchlauchts beinahe vollständig salonfähige Lankner – er war zweimal im Assessorexamen durchgefallen, aber Korpsstudent mit tadellosen Umgangsformen, was die Schönecks stets betonten – glaubte August Hübner, dem der bürgerlich Landrat des Kreises soeben eine Unmenge Schmeicheleien des wohlgelungenen, eigenartigen Festes wegen gesagt hatte, doch einen kleinen Dämpfer verabfolgen zu müssen und erklärte daher jetzt in sehr klug gewählten Worten, es sei doch sehr schade, daß die adligen Besitzer gerade heute sämtlich verhindert wären und sich nicht persönlich davon überzeugen könnten, wie schnell Herr Hübner das verwahrloste Schloß und den noch verwahrlosteren Park in wahre Schmuckkästchen umgewandelt hätte.
August Hübner, der noch vor einem halben Jahr eine recht bedeutende Konservenfabrik im Hannoverschen besessen hatte, streute die Asche seiner Importe mit einem Schwung des linken Armes in den Weiher und erwiderte gelassen:
„Ja, ich weiß sehr wohl, der hohe Adel will mich ‚schneiden’, wie man zu sagen pflegt. Meinetwegen! Ich habe den Herrschaften meine Aufwartung nur gemacht, weil ich doch nun einmal mit zu den Großgrundbesitzern des Kreises Schöneck gehöre. Im übrigen dränge ich mich niemandem auf. Die Intelligenz hat nicht abgelehnt, bei mir zu erscheinen. Das gleicht alles aus, selbst das Fehlen der Gräfin Palwitzki, die ja hier bei uns noch mehr vorstellen soll als ‚Ihre Durchlaucht’.“
„Intelligenz, – sehr gut, sehr gut!“ lachte der trinkfeste Direktor des Schönecker Gymnasiums. „Stimmt ja auch …! Unter den anwesenden vierzehn Herren sind kaum drei Nichtstudierte.
Das Gespräch wurde hier durch das Auftauchen Ellen Hübners unterbrochen, die wie immer ihren getreuen Verehrer, den Gerichtsassessor Schaumburg, neben sich hatte.
Ellen war ganz die Tochter ihres Vaters. Nicht gerade schön, mußte ihr doch der Neid lassen, daß sie gleichzeitig etwas echt weiblich Weiches und doch wieder auch Sicher-Selbstbewußtes im Auftreten, in Bewegungen und Sprache hatte. Mädchenhafter Reiz, lebensfrohe Munterkeit und die Sicherheit und Gewandtheit der großen Dame paarten sich bei ihr aufs glücklichste.
„Meine Herren – bitte zum Festplatz!“ rief sie schon von weitem. „In einer Viertelstunde beginnt die Vorstellung der Seiltänzertruppe …“
Vom Schloß schallte jetzt auch dreimal das langgezogene Trompetensignal herüber, das die Gäste wieder zusammenrief.
Bürgermeister Lankner und Gymnasialdirektor Schwengel schlossen sich als letzte den Vorausgehenden an.
„Schaumburg legt sich ordentlich ins Zeug bei Fräulein Hübner,“ meinte Lankner, der noch Junggeselle war, aber längst eingesehen hatte, daß er bei der reichen Erbin mit seinem Bierbäuchlein, den wässrigen Augen und der stark gelichteten Schädeldecke keinerlei Aussichten habe.
„Die beiden passen sehr gut zusammen,“ erklärte Schwengel. „Der Assessor ist reich, und Gold und Gold soll sich leichter gegenseitig anziehen als Gold und Kupfer.“
Lankner machte einen faulen Witz mit dem Wort ‚anziehen’ und fuhr dann fort:
„Worauf dieser Hübner nicht alles gekommen ist …! Selbst die Seiltänzer hat er irgendwo aufgetrieben.“
Daß das fahrende Volk sich mit seinen Künste bei Scheinwerferbeleuchtung in wechselnden Farben zeigen werde, ahnte der Bürgermeister noch nicht einmal. –
Als letzte Nummer der Truppe trat ein Schlangenmensch auf. Inzwischen war es ganz dunkel geworden, und das Licht des im Gebüsch hinter den Zuschauern aufgestellten Scheinwerfers wirkte jetzt, besonders in Violett, äußerst magisch.
Nicht nur die dreißig Gäste Hübners spendeten den Seiltänzern lauten Beifall. Nein, fast das ganze Dorf Elgenstein, das keine zehn Minuten vom Schloß entfernt in einer Bodensenkung lag, war mit Erlaubnis des Schloßherrn zusammengeströmt und erhielt sogar einige Erfrischungen in Gestalt belegter Brote, einer halben Tonne Bier, Zigarren für die Männer und billigen Süßigkeiten für die Frauen und Kinder. Kein Wunder, daß die ‚Galerie’, wie Lankner die Dorfeinwohnerschaft betitelte, am lebhaftesten Bravo rief und Beifall klatschte.
Landrat Müller, ausgerechnet einem ‚Müller’ hatte die Regierung den Kreis Schöneck anvertraut, in dem noch sogar ein Fürst neben sechs Grafen ansässig war!! – sagte jetzt zu dem neben ihm sitzenden Schwengel:
„Hübner versteht es, sich bei seinen Dörflern beliebt zu machen. Überhaupt ein Allerweltsgenie. Nur – hm, ja – sind Sie sich eigentlich schon über seine politische Gesinnung klargeworden?“
„Nein. Ist mir auch gleichgültig. Der Mann gefällt mir als Mensch. Ob er konservativ oder liberal wählt, – was geht es mich an! – Ah – sehen Sie, Herr Landrat, – das also ist die so geheimnisvoll angekündigte Extranummer …!! Wahrhaftig – eigenen Serpentintänzerin! Und mit schwarzer Seidenmaske vor dem Gesicht …!! Was bedeutet das …? Ob es kein Mitglied der Seiltänzertruppe ist …?“
Müller, der mehr wie ein Stabsoffizier in Zivil aussah, antwortete nicht.
„Donnerwetter!“ entfuhr es ihm nach einer Weile. „Donnerwetter … Das ist ja wirklich echte Kunst, ein Genuß …! Nein – dieser Hübner – dieser Hübner!!“
Und er wandte sich nach links, wo der Schloßherr neben der stattlichen, hübschen Landrätin saß.
„Hören Sie – wo haben Sie diese Schleiertänzerin aufgetrieben, Verehrtester? – Ich gebe zu, ich habe in Berlin auf diesem Gebiet vorzügliches gesehen und kann mir schon eine Kritik erlauben. Aber daß da – allerhand Achtung!“ – –
Ein Beifallssturm brach los, als der Scheinwerfer urplötzlich erlosch und die von zarten Schleiern umwallte Frauengestalt den gedielten Tanzplatz, wie ein Geist im Dunkeln forthuschend, verließ.
Dann flammten die auf dem Festplatz aufgestellten Bogenlampen wieder auf. Ein Hornsignal rief zur Tafel, die im Speisesaal des Schlosses gedeckt war.
„Schade,“ sagte Direktor Schwengel mit ehrlichem Bedauern zu Müller. „Das eben war geradezu zauberhaft schön. Die weiche Walzermusik, das Rauschen der Bäume und dieses geschmeidige Weib dazu … – Der reine Sommernachtstraum …“
2. Kapitel.
Im Norden des Schlosses zog sich die weite Heide hin. Hier und da standen einige Gebüsche, öffneten sich im Boden auch senkrecht abfallende Erdlöcher, deren Grund braunschwarzes Wasser bedeckte, Torfstiche, die nicht gerade das beste Brennmaterial geliefert hatten und nur von den ärmeren Dorfbewohnern mühsam ausgehoben wurden, um billige Feuerung zu gewinnen.
Der Sommerabend eines klaren Julitages lag über der Heide. Überall zirpten die Heimchen. Ein sanfter Wind fuhr säuselnd durch die Büsche und das hohe Heidegras. Wildenten fielen in die größeren Tümpel zur Nacht ein, Krähenschwärme zogen nach ihren Nistplätzen mit schweren Flügelschlägen. –
„Ich bedauere all die armseligen Menschenkreaturen, die sich in den Städten zusammenpferchen. Gibt es etwas Schöneres als solch einen Abend …? – Da – horch – die Musik beginnt wieder. Ah – ein Marsch! Das zuckt durch alle Glieder. Es geht doch nichts über Militärmusik …!“
Der Gefährte des Sprechers lauschte eine Weile. Der Wind brachte die Töne vom Schloßpark ziemlich deutlich mit. Dann meinte er grämlich, indem er mit dem Klappmesser sich eine Schnitte Brot mit Käse belegte:
„Das ist derselbe Marsch, nach dem bei uns die Isolde Margoni stets ihren Fuchswallach vorführte. Sie hieß eigentlich Rebekka Kohn und war ihren Eltern aus Kalisch entlaufen. Nachher endete sie hinter dem Zaun, als sie …“
„Hör’ auf, alte Unke! Die Geschichte kenne ich schon auswendig,“ unterbrach ihn der andere. „Verderb mir nicht die Sommerabendstimmung. – Du wirst wirklich alt. Erst vorgestern hast du mir dieselben Erinnerungen aus deiner Künstlerlaufbahn wieder aufgetischt und es doch bereits vergessen. In den zehn Jahren, die wir nun schon gemeinsam Brüder von der Landstraße spielen, mußte ich diese Rebekka Kohn und ihren Lebensroman mindestens hundertmal verdauen.“
Der ehemalige Zirkusklown grinste über sein ganzes, von unzähligen Falten durchfurchtes Gesicht. Er war sicher seine fünfzig Jahre alt und ebenso schäbig-vagabundengemäß gekleidet wie sein Gefährte.
„Die Geschichte der Isolde Margoni enthält so viel Lebensweisheit, daß du sie nicht oft genug vorgesetzt bekommen kannst, mein Sohn! Hätte sie damals auf mich gehört, so wäre sie heute eine brave bürgerliche Großmutter, die sich nur noch schwach an Zirkusparfüm und Blumenspenden und Brillanten mit daran hängenden frechen Wünschen erinnern kann.“
Der andere kaute an seiner Käsestulle. Er lag auf dem Bauch in der kleinen Lichtung des Gebüsches, während der Klown sich aus Torfziegeln einen Sitz dicht neben ihm errichtet hatte.
Die Lichtung zeigte mit der offenen Seite nach Süden, nach dem Schloß Elgenstein hin, dessen Turm über die Parkbäume hoch hinausragte. Sie war bereits als Lagerplatz für die Nacht hergerichtet. Moos und trockenes Gras hatten die beiden Tippelbrüder zu Lagerstätten aufgeschichtet. Der Inhalt ihrer aus zerlöcherten Pferdedecken zusammengebundenen Rucksäcke war hier und da verstaut. Und merkwürdig genug waren diese Dinge, die sämtlich aus dem Straßengraben oder von einem Kehrrichthaufen aufgelesen zu sein schienen. Aber den Vagabunden galten sie infolge jahrelangen Gebrauches mehr als die schönsten, neuesten Ersatzstücke, – falls ihnen jemand diese angeboten hätte.
Tobias Frick, der ehemalige Zirkusklown, nahm jetzt einen zerbrochenen Spiegel zur Hand und musterte prüfend die Bartstoppeln in seinem Gesicht.
„Ich sehe wie ein Raubmörder aus. Ich werde mich rasieren,“ sagte er und griff nach einer großen Zigarettenschachtel aus Blech, die sein Rasierzeug enthielt – und noch manches andere. Während er aus einer Feldflasche Wasser auf den Pinsel träufelte, fuhr er fort:
„Wo nur der Junge bleibt? Er ist schon zwei Stunden fort. Und es wird immer dunkler. Hoffentlich findet er unser Versteck.“
„Du bist ja mächtig besorgt um ihn, Tobias! Das ist doch sonst nicht deine Art,“ meinte der zum Stromer herabgesunkenen ehemalige Lehramtskandidat spöttisch.
„Besorgt?! Noch besser!! Ich möchte nur gern herauskriegen, was eigentlich hinter ihm steckt. Der tippelt jedenfalls noch nicht lange und hat auch mal bessere Tage gesehen, genau wie wir. Aber – wer ist er, und wie ist er auf die steile Rutschbahn geraten, die ihn auf der Landstraße absetzte …? Das will ich wissen. Und was ich mir vornehme, führe ich meistens auch durch.“
Gottfried Blendel stieß jetzt einen besonderen Pfiff aus. Die Käsestulle hatte er bereits vertilgt.
„Duckchen wird doch nicht etwa wieder einem Hasen nachjagen. Ich muß mal nachsehen, wo er bleibt,“ sagte er und stand auf.
Der Klown kicherte in sich hinein.
„Jetzt haben wir jeder unser Sorgenkind, Friedel. Du deinen Hund, und ich den Herrn Semper Nemo.“
„Ich ziehe Duckchen vor. Bei dem weiß ich, daß er treu und dankbar ist. Bei dem anderen soll’s erst die Zukunft lehren.“ Mit diesen Worten verschwand er hinter den Büschen.
Tobias Frick schaute ihm sinnend nach. In leisem Selbstgespräch bewegten sich seine Lippen. Das war so eine Eigentümlichkeit von ihm, laut zu denken.
„Auch er glaubt, er kennt die Geschichte der Rebekka Kohn …!! Lächerlich! Wie kurzsichtig er ist. – Sie wäre die ehrbare Großmutter gewesen, und ich der ebenso ehrbare Großvater …! Aber sie wollte höher hinaus. Und nichts ist von ihr geblieben als das Grab im Kirchhofswinkel und … vielleicht … vielleicht ihr Kind, falls es nicht auch verreckt ist … hinterm Zaun …“
Er seufzte tief auf.
Und der Pinsel fuhr eilfertig über das alte, faltige Gesicht hin, verwandelte es in eine mit Seifenschaum umrahmte Fratze.
Gerade als er mit dem Rasieren fertig war, hörte er Stimmen – die tiefe, knarrende Blendels und die hellere des jungen Semper.
Jetzt bog als Vortrab Duckchen, der grauschwarze Wolfspitz, in die kleine Lichtung ein. Dann kamen die beiden anderen.
Tobias Frick machte große Augen. Semper trug einen vollständigen Anzug über dem Arm, einen eleganten, staubgrauen Anzug samt Hut, Stiefeln und feiner Wäsche.
„Wo hast du das alles her?“ fragte der Klown mißtrauisch.
Semper Nemo, wie er sich nannte, lachte auf, wurde aber sofort wieder ernst.
„Ich stehle ebensowenig wie ihr,“ sagte er und warf die Sachen auf den Boden. Dann reichte er Tobias einen offenen Briefumschlag.
„Da – lies! Es geschehen heute wunderliche Dinge. Den Anzug fand ich am Rande eines großen Torfstichs dort weiter ostwärts. Auf dem feinen weichen Filzhut obenauf lag der Brief. Lies und staune, staune und bedaure, bedaure und verfluche diese verrückte Welt!“
Er warf sich in das Gras und stützte den Kopf in die rechte Hand.
Semper Nemo war schlank, und nicht ganz so zerlumpt wie seine Gefährten. Aber den Tippelbruder sah man ihm doch an. Sein mageres, sonnenverbranntes Gesicht war scharf geschnitten wie die Gemme eines römischen Nobile. Zu diesem Gesicht paßte das blonde Haar und der blonde, kurze Schnurrbart nicht recht. Sie hätten dunkel sein sollen wie die lebhaften Augen.
Tobias Frick hatte aus dem Umschlag – es war ein sehr feines Papier – einen Hundertmarkschein und einen Briefbogen herausgezogen.
Ersteren ließ er zu Boden flattern, als verbrenne er ihm die Finger.
Auf dem Briefbogen stand in schrägen, sehr großen Buchstaben folgendes:
„Meine Leiche wird man in dem Moortümpel finden. Das Geld ist für meine Beerdigung bestimmt. Am liebsten wäre mir, wenn man mich nicht in der Selbstmörderecke des Friedhofs, sondern irgendwo auf einem Hügel unter einem alten Baum einscharrte. Ich habe stets die Natur und die Freiheit über alles geliebt. Deswegen haben mich auch die Menschen zu Tode gehetzt. Die Welt will alle Kreatur nach bestimmten Schablonen geformt wissen! Ich paßte mich diesem Philisterstreben nicht an. Ich scheide als ein Namenloser aus diesem großen Komödienhaus, das man Welt nennt. Ein Versuch festzustellen, wer ich bin, ist zwecklos. – Mein letzter Gedanke gilt … ihr – ihr! – Nie wird sie erfahren, was aus mir geworden …“
Tobias Frick ließ die Hand mit dem Briefbogen sinken.
„Was sagst du dazu, Friedel?“ fragte er sinnend.
Der Kandidat mit dem graumelierten, ungepflegten Vollbart um das rote, gedunsene Gesicht, das den Gewohnheitstrinker verriet, zuckte die Achseln.
„Jedenfalls werden wir die Leiche morgen mit Tagesanbruch herausholen und tun, was der Unbekannte wünscht, – ihm die Selbstmörderecke ersparen.“
Semper Nemo hatte kaum hingehört, was die beiden sprachen. Jetzt sprang er auf die Füße, nahm die Anzugjacke des Toten und probierte sie an. Sie saß fast ohne Falte.
Dann begann er sich seiner eigenen Sachen zu entledigen, schlüpfte Stück für Stück in die des Mannes, der dort ostwärts im Torftümpel lag.
„Bist du verrückt geworden, Junge?“ fragte der Klown ärgerlich. „Laß die Maskerade! Du hast doch sonst nicht solche Flausen im Kopf. Dies geht zu weit. Habe Achtung vor dem Tode! Es ist das einzige, was auch mir imponiert.“
Der Jüngste der drei Heimatlosen ließ sich nicht stören. Eben zog er die Weste über. Alles paßte tadellos. Der weiße Kragen und die schwarze Schleife über dem zart blaugestreiften Oberhemd gaben ihm im Verein mit dem Anzug ein ganz anderes Aussehen.
Auch Gottfried Blendel mußte das anerkennen und tat’s mit den Worten:
„Wie’n ganz feiner Max schaute er aus!“
„Blödsinn!“ knurrte Tobias. Dann fauchte er los: „Was willst du mit meinem Rasierzeug, Junge, – he?“
„Wir die Stoppeln abnehmen – was sonst?!“
„Möchtest wohl gern das Fest da drüben mitmachen, wie?!“ höhnte der Klown. „Dich gelüstet, scheint’s, schon wieder nach kulturbeleckten Europäern! Bis die Landstraße wohl schon satt?! – Zum Teufel – was verbirgt sich nun eigentlich hinter deinem Namen? ‚Semper’ heißt ‚immer’, und ‚Nemo’ ‚Niemand’. So viel Latein habe dich als einstiger Zögling der geistlichen Schule in … in Dingsda noch behalten. Also, was willst du hier bei uns? Weshalb schleppen wir dich jetzt schon eine Woche mit uns herum? Wer bist du? – Heraus mit der Sprache!“
In des Jüngsten Gesicht war ständig ein Ausdruck weltverachtenden, überlegenen Galgenhumors. Jedenfalls ein sehr seltenes Gemisch. Jetzt preßten sich die Lippen einen Augenblick zu einer schmalen Linie zusammen.
„Auch verspielte Leut’ können ja mal versuchen – ein allerletztes Mal, ob das Glück ihnen nicht doch noch die Hand reicht,“ sagte er dann. „Dort im Schloß haust ein Mann, der mir so aussieht, als ob er für das Alltägliche nicht gerade schwärmt. Ich habe, in der Menge der Dorfbewohner stehend, ihn heimlich beobachtet. Und – diesen Anzug hat mir – vielleicht! – die Vorsehung geschickt.
Tobias Frick schaute Semper prüfend an. Darauf meinte er:
„Hier – setz’ dich! Ich werde dich rasieren. – Such’ den Kamm heraus, Friedel. Der Semper will allen Ernstes die schräge Rutschbahn wieder aufwärtskriechen, die ihn zu uns gebracht hat. Da dürfen wir ihn nicht hindern. Er ist noch nicht reif für die endgültige Aufnahme in den Bund der Brüder von der Landstraße. Möchte diese Reife nie eintreten!“
Der frechere Lehramtskandidat nickte. Und als er den Kamm gefunden hatte, sagte er:
„Wie denkst du dir die Geschichte eigentlich, Semper? Geh’ doch lieber morgen zu dem Mann, dem du die genügende Großzügigkeit und Menschenfreundlichkeit zutraust, dir die Hand zu reichen, um dich wieder auf den schönen langweiligen Weg bürgerlicher Tugenden hinaufzuziehen. Heute ist meines Erachtens dazu die ungeeignetste Zeit.“
Sempers Minen drückten schon wieder überlegenen, verbitterten Galgenhumor aus.
„Auf die gewöhnliche Art habe ich nie etwas erreicht. Nur Fußtritte lohnten mein Streben und meine Bescheidenheit. Nun will ich’s anders versuchen, ganz anders. Vielleicht glückt’s …!“
Mittlerweile war’s dunkel geworden, daß der verkommene Kandidat ein kleines Petroleumlaternenchen anzündete, das freilich mehr Gestank als Licht verbreitete. Immerhin genügte die Beleuchtung, um Semper völlig zum anständig angezogenen Menschen umzumodeln.
Bevor er dann in die lichte, laue Sommernacht hinausschritt, sagte er noch:
„Was auch geschieht, ich komme hierher zurück. Wartet auf mich…!“ – –
Die beiden alten Vagabunden waren allein. Eine geraume Zeit schwiegen sie. Gottfried Blendel lag wieder lang ausgestreckt, neben ihm sein Duckchen, dem er nachdenklich den schön gezeichneten Kopf streichelte. Und der Klown saß wieder auf den harten, braunen Torfziegeln, hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt und den Kopf in beide Hände.
„Friedel, zehn Jahre kennt uns jetzt die Landstraße, manches haben wir erlebt, – so etwas wie jetzt eben doch nicht!“ meinte Tobias schließlich. Und fügte hinzu: „Reich mir das Brot und den Käse. Ich habe Hunger.“
Der graubärtige Alte erwiderte gedankenverloren:
„Wirklich – wie ein Traum ist das alles, wenn man näher darüber nachsinnt, – wie ein Sommernachtstraum mit Geistern, Gespenstern und anderem Zauberspuk …“
3. Kapitel.
Der Schleiertanz der maskierten Künstlerin näherte sich seinem Ende, als Semper auf schmalem, kiesbestreutem Wege leise durch duftende, hochstämmige Rosen sich dem Festplatz zuschlicht. Nun trennte in nur noch eine offene, bogenförmige Fliederwand, in der drei weißgestrichene, bequeme Gartenstühlen standen, von der weiten Rasenfläche, in deren Mitte der helle Lichtkreis des Scheinwerfers lagerte und mit wechselnden, fein abgetönten Farben die lautlos dahinschwebende Gestalt beleuchtete, die bald die Form eines Riesenschmetterlings, bald die lodernder Flammen oder wildbewegten Wassers mit rollenden Wogen annahm und wie eine seltsame Erscheinung aus einer anderen Welt wirkte.
Semper sah auf der einen Bank etwas Dunkles liegen. Es war ein weiter, seidener Damenmantel mit einer Kapuze, wie er, sich über die Bank beugend, feststellte.
Er hätte den Mantel weiter kaum beachtet, wenn dem eleganten Kleidungsstück nicht ein recht starker Duft eines besonderen Wohlgeruches entstiegen wäre.
Semper Nemo hatte eine Vorliebe für feine Wohlgerüche. Es war dies eine Eigentümlichkeit von ihm, die er auf Vererbung zurückführte, obwohl gerade bei ihm eine solche Annahme schwerer als bei jedem anderen zu begründen war. Aber besser vermochte er sich diese fast krankhafte Neigung für Parfüms nicht zu erklären.
Auch jetzt blieb er, über die Rückenlehne der Bank gebeugt, eine ganze Weile regungslos stehen und sog mit Entzücken den eigenartigen Duft ein. Erst das Geräusch flüchtiger Schritte ließ ihn aufblickend.
Die maskierte Schleiertänzerin stand vor ihm.
Selbst hier unter den Bäumen war es hell genug, um mehr als nur die Umrisse einer Gestalt erkennen zu können.
„Was tun Sie hier?“ fragte die Maskierte offensichtlich erschreckt und wich einen Schritt zurück.
Dann ereignete sich etwas, das Semper völlig aus der Fassung brachte.
„Erwin … du … du?! Wie kommst du hier nach Ostpreußen?! Bedenkst du gar nicht, daß mein Vater dich ohne Rücksicht fortweisen wird, wenn er dich sieht?!“
Sie stand jetzt dicht an der weißen Bank und streckte wie beschwörend den Arm gegen ihn aus.
Semper, dessen Verbitterung längst auch eine stumpfe, mehr auf Gleichgültigkeit gegen alles beruhende Geistesgegenwart bei ihm erzeugt hatte, vermochte zunächst kein Wort hervorzubringen.
Dann sagte er mit einem gewissen Trotz:
„Ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie gehören doch wohl zu der Seiltänzertruppe. Jedenfalls verwechseln Sie mich mit einem anderen. Ich heiße nicht Erwin.“
Abermals wich sie zurück.
„Das … das ist nicht möglich,“ stotterte sie, und ihre Stimme klang noch undeutlicher als vorher unter dem seidenen Vorhang der Maske, die bis über ihr Kinn hinwegreichte. „Eine solche Ähnlichkeit zwischen zwei Menschen gibt es nicht …! Du bist Erwin … Warum leugnest du es?“
Da lachte er kurz auf. Und dieses Lachen enthüllte seine zermürbte Seele mit einem Schlage.
„Ich bin es nicht! Sie können’s mir schon glauben! Aber ich wünschte, ich wär’s! Doch mit mir tauscht niemand – niemand!“
Sie griff jetzt nach dem Mantel und zog ihn schnell über ihre langen, weiten Gewänder.
„Kommen Sie um Mitternacht wieder hierher,“ flüsterte sie hastig. „Ich muß Sie sprechen – ich muß! Hier gibt es irgend etwas aufzuklären, was vielleicht für Sie sehr wichtig ist.“
Dann eilte sie davon – hinein in die Tiefe des Parkes, in die dufterfüllte Sommernacht …
Semper Nemo stand wie betäubt, fuhr sich mit der Hand über die Stirn, schob den Hut ganz nach hinten und atmete schwer und langsam.
Was war das eben gewesen? Was bedeutete das alles …? Erwin … Ähnlichkeit …?! Und dazu die Frau mit der Seidenmaske und dem seltsamen Parfüm, das er noch immer zu spüren glaubte …?!
Das Trompetensignal, durch das die Gäste in der Schloß zur Tafel gerufen wurden, brachte erst wieder Leben in seine Gestalt.
Er hörte laute Stimmen sich nähren, trat hinter die Fliederbüsche …
Drei Herren kamen ganz dicht vorüber.
„Wenn’s eine Angehörige der Seiltänzergesellschaft gewesen ist, – wozu dann die Maske?“ meinte der Assessor Schaumburg.
Und Major z. D. Graf Argelunxen erwiderte mit knarrendem Auflachen:
„Das macht die Vorführung interessanter – sehr einfach! Wahrscheinlich ist die Schleierdonna schon weit über die dreißig hinaus …“
„Sehr wahrscheinlich!!“ stimmte der Bürgermeister Lankner ihm zu. –
Semper Nemo hatte jetzt einen Entschluß gefaßt. Er ging hinter den Herren her. Den Namen des größten Kirchdorfes in der Nähe kannte er. Dort hatten er und seine Gefährten sich am vergangenen Tag nach richtiger Stromerart durchgefochten, – durchgebettelt.
Er sprach die Herren an.
Als die Stimme in ihrem Rücken ertönte: „Verzeihung – dürfte ich um eine Auskunft bitten …!“ drehten sie sich gleichzeitig um.
Semper nannte seinen angenommenen Namen absichtlich recht undeutlich, erklärte dann, er sei Künstler und in einem Gasthaus in Branken abgestiegen, habe eine Fußwanderung durch die Heide gemacht und sich dabei verirrt.
„Ich bin recht erschöpft und erlaube mir anzufragen, ob ich hier nicht gegen Geld und gute Worte etwas zu essen bekommen kann.“
Sein sicheres, gewandtes Auftreten, seine gute Kleidung und nicht zuletzt sein feingeschnittenes Gesicht mit dem seltsamen Ausdruck seelischen Leidens bewirkten, daß der Major z. D. als der älteste den Fremden unter seine Obhut nahm.
Nachdem er sich und dann auch die beiden anderen vorgestellt hatte, forderte er Semper auf, ihn zu begleiten. Der Schloßherr sei ein so liebenswürdiger Mann, daß ein Künstler hier nicht umsonst anklopfen werde, meinte er mit einer gewissen herablassenden Freundlichkeit.
Diese kleines Szene, als Semper so die Bekanntschaft von drei Gästen August Hübners machte, hatte sich auf dem breiten, auf der Schloßterrasse hinablaufenden Weg unter einer der Bogenlampen abgespielt.
Graf Schalk Edler von Argelunxen, dessen Gesicht bereits in der begeisterten Röte einiger geradezu großartig abgelagert gewesenen Flaschen Burgunder erstrahlte, suchte dann aber zunächst vergeblich nach dem Schloßherrn. Einer der Diener gab ihm schließlich die Auskunft, das gnädige Fräulein sei mit Herrn Hübner in dessen Arbeitszimmer gegangen.
Der Major wußte im Schloß Bescheid und steuerte nun mit dem Fremden, den er bereits vertraulich unter den Arm genommen hatte, den langen Korridor entlang dem Zimmer des Hausherrn zu. Die beiden brauchten aber nicht weit zu gehen.
Hübner und seine Tochter, die sich jetzt zur Tafel umgekleidet hatte und eine Gesellschaftsrobe trug, kamen ihnen entgegen.
Argelunxen unternahm auch jetzt die Vorstellung. Inzwischen hatte er Semper nochmals um den Namen gebeten, so daß er nun imstande war, für den jungen Künstler auch richtig und deutlich als für ‚Herrn Nemo’ um kurze Gastfreundschaft zu bitten.
August Hübner rechtfertigte auch hier seinen Ruf als großzügiger Wohltäter, war von größter Zuvorkommenheit und meinte, es würde ihm eine besondere Ehre sein, wenn Semper eine Einladung zur Teilnahme an der Festtafel, die sofort beginnen werde, annehmen wolle.
Dann fügte er hinzu:
„Hier meine Tochter Ellen, Herrn Nemo … Sie vertritt die Hausfrau, da ich seit Jahren Witwer bin, und sie wird sich ein Vergnügen daraus machen, Ihnen einen Platz am Tisch anzuweisen.“
Ellen, deren eigenartige Schönheit durch das kostbare und doch in keiner Weise aufdringlich elegante Gesellschaftskleid noch mehr zur Geltung gebracht wurde, ließ Semper nachher sogar zu ihrer Linken platznehmen, wo eigentlich der Kreisarzt und Geheimer Medizinalrat Dröscher hätte sitzen sollen, der aber inzwischen zu einer eiligen Operationen abberufen worden war.
Semper hatte also erreicht, was er wollte, und alles war weit besser gegangen, als er je gehofft hatte.
Ellen Hübner war von so zwangloser Liebenswürdigkeit ihm gegenüber, daß auch ein weniger sicherer Gesellschafter als er sich hier bald wohlgefühlt hätte. Wenn trotzdem über Sempers Stimmung zunächst noch eine leicht Unruhe lag, so war, vielleicht ungewollt, der Schloßherr daran schuld, der schon, als der Major ihm den jungen Künstler vorstellte, den verirrten Herrn Nemo auffallend gespannt und durchdringend gemustert hatte und auch jetzt häufig mit schlecht verhehlter Neugier zu ihm hinübersah. –
„Ah, Sie sind Sänger und Pianist, Herr Nemo,“ sagte Ellen Hübner soeben zu dem neuen Gast, indem sie sich in ihrem Stuhl zurücklehnte. Sie wollte dem Satz offenbar noch eine Fortsetzung geben, wurde aber durch den ihr gegenübersitzenden Assessor Schaumburg abgelenkt, der ihr das erste Glas Schaumwein mit ein paar verbindlichen Worten weihte.
Darauf wandte sich der Assessor an Semper.
„Von Ansehen kennen wir uns beide bereits, sollte ich meinen, Herrn Nemo,“ sagte er nicht minder verbindlich. „Vorgestern sah ich Sie im Hotel ‚Stadt Hamburg’ in unserem Kreisstädtchen. Sie aßen gerade auf der Veranda zu Mittag. Ich erkenne Sie wohl hauptsächlich an Ihrem Anzug wieder, der hier in der Provinz seines Schnittes wegen auffallen muß, natürlich nur angenehm. Aber auch Ihr Gesicht vergißt man nicht leicht, selbst wenn man es nur einmal gesehen hat. Künstler haben hier stets etwas an sich, das sie aus der Menge heraushebt. Und ich habe dazu noch ein anerkannt vorzügliches Personengedächtnis.“
Semper hatte infolge dieser etwas langatmigen Ausführungen Schaumburgs genügend Zeit sich zu sammeln. Er war doch ein wenig außer Fassung geraten. Blitzschnell überlegte er sich, daß der Assessor ohne Zweifel damals den Mann im Hotel gesehen haben müsse, der jetzt als Selbstmörder in der Torfgrube auf der Heide lag. Aber ebenso sagte er sich, daß er mit diesem Unbekannten – das ging ja aus des Juristen Worten klar hervor – eine mehr als gewisse Ähnlichkeit haben müsse. Und diese Schlußfolgerung verwirrte ihn. Zum zweiten Mal an diesem Abend wurde er mit einem anderen verwechselt …! Er begriff das nicht. –
Und als Schaumburg nun geendet hatte, zog er sich dadurch geschickt aus der verzwickten Lage, daß er ihm zuprostete und dazu sagte: „Ihr Personengedächtnis muß wirklich sehr gut sein, Herr Assessor.“
Jetzt richtete Ellen Hübner wieder das Wort an ihn.
„Wäre es sehr unbescheiden von mir, Herrn Nemo, wenn ich Sie bäte, uns durch ein Lied zu erfreuen? Der Flügel aus dem Musikzimmer ist schnell in den Saal gerollt.“
Sie sah ihn dabei erwartungsvoll an.
„Ich habe lange keine Taste angerührt,“ meinte er. „Sie werden daher Nachsicht üben müssen. Im übrigen ist es nicht meine Art, mich zu zieren. Ich gebe, was ich vermag. Viel ist es nicht.“
Ihr Gesicht drückte jetzt eine gewisse Überraschung, aber auch Entspannung aus. Es schien, als habe sie eine Ablehnung erwartet. –
Der Schloßherr erhob sich gleich darauf und bat um einige Zeit Gehör für einen verehrten Gast, den ein Zufall heute unter sein Dach geführt habe.
Die Stimmung an der Tafel war schon recht vergnügt. Kein Wunder bei so erlesenen Speisen und Weinen und so anregender Musik durch die auf der Galerie des Saales untergebrachte Dragonerkapelle.
Major Graf Argelunxen nahm die Ankündigung der Gesangsvorträge mit einem zu Bürgermeister Lankner ganz laut geäußerten: „Höchst überflüssig!“ hin. Er war schon sehr redselig, der trinkfeste Major, und der Sekt hatte jugendliches Feuer in ihm entfacht, so daß er der schönen Frau Landrat fast zu arg die Kur schnitt.
Nun – sehr bald bekehrte er sich aber zu einer anderen Ansicht. – Semper war erfahren genug, um der Gesellschaft nicht allzu ernste Sachen du bieten. Als erstes sang er das Auftrittslied aus Bajazzo. Seine Stimme war wenig umfangreich, aber weich und voller Gefühl. Er begleitete sich selbst. –
Am Flügel ging ungewollt eine völlige Veränderung mit ihm vor. Sein bleiches Gesicht rötete sich, seine dunklen Augen hatten den Glanz der Begeisterung angenommen. Er vergaß alles – wo er sich befand, daß er die Kleider eines Toten, seines Doppelgängers, trug, daß da draußen in der Heide Frick, Blendel und Duckchen auf ihn warteten.
Reicher Beifall erscholl, als er sich vom Flügel erhob. Und der Major rief ihm überlaut zu: „Eine Zugabe, – lassen Sie sich erweichen!!“
Und er setzte sich wieder, dachte einen Augenblick nach. Dann ein kurzes Vorspiel. Wagners Lohengrin – der Sang des Schwanenritters …
„Nie sollst du mich befragen
noch Wissens Sorge tragen …“ –
Es war ein Zufall, daß er nach Ellen Hübner hinüberblickte, als über seine Lippen in quellenden Tönen Lohengrins Mahnung an Elsa perlte, nie nach Namen und Art zu forschen.
Ihre Blicke begegneten sich. Es war ihm, als schimmere es feucht in ihren Augen. Und jetzt drückte sie wirklich verstohlen das Spitzentüchlein gegen die Augen … – –
Es war Mitternacht. Die Gäste August Hübners dachten noch nicht an Aufbruch. Man tanzte in dem ausgeräumten Speisesaal. Soeben hatte Semper Ellen Hübner nach einem Walzer an ihren Platz zurückgeführt.
Seit jener Sekunde, da ihre Blicke über die Tafel hinweg sich ineinander versenkt hatten, betrachtete er dieses junge Weib mit anderen Augen. Und als er sie nach den Klängen eines neuesten, einschmeichelnden Walzers in den Armen gehalten hatte, da war es ihm gewesen, als kenne er sie bereits jahrelang, als sei sie ihm nie eine Fremde gewesen, obwohl sie ihm erst heute vor drei Stunden im Korridor des Schlosses vorgestellt worden war.
Der scharfe Duft eines starken Veilchenparfüms entströmte ihrer Robe, ihrem reichen Haar … Der Duft war fast zu betäubend, selbst für Semper Nemo.
Die Musik schwieg. Vom Turm des Schlosses drangen die hallenden Schläge der großen Uhr bis in den Saal mit seinen lachenden, heiter angeregten Menschen hinein.
Semper schlich davon. Erst auf die Terrasse hinaus, dann nach der Fliederlaube. Die weißen Bänke waren leer. Er setzte sich und träumte vor sich hin. In der Nähe schluchzte eine Nachtigall …
Niemand erschien. Die Turmuhr schlug viertel, halb eins. Da erhob Semper sich und kehrte in den Saal zurück.
Es wurden gerade Erfrischungen gereicht. Ellen Hübner, neben der schon wieder Assessor Schaumburg stand, winkte Semper heran.
„Mein Vater sucht Sie, Herr Nemo. Er hat ganz vergessen, Sie zu bitten, für diese Nacht mit einem unserer Fremdenzimmer vorlieb zu nehmen. – Ah – Sie bringen so einen Hauch frischer Nachtklub mit. Waren Sie auf der Terrasse …?“
„Im Park, gnädiges Fräulein.“
Und wie er jetzt so vor ihr stand, da war es ihm, als sei das Veilchenparfüm an ihr bereits mehr verflüchtet und lasse einen anderen Wohlgeruch wieder hervordringen – einen Wohlgeruch, den man jedoch noch nicht genau seiner Eigenart nach mit den Geruchsnerven feststellen konnte …
Teil II
Gewitterwolken.
1. Kapitel.
Nachdem Semper die beiden Gefährten verlassen hatte, begannen diese ihre Zurüstungen zur Nachtruhe zu treffen. Tobias Frick suchte aus dem armseligen Kram, der am Boden umherlag, einen kleinen, zusammenlegbaren Ölstoffeimer heraus, knotete an den Bügel einen langen festen Bindfaden und holte sich aus dem nächsten Torfloch Wasser, um die allabendliche Körperabreibung vorzunehmen.
Die beiden Vagabunden hatten aus früheren besseren Tagen ein stark entwickeltes Reinlichkeitsbedürfnis bis in ihr jetziges heiteres Elend hinüber gerettet. Zerlumpt waren sie wie echte Stromer. Aber die Lumpen, die sie auf dem Leibe hatten, waren frei von Ungeziefer, und die Leiber darunter sauberer als die manches anderen, der seidene Hemden trägt. Selbst Duckchen, der Wolfspitz, den der ehemalige Lehramtskandidat vor vier Jahren als verkommenen jungen Köter von der Gasse aufgelesen hatte, wurde von seinem Herrn täglich mindestens einmal auf Flöhe hin genau untersucht. Zeit dazu hatte Gottfried Blendel ja, – sogar übergenug.
Während der großen Abendwaschung sprachen die beiden über Semper und sein Vorhaben. Der Klown meinte, der Junge könnte sich vielleicht böse Unannehmlichkeiten zuziehen, weil der den Anzug des Toten trage, den nur zu leicht jemand wiedererkennen würde. Diese Möglichkeit sei ihm erst jetzt eingefallen.
Worauf Friedel erwiderte, jeder schlafe so, wie er sich bette. Die ganze Geschichte sei zu verrückt, um ein gutes Ende nehmen zu können. Wenn Semper schon durchaus in den Schoß der braven bürgerlichen Gesellschaft habe zurückkehren wollen, hätte er ja zunächst mal irgendeine Arbeit annehmen können, wenn nicht anders als Steinklopfer, Nachtwächter oder Dorfschulpedell[1]. Aber so die Sache zu versuchen, das seit Irrsinn!
Dann wickelt er sich in seine Pferdedecke, schob sich das Unterbett aus Gras und Heidekraut noch etwas zurecht und war gleich darauf eingeschlafen.
Tobias Frick dagegen ging noch eine ganze Weile vor der Lichtung langsam auf und ab. Und wieder bewegte er im Selbstgespräch nach alter Gewohnheit die Lippen.
„Wem ähnelt das Profil des Jungen nur? Wem?! Eine Ähnlichkeit ist da. Aber mein alter Hirnkasten versagt diesmal. – Ich wünschte, der Semper wäre erst wieder bei uns … Wenn er doch nur endlich mal sein Inkognito lüften wollte … Ein guter Diplomat kann nicht verschwiegener und zugeknöpfter als er sein … Nichts weiß ich von ihm, nichts … Nur das, was ich mir aus seinen Mienen zusammenreimen kann. Das Leben muß ihm böse mitgespielt haben. Sehr böse …!!“
Er blieb stehen und schaute über die in nächtlichem Schweigen daliegende Heide hinweg. Wieder trug der Wind Musikklänge vom Schloßpark herüber. Es war ein Walzer, – derselben, nach dem die maskierte Schleiertänzerin ihre Kunst gezeigt hatte.
Tobias pfiff leise einige Takte mit. Plötzlich hörte er zu pfeifen auf. Der Tote war ihm eingefallen.
„Nein – wir müssen diesen Fund melden, es geht nicht anders,“ sagte er zu sich selbst. „Es wäre ja ganz poetisch, den armen Kerl ohne Mitwirkung der Behörden zu begraben. Friedel würde sicher eine sehr schöne Leichenrede halten. Aber wir kommen in Teufels Küche, wenn die Geschichte ruchbar wird.“
Er gähnte. Schon wollte er sich nun auch zur Ruhe begeben, als er im Westen das fahle Aufzucken eines Wetterleuchtens am Horizont bemerkte.
„Es wird ein Gewitter werden … Die Luft ist drückend. Der Wind schläft immer mehr ein …“ brummte er unzufrieden. „Zum Naßwerden habe ich nicht viel Lust, – wirklich nicht. Und Regen gibt’s sicher. Da hinten die Wolkenwand ist recht vielversprechend.“
Dann ging er mit einemmal lebhafter als bisher nach Norden zu in die Heide hinaus. Dort stand etwa sechshundert Meter von dem Lagerplatz der Pennbrüder entfernt eine kleine, baufällige Schäferhütte. Eigentlich nur eine Hundebaude war’s. Und Tobias untersuchte sie nun recht eingehend, so gut es in der halben Dunkelheit der Sommernacht möglich war.
Zehn Minuten später weckte er den Gefährten.
„Wir müssen umziehen. In kurzem haben wir ein schweres Gewitter. Dort vorn die Schäferhütte bietet Schutz. Pack’ zusammen. Ich werde inzwischen für den Jungen einen Wegzinken legen.“
Er schälte ein paar Zweige ab und steckte sie auf besondere Art vor der Lichtung in die Erde, so daß etwas wie ein Pfeil zustande kam, der auf die große Hundebude hindeutete.
Der Wind war jetzt ganz eingeschlafen. Vom Schloßturm schallte der Schlag der Uhr herüber.
„Eins! Und der Junge noch nicht da!!“ meinte Tobias seufzend.
Dann schritten die beiden ihrer neuen Behausung zu. – Das Dach waren mit Teerpappe benagelt; die kleine Tür aus den Angeln gefallen, das Innere leer. Das ganze Hüttchen war vielleicht drei Meter tief und ebenso breit. Einen Fußboden besaß es nicht. Es stand wie ein Käfig ohne Boden mitten im Heidekraut.
Im Umsehen hatten Tobias und Friedel sich beim Schein ihres Laternchens häuslich eingerichtet.
„Hier hält man’s wochenlang aus,“ meinte der Klown. „Die reine Sommervilla.“
Friedel sagte gar nichts. Er streckte sich schon wieder auf das schnell bereitete Lager hin und war bald eingeschlafen. Duckchen lag wie immer dicht an seine Brust geschmiegt da.
Tobias hörte die ersten Windstöße den nahenden Regen ankünden. Gleich darauf prasselte es wie Hagelschlossen[2] herunter. Es goß in Strömen. Hätte die Schäferhütte nicht auf einem kleinen Hügel zwischen den Büschen gestanden, so wäre der Boden wohl sehr bald ungemütlich naß geworden.
Der alte Zirkusklown hatte sich dicht hinter die Tür gesetzt und seine Stummelpfeife angezündet. So beobachtete er das Toben des Unwetters, das mit Sturm und einem förmlichen Wolkenbruch vorüberzog. Urplötzlich hörte der Regen auf. Und wenige Sekunden später erschütterte ein Donnerschlag mit solchem Krachen die Luft, daß Friedel hochfuhr und Duckchen zu bellen begann.
Das Gewitter war da. Ein trockenes Gewitter, bei dem es nicht einen Tropfen regnete. Und das sollen die schlimmsten sein.
Das Firmament bildete zeitweise ein Flammenmeer. Dann war die ganze Umgegend taghell erleuchtet.
Aber strenge Herren regieren nicht lange. Kaum fünf Minuten dauerte es, dann war das Gewitter vorbeigezogen, und Tobias trat ins Freie, um frische Luft zu schöpfen. In der niedrigen Bretterbude war es zum Ersticken heiß.
Der Klown schaute erst nach Schloß Elgenstein hinüber. Nun wandte er das Gesicht nach Norden, zuckte zusammen.
Dort jenseits der Heide, die gut ihre drei Kilometer breit war, stand ein roter, mächtiger Feuerschein.
Also hatte das Gewitter doch Unheil angerichtet. Blitzschlag, womöglich in eine noch gefüllte Scheune! Beinahe ließ sich dies nach der Größe des Brandes vermuten.
„Friedel, schläfst du?“ rief Tobias in die Hütte hinein. – Ein ärgerliches Grunzen war die Antwort.
„Es brennt dort drüben, Friedel. Großfeuer! Ich hätte Lust, mir die Sache aus der Nähe anzusehen.“
„Blödsinn! Damit dich ein Gendarm bemerkt und aufgreift! Komm schlafen!“
„Gendarm?! He, Gendarm!!“ Tobias lachte geringschätzig. „Unsere Papiere sind in Ordnung.“
Er holte seinen Krückstock heraus, rief Friedel noch zu, den Jungen zu grüßen, falls dieser inzwischen erschiene, und ging durch das feuchte Heidekraut in schräger Linie auf den Fahrweg zu, der da drüben vom Gut Elgenstein her nach Norden die Heide durchschnitt.
Der Weg war bald erreicht. Es war eine mit Steinschotter gefestigte Straße, gut gehalten, mit weißgetünchten Steinen an den Seiten. Landrat Müller sorgte eben auch für den Wegebau in seinem Kreise, obwohl er hierdurch bei den adligen Großgrundbesitzern wenig an Liebe gewann. Für Straßen und Schulen ist jeder Taler überflüssig. Erstere verlocken das Gutsvolk nur zum Wegzug, und letztere klären unnötig auf.
Dann hörte Tobias hinter sich das Knattern eines Autos. Er drehte sich um. Das Licht zweier Kraftwagenscheinwerfer blendete ihn fast. Sehr schnell kam das große Personenauto heran, das vor eine Druckspritze gespannt war. Und darin – Tobias traute seinen Augen nicht! – saß neben einer jungen Dame kein anderer als Semper. Diesem Paar gegenüber hatten zwei andere Herren die Rücksitze inne. –
Auto und Spritze waren vorüber.
„Donnerwetter!“ knurrte der ehemalige Zirkusklown. „Der Junge hat’s wirklich geschafft! Im Auto wie ein großer Herr – unglaublich!!“
Er eilte sich, vorwärts zu kommen.
„Vielleicht finde ich dort bei dem Brand Gelegenheit, den Jungen zu sprechen,“ dachte er halblaut, wie es so seine Angewohnheit war. – –
Eine halbe Stunde später hatte er das Gut erreicht, auf dem das Schadenfeuer wütete.
Die Spritze von Elgenstein war schon in voller Tätigkeit. Und August Hübner leitete die Löscharbeiten, als sei er sein Leben lang Brandmeister bei einer Berufsfeuerwehr gewesen.
Die riesige Holzscheune drohte mit ihren hochleckenden Flammenzungen auch die Stallgebäude mit ins Verderben zu ziehen. Aber die Gutsspritze von Elgenstein, die Hübner erst vor einem Monat neu angeschafft hatte, bewährte sich vorzüglich. Als dann noch zwei weitere Spritzen eintrafen, schien alle Gefahr beseitigt.
Tobias Frick hatte sich unter die ländlichen Zuschauer dieses nächtlichen, schaurig schönen Brandes gemischt und bald einen gesprächigen alten Instmann[3] gefunden, der ihm willig Rede und Antwort stand. Von Semper war nirgends etwas zu sehen. Auch von der jungen Dame nicht, mit der er er im Auto gesessen hatte.
Der Instmann gehörte seit vierzig Jahren zum Gut Palwitzkowo und war ein Deutscher, während es sonst hier meist nur stumpfe Kassuben[4] gab. Auf den Grafen Ernst Palwitzki, den jetzigen Majoratsherrn, war er offenbar schlecht zu sprechen.
Als Tobias diesen Namen hörte, schnellte sein Kopf überrascht hoch.
„Graf Ernst Palwitzki, – hörte ich richtig?“ fragte er.
„Ja, ja. So ist’s. Und wenn ein Palwitzki je wie ein Verrückter verschwendet hat, ist’s dieser,“ sagte der Instmann gehässig. „Für uns Leute ist nie einen Pfennig übrig. Alles ist hier verwahrlost. Alles! Wäre die Spritze von Elgenstein nicht so schnell gekommen, so würden auch die Ställe mit hochgegangen sein. Unsere Spritze hier hat seit drei Jahren keine Schläuche mehr und ist eingerostet. Schade nur, daß der junge Herr aus Elgenstein sich hier für unseren Grafen das Bein gebrochen hat. Unser Herr dankt’s ihm doch nicht. Hochmütiges Pack, die ganze Familie! Ein Bürgerlicher gilt denen weniger als ein guter Jagdhund.“
Tobias brachte schnell heraus, wen der Alte mit dem ‚jungen Herrn aus Elgenstein’ meinte und wie der Unfall sich abgespielt hatte.
Semper hatte, als nicht sofort jemand den vom Feuer bedrohten Giebel des großen Stalles erklettern wollte, um aus der Höhe herab das Dach ständig unter Wasser zu halten, eine Leiter heranschaffen lassen und war mit dem einen Spritzenschlauch in der Hand die Sprossen emporgeklettert. Aber die Leiter, morsch wie alles in Palwitzkowo, war dann plötzlich zusammengekracht, wobei Semper einen Bruch des linken Unterschenkels und eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen hatte. Man hatte ihn darauf sofort ins Gutshaus geschafft und nach dem Kreisarzt nach Schöneck telephoniert. – Mehr wußte der Instmann auch nicht.
Tobias Frick merkte jetzt wieder so recht, wie sehr ihm der junge ans Herz gewachsen war. Er machte sich Sempers wegen die ernstesten Sorgen. Besonders die Nachricht, es liege auch eine Gehirnerschütterung vor, beunruhigte ihn derart, daß er, als nun auch Ellen Hübner wieder auf dem Hof in Begleitung Assessor Schaumburgs erschien – er erkannte in ihr sehr leicht Sempers Nachbarin im Auto wieder und reimte sich schnell zusammen, wer sie sei, – sich bei guter Gelegenheit an sie herandrängte und, seinen schäbigen Filz ziehend, sie fragte, wie es denn dem Herrn gehe, der vorhin zu Schaden gekommen sei.
Das Benehmen des zerlumpten Alten mit dem verwitterten Schauspielergesicht, ebenso seine Ausdrucksweise fielen Ellen auf. Sie gehörte nicht zu jenen jungen Damen, die sozusagen blind an allem vorübergehen, was nicht ausschließlich zum Interessenkreis eines jungen, verwöhnten Weibes gehört. Von ihrem Vater, diesem praktischen, zielbewußten Mann, hatte sie gelernt die Augen offenzuhalten und auch Geringfügigem Wert beizumessen und Beachtung zu schenken.
Daß dieser Alte, der jetzt mit ängstlich forschenden Augen vor ihr stand, nicht aus müßiger Neugier nach Semper Nemo fragte, war ihr sofort klar.
Sie musterte ihn scharf. Der Assessor unterhielt sich einige Schritte weiter mit dem soeben gleichfalls an der Brandstätte eingetroffenen Bürgermeister Lankner. Daher konnte sie dem Vagabunden unbeobachtet schon etwas näher auf den Zahn fühlen.
„Wer sind Sie? Und was veranlaßt Sie, nach dem Herrn sich zu erkundigen?“ fragte sie freundlich.
Tobias Frick wurde sofort aus kluger Berechnung wieder der verkommene Strolch, für den ihn jeder seinem Äußeren nach halten mußte.
„‘n ganz jemeiner Ritter von der Landstraße bin ick, dem der jungen Herrn letztens mal fünfzig Pfennig zu Schnaps geschenkt hat. S’ hat gerade zu n’ tüchtigen Rausch jelangt. So’n Wohltäter vergießt unsereiner nicht …!“
In dieser Antwort war ein Zuviel an absichtlich herausgekehrter Vagabundenart. Ellen entging das nicht. Aber sie ließ sich nichts anmerken.
„Dem Herrn geht’s den Umständen nach leidlich. In drei bis vier Wochen wird er wieder ganz hergestellt sein, meint der Kreisarzt,“ lautete jetzt ihre Erwiderung.
Der Stromer brummte ein Wort des Dankes, verbeugte sich und verschwand.
Und Ellen Hübner dachte: „Der Alte hat gelogen! Zwischen ihm und Semper bestehen andere Beziehungen. – Welch’ seltsame Nacht …!! Sie überschüttet mich mit Abenteuern, mit Rätseln und Unruhe …“
2. Kapitel.
Im Herrenhaus von Palwitzkowo, einem unschönen, riesigen Backsteinbau von nüchternstem Stil, hatte sich die erste Aufregung über den Brand gelegt. Die gräfliche Familie war im Speisezimmer versammelt, einem langgestreckten Raum mit etwas zusammengewürfelten Möbeln und prachtvollen Geweihen an den Wänden. Man hatte soeben, um sich zu erfrischen, Kaffee getrunken. Daran, auch den zur Hilfeleistung aus dem benachbarten Elgenstein herbeigeeilten Herrschaften etwas vorzusetzen, hatte nur Komtesse Adda gedacht, war aber mit ihrem Vorschlag von der Mutter mit der Bemerkung zurückgewiesen worden, daß eine solche Einladung zu dieser nächtlichen Kaffeetafel die Anbahnung gesellschaftlicher Beziehungen zur Folge haben würde, und … „Ein Konservenfabrikant nebst Tochter und dem Anhängsel von bürgerlichem Assessor paßt nun mal nicht in unsere Kreise hinein, selbst wenn einer Millionen besitzt, oder besser, gerade weil er so reich ist.“
Adda hatte zu dieser Entscheidung die Achseln zu zucken sich erlaubt, was sofort mit einem strengen Verweis gerügt worden war.
„Ich finde überhaupt,“ hatte die Gräfin, eine stark gepuderte, sehr vornehme, aber ebenso kalt wirkende Erscheinung gesagt, „daß der Aufenthalt bei den Verwandten in Berlin dir sehr geschadet hat. Du hast, scheint’s, so etwas von den freien Anschauungen der Weltstaat dir angeeignet, was für eine Komtesse Palwitzki wenig zuträglich ist.“
Adda hatte nur mit einem halb trotzigen „Schon möglich!“ geantwortet, das die Gräfin zum Glück auf ‚wenig zuträglich’ bezog. –
An dem Kaffeetisch saßen außer dem gräflichen Ehepaar und Adda noch deren Schwester Stella und der Jüngste der Familie, der Leutnant bei den Leibhusaren Hermann-Dieter, welcher vor drei Tagen hier bei den Seinen den zwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte.
Dieser Kaffeetisch mit seinem teils sehr kostbaren, teils zerbrochenen Geschirr und der fleckigen Damastdecke war kennzeichnend für die Zustände in der Familie des Majoratsherrn, der seine polnische Abstammung weder im äußeren noch in seinem sich Geben und seinen Anschauungen verleugnete. Hager, dunkel und sehr gut erhalten für seine fünfzig Jahre, lag über seinem Wesen etwas Träumerisches, Schlaffes. In den Händen seiner Gattin, einer geborenen von Palfna, war er weiches Wachs, sowohl zum Guten wie zum Schlechten.
Die Gräfin erhob sich jetzt.
„Ich möchte noch etwas mit dir besprechen,“ sagte sie kühl zu ihrem Gatten, mit dem sie sich längst auseinandergelebt hatte, woran freilich beide die Schuld trugen, er als unverbesserlicher Verehrer jedweder Frauenschönheit, sie als kalte Intrigantin, die mit allen Mitteln einem Ziel zustrebte: Für ihre und ihres Mannes Hang zu luxuriösem Lebenswandel die nötigen klingenden Mittel zu beschaffen.
In dem kleinen Damensalon riegelte sie die Türen ab und zog noch die schweren, aber längst ausgeblichenen Damastportieren zu. Dieses Gemach hatte schon so manche erregte Szene zwischen dem Ehepaar gesehen. Auch heute ahnte der Graf, daß das, was ihm seine Gattin mitzuteilen hatte, nicht gerade angenehmes enthalten würde. Er setzte sich in einen der niedrigen Sessel und zündete sich eine Zigarette an. – Die Gräfin war an das Fenster getreten, von dem aus man durch die Lindenkronen einer Allee gerade noch den lohenden Feuerschein der brennenden Scheune sehen konnte.
Eine Weile blieb es still zwischen den beiden. Dann begann die Gräfin auf dem dicken Teppich in ihren koketten, ausgeschnittenen Lackschuhen langsam auf und ab zu gehen.
„Dieser Plebejer aus Elgenstein kam zu früh,“ sagte sie leise. „Wären die Ställe mit in Flammen aufgegangen, so hätten wir mit der Versicherung ein glänzendes Geschäft gemacht. Ich habe mir vom Rendanten[5] jedenfalls schon die Bücher geben lassen, um zu prüfen, wieviel Getreide und Futtermittel mit der Scheune verbrannt sind. Einige kleine Korrekturen in den Zahlen werden uns gegen zwanzigtausend Mark einbringen. Matziks sind wir sicher. Er wird schweigen. Ich habe ihm letztens wieder nachgewiesen, daß er uns um achtzig Mark betrogen hat. Den Mann habe ich fester denn je in in der Hand.“
Der Graf seufzt.
„Geht es nicht ohne … ohne Korrekturen, Viktoria?“ fragte er kleinlaut.
Sie lachte fast verächtlich auf. „Dreitausend Mark würden dann herauskommen …!! Das genügt gerade für meine Wintertoilette – vielleicht. – Doch genug hiervon. Was sagst du zu der anderen Überraschung, die uns indirekt das Gewitter beschert hat?“
„Du meinst den … den …“
„Natürlich – wen sonst?! Wir müssen unbedingt zusehen, daß wir diesen Zufall, der gerade diesen Menschen in unser Haus gebracht hat, nach Kräften zu unserem Vorteil ausnützen. Dies wollte ich mit dir besprechen. Es ist nötig, daß wir nach einem bestimmten Plan handeln. – Zunächst aber wären einige Fragen zu erörtern. Sollte er etwa doch nicht lediglich zufällig in diese Gegend gekommen sein? Hat ihn eine bestimmte Absicht hergeführt? Und – wie ist es möglich, daß er sich wieder in kurzem soweit emporgearbeitet hat, um hier in anständiger Kleidung als Gast dieses Hübner auftauchen zu können? – Wir waren unserer Sache mit ihm doch so sicher! Wir wußten, daß er zum Vagabunden herabgesunken war, der Sonntags in Dorfschenken auf elenden Klavieren zum Tanz aufspielte. Und nun diese Enttäuschung?! Ich begreife das nicht.“
„Ich auch nicht. – Hast du denn Fräulein Hübner nicht ausgeforscht, wie er nach Elgenstein gekommen ist?“
„Versucht habe ich’s. Aber dieses Mädchen kann ebenso zugeknöpft sein wie ihr Vater. Ich fürchte fast, ihr ist es aufgefallen, daß ich mich so eingehend nach dem angeblichen Herrn Nemo erkundigte. Da schwieg ich lieber. Wir dürfen nicht Verdacht erregen.“
Wieder seufzte der Graf und besah sich eingehend seinen lackierten Fingernägel.
„Diese Hetze wird vielleicht scheitern,“ meinte er unsicher. „Du siehst jetzt wieder, wie schwer es ist, unseren Zweck zu erreichen.“
Die Gräfin war vor ihm stehen geblieben und schob den Stiel ihrer Lorgnette spielend durch die Finger.
„Besinnst du dich noch, wie das Ganze begann?“ fragte sie mit besonderer Betonung. „Nichts ist leichter, als etwas Ähnliches jetzt hier einzufädeln. Geschickt gemacht, muß es dann entscheidend sein.“
Er hob erschreckt den Kopf. „Vicky, nur das nicht …!“ sagte er beschwörend. „Ich habe schon damals mir die schwersten Gewissensbisse gemacht, als …“
„So?!“ unterbrach sie ihn höhnisch. „Gewissensbisse?! Es wäre besser gewesen, du hättest dich mehr um das Majorat gekümmert!! Dann würden wir es nie nötig gehabt haben, diesen Millionen nachzujagen!“
Er senkte schon wieder den Kopf und schob die Zigarette zwischen die Lippen.
„Tu, was du willst!“ meinte er ärgerlich, indem er den blauen Rauch von sich blies. „Eigentlich hast du ja recht. Millionen …!! Und – wozu sollen wir wohl fünf Jahre umsonst all die Aufregungen gehabt haben …?!“
„Und Ausgaben!“ betonte sie. „Ich habe jeden Pfennig notiert, den dieser Kampf uns gekostet hat.“ Sie schritt schnell auf den altertümlichen, reich mit Elfenbein verzierten Damenschreibtisch zu und entnahm einem Geheimfach ein Päckchen Briefe und ein blaues Heftchen. Letzteres enthielt lange Posten Zahlen mit kurzen Bemerkungen.
Die Gräfin blätterte darin umher und erklärte dann: „Beinahe elftausend Mark betragen die Unkosten. Soll das Geld unnütz weggeworfen sein, wo wir jetzt so kurz vor der Entscheidung stehen?! Niemals! Ich würde …“
Sie schwieg plötzlich, starrte in das blaue Heftchen und suchte dann hastig aus den Briefen einen bestimmten heraus, indem sie die Lorgnette vor die kurzsichtigen Augen hielt.
„Nein,“ rief sie dann halblaut, „wie ist es nur möglich, daß ich das vergessen konnte …!! Mir war es doch gleich so, als ich den Namen des jetzigen Besitzers von Elgenstein zum erstenmal hörte, als hätte ich ihn bereits in Beziehung auf eine uns angehende Angelegenheit gehört …! – Hier steht es schwarz auf weiß, daß der andere damals bei einem Kaufmann Hübner in Bergedorf bei Hannover … – Na – ich brauche wohl nichts mehr zu sagen, nicht wahr? Du besinnst dich jetzt wohl.“
Der Graf nickte. Auch in sein schlaffes Gesicht war jetzt ein Ausdruck von Spannung getreten. Und er fragte eilig:
„Vicky – sollte etwa unser Hübner hier derselbe sein? Fast scheint es so. In Bergedorf hat er doch seine Konservenfabrik gehabt. – Hm – ob dann der, den uns diese Nacht mit ihrem Gewitter ins Haus gebracht hat, nicht der … – Aber nein,“ unterbrach er sich, „der Assessor erzählte mir ja, daß Herr Semper Nemo – wozu der Mensch wohl nur diesen merkwürdigen Namen angenommen haben mag?! – bei Hübners die Gäste durch Gesangsvorträge unterhalten hat. Es ist also Heinz, und nicht Erwin.“
„Darüber war ich mir sehr bald klar,“ sagte die Gräfin. „Wäre es Erwin, dann wüßte ich jetzt, wie er hier in unsere Gegend gekommen – eben Hübners wegen, vielleicht um den Millionär um Unterstützung zu bitten. So aber stehe ich leider noch immer vor der mich beunruhigenden Frage, ob es lediglich einem Zufall zuzuschreiben ist, daß Heinz in unserer Nähe plötzlich auftaucht. – Nun – jedenfalls gilt es, die Augen jetzt sehr gut offenzuhalten. Und diesen Hübner und seine Tochter müssen wir, das sehe ich nunmehr ein, notgedrungen näher kennenlernen, geradeso wie es unsere Interessen verlangen, daß der Verletzte bei uns bleibt und hier von dem Kreisarzt weiter behandelt wird.“
Sie schaute einen Moment nachdenklich vor sich hin und spielte mit ihrer goldenen Lorgnette.
„Die Umstände erfordern also,“ fügte sie dann hinzu, „daß wir unsere Taktik von Grund auf ändern. Ich werde Hübners und den Assessor sofort bitten, einige Erfrischungen bei uns einzunehmen. – Komm’, gehen wir an die Brandstelle. Dort finden wir die Marionetten, die wir für unser Spiel brauchen.“
Der Graf erhob sich.
„Vicky, du hättest einen Diplomaten heiraten sollen,“ meinte er bewundernd.
„Das ist richtig. Politisches Intrigenspiel hätte mich noch mehr gereizt als dieses.“
3. Kapitel.
Es war längst heller Tag, als das Hübnersche Auto wieder vor der Terrasse des Schlosses Elgenstein hielt.
Müde und übernächtigt stiegen Vater und Tochter aus. Bürgermeister Lankner und der Assessor blieben sitzen, da der Kraftwagen sie sofort weiter nach der Stadt bringen sollte.
Man verabschiedete sich. Und Lankner rief dem Schloßherrn noch zu:
„Verehrtester – Sie werden Ihre Wette verlieren, – passen Sie auf!“
August Hübner lächelte etwas gezwungen.
„Ausgeschlossen!“ meinte er.
Dann rollte das Auto davon.
Vater und Tochter ließen sich in der Vorhalle von dem Diener die leichten Staubmäntel abnehmen.
„Ich möchte dich noch sprechen,“ sagte der Millionär dann abgespannt. „Komm’ auf mein Zimmer. Ob wir um fünf oder halt sechs schlafen gehen, bleibt sich gleich.“ –
Die beiden saßen sich in dem geschmackvoll und modern eingerichteten Herrenzimmer gegenüber.
„Wer hätte wohl geahnt, Kind, das dieses unser Parkfest solch einen Abschluß finden würde,“ begann der frühere Fabrikbesitzer nachdenklich. „Ich wünschte beinahe, dieses Fest hätte überhaupt nicht stattgefunden. Ich will dir ja keinen Vorwurf machen, Ellen, aber, dieser Schleiertanz war ein Leichtsinn! Du hast ja gehört, daß Lankner rein darauf versessen ist herauszubekommen, wer die Tänzerin war. Wirklich ein netter Spaß, daß er mich zu dieser Wette gedrängt hat, gerade mich! Ein Korb Sekt dafür, daß er in vierzehn Tagen Namen und Alter der Tänzerin festgestellt hat …!! – Bedenke, Kind, wenn diese Kleinstädter hier erfahren, daß du dich vor unseren Gästen produziert hast, tun Sie uns in Acht und Bann. Es sind ja zumeist recht nette Menschen, aber dafür hat sicher keiner Verständnis, daß eine junge Dame, die mal aus einer Laune heraus diese Kunst des Schleiertanzes erlernte, einer noch seltsameren Laune nachgab und als Schlußnummer einer Vorstellung von Seiltänzern auftrat …!!“
Ellen nickte.
„Ich gebe dir recht, Papa. Es wäre besser gewesen, dieses Mal die plötzlich in mir erwachende Sucht nach etwas Außergewöhnlichem zu unterdrücken. Aber – zuweilen begreife ich mich selbst nicht. Ich bin doch das Kind eines sehr kühl und klar denkenden Vaters und einer alles andere als phantastischen Mutter. Wie kommt nur dieser Schuß Vagabundenblut in meine Adern? Etwa von Mamas Vater her, der ja wohl eine reichbewegte Vergangenheit hinter sich hatte, bevor er solider Obstzüchter wurde …?!“
„Wahrscheinlich. Die Vererbungstheorie kennt viel Merkwürdiges. – Hoffen wir, daß Lankner die Wette verliert. Gesehen hat dich doch niemand, als du vor und nach dem Tanz das Schloß durch den Turmeingang verließest beziehungsweise wieder betratst?“
„Niemand. Im Park begegnete mir nur dieser Semper Nemo, dieser rätselhafte Mensch. Das erzählte ich ihr ja schon. Und der ahnt natürlich nichts – nichts! Nur mein japanisches Parfüm werde ich nicht mehr benutzen dürfen. Das könnte mich verraten.“
August Hübner wiegte wie unzufrieden den Charakterkopfes hin und her.
„Ja – dieser Semper …!“ meinte er. „Auch ihn hat nur das Fest uns zugeführt. Er sagte ja, daß er, als er sich verirrt hatte, den Klängen der Musik nachgegangen und so schließlich in den Park gelangt wäre.“
Ellen lächelte ein wenig.
„Papa, ob diese Geschichte stimmt? – Verirrt, hier in unserer Gegend?! Er behauptete, über die Heide gekommen zu sein. Den Turm von Elgenstein sieht man doch in einer Sommernacht wie jetzt mit seinem weißen Anstrich sehr, sehr weit. Ich glaube an dieses Verirren nicht.“
Er wurde aufmerksam.
„Was glaubst du denn?“ fragte er schnell.
„Vorläufig nichts weiter als das, was ich eben sagte. Dieser Semper Nemo, der jenem Erwin so unheimlich ähnlich sieht und doch ein anderer ist, entwickelt sich immer mehr zu einer rätselhaften Persönlichkeit.“
Ellen berichtete ihr Erlebnis mit dem alten Stromer an der Brandstätte.
„Ich gehe jede Wette ein,“ fügte sie zum Schluß hinzu „daß zwischen diesem Vagabunden, der trotz seiner Zerlumptheit den gebildeten Menschen nicht ganz verleugnete, und Semper Nemo nähere Beziehungen bestehen. Der Alte spielte mir plötzlich zu sehr den Durchschnittsstrolch.“
Jetzt lächelte der Millionär etwas nachsichtig.
„Kind, du bist schon wieder auf der Jagd nach außergewöhnlichem,“ sagte er dann warnend.
Aber Ellen nahm diese Anspielung auf den leichtsinnigen Schleiertanz gelassen hin.
„Mein Erlebnis mit dem Alten ist ja noch nicht ganz zu Ende. – Bevor wir Palwitzkowo verließen, war Schaumburg noch im Krankenzimmer bei Semper, um sich von dem wieder zum Bewußtsein Gekommenen zu verabschieden. Vorher hatte ich den Assessor nun gebeten, Semper zu erzählen, daß ein alter Landstreicher sich nach ihm sehr eingehend bei mir erkundigt hätte. Schaumburg tat’s und wußte mir nachher zu berichten, daß Erwins Doppelgänger sehr rot und verlegen geworden wäre, als er hörte, wie dankbar der Stromer noch seines ‚Wohltäters’ wegen der fünfzig Pfennige ‚zu Schnaps’ gedenke. – Hatte Semper nötig, deswegen sich zu verfärben, Papa?“
„Hm – merkwürdig!! – Na – ich sage ja, dieses Fest bringt uns nichts wie Unruhe! Ich will hier friedlich meinen Kohl bauen und nicht … an Dinge erinnert werden, die … die … Du weißt, was ich meine …!“
„Ich weiß. – Diese Dinge siehst du leider noch immer in falscher Beleuchtung, Papa ich wiederhole dir heute nochmals, ich war damals noch ein halbes Kind, als ich für Erwin schwärmte. Mehr als Schwärmerei meinerseits war es ja nicht. Ich habe nie einen seiner Briefe beantwortet, diese sogar schließlich stets ungelesen verbrannt.“
„Nur davon warst du nicht überzeugen, daß nur er damals die Hand im Spiel gehabt haben konnte! Und durch diese hartnäckige Verteidigung dieses Menschen kam der Argwohn bei mir nie zum Schweigen, du könntest doch mit dem Herzen mehr beteiligt gewesen sein, als du es selbst ahntest.“
„Lassen wir die Sache ruhen, Papa. Darüber sind Jahre ins Land gegangen. Ich dachte nie mehr daran, wirklich nicht. – Was sagst du eigentlich zu dem Verhalten Palwitzkis uns gegenüber. Komische Leute sind’s! Erst wollen sie uns Semper gern zum Gesundpflegen überlassen, dann plötzlich wendet sich das Blatt und sie tun, als ob sie sich geradezu … danach reißen, ihn bei sich zu behalten. Auch ihre Liebenswürdigkeit uns gegenüber, nachdem sie sich zunächst beinahe verletzend ablehnend gezeigt und sich kaum um uns gekümmert haben, erschien mir seltsam. Diese Gräfin war ganz Saccharin, und der Graf der reine Honig.“
August Hübner mußte lachen.
„Saccharin? Wie so das? – Honig verstehe ich, aber – Saccharin?“
„Ist bekanntlich künstliche Süßigkeit, chemisches Produkt, Papa. Und die Liebenswürdigkeit der eisigen Gräfin war meines Erachtens eben auch gekünstelt. Und gleich zu Morgen zum Nachmittagstee einzuladen, hätte sie selbst deswegen nicht nötig gehabt, weil wir ihnen mit unserer neuen Spritze zu Hilfe gekommen sind.“
„Nun – wir haben ja auch unter einem Vorwand abgelehnt,“ meinte der Schloßherr gähnend. „Doch jetzt gehe ich schlafen. Die ganze Nacht will ich doch nicht opfern. Mit fünfzig Jahren ist man dazu nicht mehr jung genug.“ – –
Als das Hübnerscher Auto sich der Stadt näherte, überholte man den wohlbekannten, mit zwei Schimmeln bespannten Wagen des Kreisarztes. Der alte Herr war von Palwitzkowo noch zu einem zweiten dringenden Besuch gleich weitergefahren.
Der Kraftwagen hielt einen Augenblick, und der Kreisarzt rief Schaumburg zu, dieser möge ihn doch daheim erwarten. „Nur auf ein paar Worte, Assessor. Dann können Sie gleich in die Federn,“ fügte er hinzu.
„Was mag der Geheimrat nur wollen?“ meinte Lankner, der als Stadtoberhaupt gern in alles eingeweiht war. Es gab sogar Leute, die behaupteten, er sei neugierig wie ein altes Weib.
„Keine Ahnung,“ erwiderte Schaumburg. „Doch halt, da fällt mir eben ein, es wird sich wohl um die Sektion der Leiche der tot in ihrer Wohnung aufgefundenen Rentiere Müller handeln.“
Der Assessor irrte sich. Als der Kreisarzt bei ihm erschien und den dargebotenen guten Kognak zur Auffrischung der Lebensgeister getrunken hatte, sagte er:
„Hören Sie, Schaumburg, ich komme eben aus Branken. Dort wollte doch dieser Herr Semper Nemo abgestiegen sein, nicht wahr? Nun – im Wirtshaus bei Miontzki kennt ihn kein Mensch. Es ist das beste in Branken, und das machte mich stutzig. Ich wollte nämlich den Miontzi davon verständigen, daß sein Gast mit gebrochenem Bein in Palwitzkowo liege. So fragte ich auch im zweiten Wirtshaus nach – ebenso erfolglos. Der Herr hat also ein wenig geschwindelt. Ich messe der Sache durchaus keine große Bedeutung bei. Aber – sagen Sie selbst, eignet sich unsere Gegend, die doch recht dicht bebaut ist, dazu, sich meilenweit zu verirren?!“
Der Assessor, der am Amtsgericht in Schöneck die Strafsachen bearbeitete, nickte zerstreut.
„Ganz unter uns, Herr Geheimrat,“ meinte er dann nachdenklich, „mir ist es so vorgekommen, als sei dieser Sänger Hübners kein Fremder, oder, genauer ausgedrückt, als ob Vater und Tochter für ihn ein besonderes Interesse hätten. Ich habe bei Tisch achtgegeben und so Verschiedenes bemerkt, was mich stutzig machte. Hübner schaute den ihm so plötzlich ins Haus geschneiten Gast immer so sinnend und prüfend an. Und nachher bei Palwitzkis, als es sich darum handelte, wer den Verletzten bis zur Genesung bei sich aufnehmen solle, kam es zwischen Fräulein Ellen und der Gräfin geradezu zu einem edlen Wettstreit. Um einen Wildfremden hätte Fräulein Hübner sich wohl kaum so eifrig bemüht.“
„Merkwürdig!“ sagte der Kreisarzt und griff nach der Mütze. „Na – es wird sich ja bald herausstellen, wie hier der Hase läuft … Übrigens sonst ein netter Mensch, der Nemo. Nur – wie kann einer Nemo – Niemand! – heißen …! Komisch, nicht?“
Schaumburg erwiderte nichts. Gleich darauf war er allein.
Teil III
Schwüle Sommertage.
1. Kapitel.
Fritz Schaumburg bewohnte drei möblierte Zimmer bei der verwitweten Frau Steuerrad Anton. Die Steuerrätin und ihre einzige Tochter Anna begnügten sich mit den beiden Hinterzimmern. Eigentlich hätte die Rätin es ja nicht nötig gehabt, sich so einzuschränken. Aber von dem durch den ‚möblierten Herrn’ ersparten Geld konnte man seit langem jährlich eine kleine Reise machen. Und Reisen taten Mutter und Tochter für ihr Leben gern. Sonst hielten sie sich in Schöneck ganz für sich. –
„Verkehr heißt hier ja doch nur ‚sich gegenseitig beklatschen’,“ – das war das Urteil der Rätin über die Schönecker Geselligkeit. Und damit hatte sie nicht ganz unrecht.
Ein volles Jahr wohnte der Assessor nun schon bei der Frau Rat. Und sie waren stets sehr gut miteinander ausgekommen. Erst hatte wohl das vierundzwanzigjährige, schon leicht altjüngverliche Ännchen so etwas den Versuch gemacht, den reichen Juristen, den sie heimlich bald als ihre so und sovielste unglückliche Liebe anschwärmte, mit ihren naiven Künsten in ein solides Verlobungnetz zu locken. Aber schnell mußte sie einsehen, daß Fritz Schaumburg in ihrer Lebenslotterie ebenfalls eine Niete bedeutete. Er war gleichbleibend freundlich zu ihr, scherzte mit ihr und führte sehr geschickt zwischen ihnen jenen Ton guter Kameradschaft ein, der keine Hoffnung auf zärtlichere Beziehungen aufkommen läßt. Mit dieser zu Grabe getragenen Hoffnung aber begann für das äußerlich wirklich gar nicht einmal ganz reizlose Ännchen eine neue Zeit. Sie und die Mutter wachten über Fritz Schaumburg, daß er ja nicht einer anderen, unwürdigen von denen, die ihm nachstellten, zum Opfer fiel.
Kein Wunder, wenn die beiden Tönchens, wie der Assessor sie zu nennen pflegte, fast in Verzweiflung gerieten, als sie vor acht Wochen merkten, daß Schaumburg offenbar der Tochter des neuen Besitzers von Elgenstein mit den ernstesten Absichten den Hof machte. Sie kannten diese Ellen Hübner nicht, hatten sie kaum einmal im eleganten Selbstkutschierer vorüberfahren sehen. Was mit den einzelnen Knospen des heiratsfähigen Schönecker Damenflors ‚los war’, wußten die Tönchens sehr genau und hätten daher im Bedarfsfalle auch rechtzeitig warnen können. Aber Ellen Hübner war ihnen eine wildfremde. Gewiß – in Schöneck ging über die reiche Erbin bald eine sehr wenig günstige Charakteristik um. Aber darauf gaben Mutter und Tochter Anton nichts. Neid und Mißgunst brauten hier grundlos oft die vernichtensten Urteile über Menschen zusammen. Das war ihnen nur zu gut bekannt. Und die Tönchens gehörten aber trotz all ihrer Besonderheiten zu den grundanständigen Seelen, die selbst grobe Fehler suchten. – –
Mutter und Tochter waren gerade bei der Morgentoilette, als Schaumburg heimkehrte und dann auch gleich darauf der Kreisarzt sich einfand, der aber sehr bald wieder das Haus verließ.
„Nach sechs Uhr morgens kommt er nach Hause!!“ meinte Ännchen leicht entrüstet. „Das ist noch nie vorgekommen!“
„Vielleicht hätte er sich ‚draußen’ verlobt,“ sagte die Rätin seufzend. „Hoffentlich schlägt’s ihm dann zum Glück aus …!! Er ist mir ja wirklich in diesem einen Jahr wie ein Sohn ans Herz gewachsen.“
Zehn Minuten später klopfte es leise.
„Frau Rat, sind Sie schon auf?“ fragte der Assessor durch die geschlossene Tür. „Ah – guten Morgen! Bitte um recht starken Kaffee heute. Ich will mich nicht mehr schlafen legen. Es lohnt nicht.“ –
Die Rätin erfuhr dann eine Viertelstunde später von dem großen Brand in Palwitzkowo und auch Einzelheiten über das Parkfest. – Nun war ihres Mieters langes Ausbleiben derart genügend erklärt. Sie atmete auf.
Schaumburg nahm dann nach dem Morgenkaffee in seinem Arbeitszimmer noch ein paar unerledigte Aktenstücke vor. Er hatte sich eine Zigarre angezündet und fühlte sich, zumal er wie immer sich noch kräftig abgeduscht hatte, völlig frisch.
Und doch war’s mit der Arbeit nichts. Die vielseitigen Eindrücke der verflossenen Nacht wirkten noch zu lebhaft in ihm nach. Und noch etwas anderes …
Er war unzufrieden mit sich. Er liebte keine Halbheiten. In keiner Beziehung. Sein Wahlspruch war ‚Entweder ganz oder gar nicht!’ – Und dieses wärmere Gefühl, das er eine Zeit lang für Ellen Hübner zu empfinden glaubte, war eine Halbheit gewesen. Auch das hatte er in den letzten Tagen immer mehr eingesehen. Im Verkehr mit Ellen hatte sich gegen seinen Willen etwa derselbe Ton eingebunden, den er absichtlich zwischen sich und Ännchen Anton eingeführt hatte, etwas zwanglos Freundschaftliches, das außerhalb heißerer Wünsche lag.
Schaumburg hatte Ellen zunächst als der Vertreterin jener Gesellschaftssphäre gehuldigt, die ihm, dem geborenen Berliner und Sohn eines aus eigener Kraft emporgekommenen Mannes, lieb geworden war, in der er Anregung und auch Ansichten vertreten fand, die ihm als modernen Menschen zum Leben nötig waren. Alles Rückständige verachtete er. Nichts war ihm verhaßter als Schablonenmenschen, denen das fehlte, was man Persönlichkeit nennt.
Hübners, Vater und Tochter, waren beide aus dem Alltäglichen herausgewachsen. Und so hatte Schaumburg seine Besuche in Elgenstein immer häufiger wiederholt, da ihm dort in dem alten Schloße Menschen einer modernen Zeit stets freudig begrüßten. Daß August Hübner ihn schätzte, merkte er sehr bald. Und Ellen …?! – Sechs Wochen lang bestand zwischen ihnen jener heitere Kriegszustand, der nach eifriger Belagerung der erwünschten Feste zumeist mit einer Verlobung zu endigen pflegt. Aber der Kriegszustand glitt allgemach in einen harmlos kameradschaftlichen Waffenstillstand über. Und heute Morgen kam Fritz Schaumburg über seine Gefühle mit sich völlig ins klare – endlich!
Ellen und er passten wohl sehr gut für einander, aber – es fehlte eben jene heiße, sinnbetörende Leidenschaft, ohne die es eine Vernunftsehe geworden wäre, vielleicht ein stillzufriedenes Nebeneinanderleben, aber kein Glück, wie der Assessor es ersehnte.
Diese Erkenntnis wirkte auf ihn geradezu befreiend. Daß Ellen in ihm gleichfalls nur den seelenverwandten Freund sah, erschien ihm gewiß. Also gab es in Elgenstein keinerlei Enttäuschung zu verwinden, wenn eine Werbung ausblieb. Vielleicht bei August Hübner doch so etwas – vielleicht! Dem wäre er als Schwiegersohn nur angenehm gewesen. –
Fritz Schaumburg zündete die ausgegangene Zigarre von frischem an. Eigentlich hätte er nun ja seine Arbeit wieder aufnehmen können. Aber er blies, zurückgelehnt in seinen Schreibtischstuhl, nachdenklich den Rauch der grünbraunen Importe vor sich hin. Er war ein ehrlicher Mensch, auch gegen sich selbst. Und deshalb verhehlte er sich nicht, daß es ganz bestimmte Ursachen gehabt hatte, wenn er gerade heute nach dieser Nacht seine Gefühle für Ellen so genau zerlegt und geprüft hatte.
Die Komtesse Adda Palwitzki war ihm sofort aufgefallen, als er ihr vor – ja – vor vielleicht fünf Stunden vorgestellt wurde. Alles an diesem jungen Weibe war Rasse und Eigenart. In den dunklen Augen mit den langen Wimpern lag ihre Seele. Fritz Schaumburg wußte Frauen zu beurteilen.
Sie war die einzige, die ihm von der gräflichen Familie gefallen und die sich gegenüber den aus Elgenstein zu Hilfe Geeilten von vornherein so benommen hatte, wie es die Umstände verlangten. Ohne Zweifel war sie aus dem engen Kreise von Standesvorurteilen und dünkelhafter Beschränktheit längst herausgewachsen. Als die Gräfin die beiden Hübners, den Bürgermeister und ihn persönlich ins Herrenhaus geholt hatte, wo ihnen Erfrischungen gereicht wurden, bot sich ihm Gelegenheit, wohl eine Stunde mit Adda zu plaudern, da Graf Palwitzki der Ältere als unverbesserlicher Verehrer holder Weiblichkeit Ellen vollständig mit Beschlag belegt hatte. Wie so häufig im Leben, hatte auch hier diese eine Stunde genügt, um zwei Menschen einander näherzubringen, die sonst wohl weiter allein ihren Lebensweg gegangen wären.
Fritz Schaumburg warf die abermals erloschene Zigarre in den Aschbecher – mit einem gewissen Unmut. Bisher war sein Leben hier in der kleinen Kreisstadt mit ihrer landschaftlich so reizvollen Umgebung in vollem Frieden ohne große Erregung dahingeflossen. Nun war das mit einem Schlag anders geworden. Gewiß – seine Besuche in Elgenstein hatten in der ersten Zeit stets eine erwartungsvolle Vorfreude in ihm geweckt. Aber auch die war täglich schwächer geworden. Und nun dieses Parkfest, diese eine Nacht …!! Erst die maskierte Tänzerin, die die ganzen Gäste August Hübners in helle Aufregung versetzte. Jeder hatte den Schloßherrn bestürmt, um den Namen dieser geschmeidigen Künstlerin zu erfahren. Alles vergeblich! Auch aus Ellen war nichts herauszubringen! – Und dann das Auftauchen dieses Herrn Semper Nemo, der sich doch offenbar, wie aus den Angaben des Kreisarztes hervorging, immer mehr zu einer geheimnisvollen Persönlichkeit entwickelte. Weiter der Scheunenbrand in Palwitzkowo mit seinen Folgen, Semper Nemo als Verletzter in dem Herrenhause und die Anbahnung gesellschaftlichen Verkehrs mit der gräflichen Familie. – –
Und all das hatte sich in genau zwölf Stunden abgespielt.
Fritz Schaumburg stieg eine dunkle Ahnung auf, daß die nächsten Tage manches bringen würden, was er jetzt nur erst wie von Nebelmassen verhüllt kaum in verschwommenen Umrissen vor sich sah.
Zum dritten Male beugte er sich jetzt über die Untersuchungsakten ‚Krawat und Genossen wegen Diebstahls’. Dann hörte er draußen die Flurglocke schrillen. Gleich darauf klopfte es. Es war der Gerichtssekretär Henning, der in Schaumburgs Abteilung arbeitete, ein sehr fleißiger, gewissenhafter jüngerer Mann, der erst Referendar gewesen, dann aber die Subalternkarriere aus Mangel an Geldmitteln hatte einschlagen müssen.
Der Assessor reichte ihm die Hand. Sie standen in gleichem Alter, und Schaumburg behandelte den Sekretär stets mehr als Kollegen denn als Untergebenen.
Hans Henning, etwas linkisch und leicht verlegen, war heute sichtlich erregt. Er berichtete, daß soeben ein recht zerlumpter alter Mann dem Polizeiwachtmeister Dreher gemeldet habe, am Rande einer großen Torfgrube in der Heide liege ein Bündel Kleider. Der Brief, der oben auf den Sachen unverschlossen von dem alten Landstreicher gefunden wäre, lasse es nun als sicher erscheinen, daß es sich um Selbstmord handle, das hieß, daß der Besitzer der Kleidungsstücke als Leiche in der Torfgrube ruhe.
Schaumburg dachte an seine ungewisse Ahnung von vorhin. Die Aufregungen begannen also bereits … – –
Eine halbe Stunde später entführte ein Wagen den Assessor, den Sekretär, den Polizeiwachtmeister und oben auf dem Bock auch Tobias Frick aus der Stadt in den warmen Sommertag hinaus.
2. Kapitel.
August Hübner und Ellen saßen gegen elf Uhr vormittags auf der offenen, nach dem Wirtschaftsgarten gelegenen Veranda beim Frühstück. Beide sahen übernächtigt aus, obwohl sie einen Teil der versäumten Nachtruhe eben nachgeholt hatten.
„Weiß der Himmel, was Schaumburg mit den drei Arbeitern und den Stangen und Stricken, die er sich vom Inspektor ausgebeten hat, wollen mag,“ meinte der Schloßherr, ein Gähnen unterdrückend. „Das alles riecht beinahe nach Mord und Todschlag, besonders da er selbst dem Inspektor keinen näheren Aufschluß gegeben hat.“
In demselben Augenblick erschien ein Diener und meldete den Assessor.
Dieser brachte auch den bescheidenen Hans Henning mit, der von Hübners sehr freundlich empfangen und ebenso wie Schaumburg zum Frühstück eingeladen wurde.
Der Assessor stöhnte, trank ein Glas Limonade, schimpfte auf die Hitze und begann dann zu erzählen.
Man hatte den Toten unschwer bergen können, auch den Revolver gefunden, mit dem der Lebensmüde am Rande der Torfgrube sich eine Kugel in die Schläfe gejagt hatte.
„Die Leiche ist vorläufig in einer leeren Wagenremise hier bei Ihnen untergebracht worden, Herr Hübner,“ fuhr Schaumburg fort. „Sie werden ja wohl nichts dagegen haben. Wenn es sie interessiert, hier ist der Brief, in dem noch ein Hundertmarkschein lag.“
Der Schloßherr überflog die wenigen Zeilen.
„Ein seltsames Schreiben,“ sagte er dann. „Schrift und Stil verraten den Gebildeten. – Und seine Kleider waren wirklich so schlecht?“
„Eigentlich nur bessere Lumpen,“ erklärte der Assessor ernst. „Jedenfalls haben wir nichts gefunden, was dazu dienen könnte, die Person des Toten festzustellen.“
Hübner reichte seiner Tochter den Brief – ganz ahnungslos.
Kaum hatte Ellen einen Moment die Schriftzüge betrachtet, als sie erbleichte, einen leisen Schrei ausstieß und in dem Korbsessel, wie von einer plötzlichen Schwäche befallen, zurücksank.
Die drei Herren sprangen gleichzeitig erschreckt auf. Aber Ellen hatte sich schon wieder gefaßt.
„Kind, was gibt’s denn nur? Hat dich der Inhalt dieses letzten Grußes eines Toten an diese schlechte Welt so angegriffen?“ meinte der Schloßherr besorgt, indem er ihr ein Glas Wein reichte. „Da – trink, Kind, – los, los, – das bringt dich und deinen Nerven schnell wieder in Ordnung.“
Ellen lehrte das Rotweinglas in kleinen Schlucken. So fand sie Zeit zum Überleben.
Diese Handschrift, diese schrägen, großen, so eigenwilligen Buchstaben hätte sie unter Hunderten herausgefunden – mit einem Blick. – Sollte sie sagen, was sie wußte? Die Frage war nicht leicht zu entscheiden. Aber – weswegen schließlich schweigen? Weswegen …?! Und – durfte sie es überhaupt? Würde nicht auch der Vater von ihr verlangen, daß sie den Behörden bei der Identifizierung des Toten zu Hilfe kam? Ihn konnte sie doch nicht belügen und tun, als habe es sich bei diesem erschreckten Auflachen wirklich nur um ein Versagen ihrer Nerven gehandelt …!“
Drei Augenpaare waren auf sie gerichtet. Ruhig stellte sie jetzt das Glas auf den Tisch zurück.
„Ich kenne diese Handschrift,“ sagte sie einfach. „Sie ist so charakteristisch, daß ein Irrtum ausgeschlossen erscheint.“
August Hübner wußte sofort Bescheid.
„Erwin Vanbaren?“ fragte er schnell.
Ellen nickte.
Jetzt schenkte der Schloßherr sich ebenfalls ein Glas Rotwein mit zitternder Hand ein und stürzte es hinunter.
„Unbegreiflich – unbegreiflich das alles,“ meinte er dann kopfschüttelnd. „Gestern erst der Doppelgänger und heute er selbst …?! – Was bedeutet das? Mir ist ganz wirr …“
Schaumburg und Hans Henning waren nicht viel weniger überrascht. Besonders Hübners Bemerkung über den Doppelgänger suchten sie sich umsonst zu erklären.
Der Assessor wurde jetzt ganz Amtsperson. Er wandte sich an Ellen, die verträumt und ergriffen hinaus in den sonnendurchglühten Garten blickte.
„Das Gesicht des Toten ist leider dadurch, daß es beim Sturz in die Torfgrube auf einen Pfahl aufprallte, recht entstellt,“ sagte er. „Aber vielleicht würden sie den Armen doch wiedererkennen – oder Ihr Herr Vater, falls dieser Vanbaren ebenfalls gekannt hat.“
Ellen schauderte leicht zusammen.
Da fuhr Schaumburg schnell fort: „Sie nickten eben, Herr Hübner. Sie sind also imstande, den Toten zu rekognoszieren, nicht wahr? – Gut, dann können wir Fräulein Ellen den Gang nach der Remise ersparen.“
„Wenn der Lebensmüde Erwin Vanbaren wirklich ist, dann muß er ein untrügliches Kennzeichen besitzen,“ sagte der Schloßherr leise. „Und zwar eine weiße Haarsträhne in Größe eines Zehnpfennigstückes oben auf dem Scheitel nach dem Hinterkopf zu.“
„Stimmt!“ meinte der Assessor eifrig. „Die Strähne fällt sofort auf. – Sie haben Sie doch auch bemerkt, Herr Henning?“
Der Sekretär bejahte.
„Dann besteht kein Zweifel mehr,“ sagte Hübner. „Es ist Vanbaren. Immerhin – kommen Sie! Ich will mir den Toten ansehen.“
Auch Ellen ging mit bis vor die Tür der Remise. Man sprach nicht viel auf dem kurzen Weg.
Dann traten die Herren ein.
Der Selbstmörder lag auf einer alten Wagendecke und war mit seinen Kleidern bedeckt. Nachdem Henning das Gesicht freigelegt und Hübner es eine Weile betrachtet hatte, sagte dieser zu Schaumburg:
„Können Sie nicht trotz der einen geschwollenen Gesichtshälfte eine Ähnlichkeit mit jemandem feststellen, den Sie unlängst kennengelernt haben? Besinnen Sie sich nur …“
Aber der Assessor schüttelte den Kopf. Und Hübner meinte nun:
„Gehen wir wieder ins Schloß zurück. Dort sollen Sie alles erfahren, was ich von Vanbaren weiß. Viel ist es nicht. Das schicke ich voraus.“
Als die drei ins Freie, in den hellen, prachtvollen Sommertag, zurücktraten, stand Ellen im Schatten des Schuppens vor Tobias Frick; ein paar Schritte weiter aber Polizeiwachtmeister Dreher.
„Dies ist der Alte, der die Kleider und den Brief am Rande der Torfgrube gefunden hat,“ erklärte Schaumburg dem Schloßherrn.
Hübner musterte den alten Landstreicher scharf.
„Was treiben Sie hier, Mann?“ fragte er Tobias forschend. „Sind Sie fremd in dieser Gegend?“
„Ich bin nirgends fremd,“ meinte der ehemalige Klown mit trotzigem Selbstbewußtsein. „Ein fahrender Künstler ist überall zu Hause.“
Da mischte sich der Wachtmeister dienstbeflissen ein:
„Die Papiere des Mannes sind in Ordnung. Aber natürlich ist’s ein Stromer, das sieht man ihm ja an.“
„Und dazu noch einer, der so dumm ist, einen Hundertmarkschein und einen Brief abzuliefern, obwohl er damit hätte getrost verschwinden können,“ sagte Tobias Frick bitter.
„Sie sind ein ehrlicher Kerl,“ meinte Schaumburg da, indem er dem Alten freundlich zunickte. „Ich werde Sie gleich nachher zu Protokoll vernehmen, und dann können Sie gehen, wohin Sie wollen.“
„Will ich gar nicht,“ brummte der Alte. „Möchte gern eine Weile hier Arbeit haben. Ich kann schon noch was leisten. Schafe hüten zum Beispiel, dort auf der Heide. Das möchte ich gern.“
Ellen wandte sich an ihren Vater.
„Ich spreche noch mit dir dieses Mannes wegen.“ Und zu Tobias Frick: „Gehen Sie in die Wirtschaftsküche und lassen Sie sich zu essen und zu trinken geben.“ –
Auf der kühlen Veranda wurde dann das Protokoll angefertigt. Als erster mußte der alte Landstreicher seine Aussage machen. Er log nicht, wenn er angab, er hätte das Bündel abgetragene Kleidungsstücke neben der Torfgrube gefunden, da Gottfried Blendel diese Semper gehörigen Sachen vorher dort hingelegt hatte. Von Semper erwähnte er ebensowenig ein Wort wie von dem langjährigen Gefährten, der seiner jetzt draußen in der Schäferhütte sicher schon voller Ungeduld wartete. – Immerhin ging die Vernehmung des Alten doch nicht ganz ohne einen etwas eigenartigen Zwischenfall vorüber.
Als der Sekretär jetzt das Protokoll auch mit den Eingangsbemerkungen vorlas … „Männliche, entkleidete Leiche, Schußwunde in der linken Schläfe, besondere Kennzeichen: weiße Haarsträhne auf dem Scheitel …“, da fuhr Tobias Frick heftig zusammen und fragte schnell:
„Weiße Haarsträhne, habe ich recht gehört?“
„Ja,“ meinte Hans Henning würdevollen. „Ich Ihnen die denn nicht schon aufgefallen, als wir die Leiche bargen?“
In Tobias Mienen drückte sich jetzt deutlich ein grübelndes Nachdenken aus.
„Nein,“ erwiderte er zerstreut.
Und nachher unterzeichnete er das Protokoll mit seinem verschnörkelten, flott hingeworfenen Namenszug. – Dann war er entlassen, zog seinen löchrigen Filz und ging durch den Wirtschaftsgarten davon. Hinter der ersten Hecke aber machte er halt. Und sehr bald erschien auch Ellen an dieser Stelle, die sich unter einem Vorwand von der Veranda entfernt hatte.
Eine ganze Weile sprach sich eifrig auf den ehemaligen Klown ein. Dann verschwand dieser in der Richtung nach der Heide zu, nachdem er sich bei Ellen noch wortreich für alles Gute bedankt hatte. –
Inzwischen gab August Hübner das zu Protokoll, was er von Erwin Vanbaren wußte.
„Es sind jetzt so ungefähr fünf Jahre her. Ich hatte gerade in Bergedorf für meine Arbeiter ein Sonntagsheim mit Lesehalle und so weiter errichtet und wollte dieses innen nun recht geschmackvoll und passend durch Wandmalereien ausschmücken lassen, als sich mir persönlich ein junger Maler vorstellte, der von der Sache gehört hatte und mich nun bat, ihm die Arbeit zu übertragen. Er machte auf mich sofort einen recht sympathischen Eindruck. Jedenfalls vertraute ich ihm dann auch die Ausschmückung des Arbeiterheimes an. Ich merkte bald, daß er etwas von seinem Fach verstand, und schließlich brachten es die Umstände mit sich, daß ich ihn auch in mein Haus einlud, wo sich dann zwischen ihm und meiner Tochter so etwas wie eine kleine Schwärmerei entwickelte. Erwin Vanbaren mit seinen schwermütigen Augen und dem feingezeichneten Künstlerkopf konnte wohl recht leicht das Herz eines halben Kindes für sich einnehmen. Allmählich erfuhr ich nun auch – von der harmlosen Liebelei merkte ich zunächst nichts – näheres über seine Herkunft. Die war dunkel genug. Den Namen seiner richtigen Eltern wußte er nicht. Er war als ein Adoptivkind eines älteren Ehepaares aufgewachsen. Dieser Buchbinder Meister Vanbaren und seine Frau starben, als Erwin zwanzig Jahre alt war. Er hatte dasselbe Handwerk erlernt, obwohl er sich von Jugend an zum Maler berufen fühlte, hatte es erlernen müssen. Gleich nach dem Tode seiner Adoptiveltern folgte er seiner alten Neigung und wurde auch in kurzem ein recht tüchtiger Dekorationsmaler. Seinen ersten größeren Auftrag erhielt er bei mir. – Leider sollte ich aber bald zu meiner großen Enttäuschung erfahren, daß ich einem Unwürdigen meine wirklich väterliche Zuneigung geschenkt hatte. Eines Tages verschwand aus meinem Privatkontor eine Brieftasche mit einer größeren Geldsumme. Die leere Brieftasche fand drei Tage später ein Kriminalbeamter, der gegen Vanbaren Verdacht geschöpft hatte, in dem Malkasten des jungen Künstlers. Nachher wurde er zwar vor Gericht freigesprochen, aber … für mich ist er heute noch der Dieb. Er hat es dann noch längere Zeit gewagt, meine Tochter mit Briefen zu belästigen, die nie beantwortet wurden und meist ungelesen ins Feuer wanderten. – Wie gesagt – zwischen Ellen und ihm ist es nie zu größeren Vertraulichkeiten gekommen. Ellen war aber nicht davon zu überzeugen, daß er den Diebstahl verübt haben könnte. Junge Mädchen haben ja so wenig Lebenserfahrungen. – Wir verloren Erwin Vanbaren dann ganz aus den Augen. Nur vier- oder fünfmal wurde ich noch durch Anfragen an ihn erinnert, in denen Leute, die ihm Beschäftigung geben wollten, sich nach seinem Leumund erkundigten; ich habe stets der Wahrheit die Ehre gegeben. ‚Leistung gut, als Charakter sehr mit Vorsicht zu behandeln!’ – Gestern nun glaubte ich Vanbaren wieder vor mir zu haben, als sich Semper Nemo hier einfand. Die Ähnlichkeit zwischen beiden ist geradezu verblüffend. Selbst die Sprache gleicht sich vollkommen. Aber ich stellte bald fest, daß es doch nur ein Doppelgänger Vanbarens war. Herr Nemo hatte uns noch nie gesehen. Das merkte ich. Und auch seine musikalischen Leistungen hätte Vanbaren nie zustandegebracht. Er war nämlich so schlecht begabt für Musik, daß er nicht einmal ein Lied pfeifen konnte. Jedenfalls ist der Selbstmörder also Erwin Vanbaren und kein anderer. Er ist verdorben – gestorben – ein im Lebenskampf Gescheiterter.“
„Oder ein Unglücklicher,“ sagte Ellen da mit Nachdruck, die inzwischen wieder auf der Veranda erschienen war.
„Das wird sich jetzt leider nicht mehr feststellen lassen,“ meinte Schaumburg sinnend.
„Vielleicht doch, Herr Assessor,“ warf Ellen mit seltsam abwehrendem Blick ein.
Worauf ihr Vater erklärte:
„Lassen wir dem Toten seine Ruhe, Kind! Sein Wunsch soll jedenfalls erfüllt werden. Ich werde ihn in der Ostecke des Parkes auf dem Hügel zwischen den alten Linden anständig bestatten.“
3. Kapitel.
Gottfried Blendel hatte gerade, vor der Schäferhütte auf der Schattenseite im Heidekraut liegend, sehnsüchtig auf die Rückkehr seines Freundes Tobias gewartet, als der Oberinspektor von Elgenstein, der grobe Herr Bennemann, zu Pferde vorbeigekommen war.
Auf Landstreicher und ähnliches Gesindel war Bennemann schlecht zu sprechen. Es kam daher auch zwischen ihm und Friedel zu einer Auseinandersetzung, die vielleicht gar zu Tätlichkeiten ausgeartet wäre, da der Oberinspektor den ihn wütend angreifenden Wolfspitz überzureiten suchte.
Gerade zur rechten Zeit erschien Tobias Frick auf der Bildfläche. Ihn hatte Bennemann schon auf dem Gut gesehen und wußte auch, welche Rolle er bei der Auffindung des Selbstmörders gespielt hatte.
Tobias wartete gar nicht ab, bis der Oberinspektor auch ihn mit Schmähungen und Drohungen überhäufte, sondern erklärte sofort mit erhobener Stimme:
„Wir, mein Gefährte und ich, haben von Herrn Hübner durch Vermittlung des gnädigen Fräuleins die Erlaubnis erhalten, in dieser Schäferhütte so lange zu hausen, als es uns gefällt und uns auch täglich Essen aus der Leuteküche zu holen. Ebenfalls werden uns Stroh und ein paar Decken heraus geschafft werden. Wenn Sie das gnädige Fräulein fragen wollen, Herr Oberinspektor, so wird sie Ihnen dies alles bestätigen. Ich bitte uns also in Ruhe zu lassen. Wenn auch nur Landstreicher, so sind wir doch ehrliche Leute. Und jede Beleidigung dürften Sie vor Ihrem Gutsherrn zu verantworten haben, der auch mit dem geringsten Stromer anständig verkehrt.“
Es war ein Etwas in dem Auftreten des alten Klown, das Bennemann, der bei August Hübner überhaupt seiner Grobheit und Rohheit wegen nicht sehr fest im Sattel saß, zur Mäßigung mahnte. Um seinen Abgang von der Szene aber einigermaßen zu retten, brüllte er jetzt die beiden an:
„Ihr sollt mich kennen lernen, wenn du gelogen hast, alter Bursche!“ Dann gab er seinem Gaul die Sporen. Hinter ihm drein schallte Tobias’ Stimme:
„Es freut mich, daß Sie mit mir Brüderschaft schließen wollen, – auf Wiedersehen!“
Aber Herr Bennemann ließ sich nicht mehr blicken. In der Nähe des Gutes begegnete er zwei Knechten mit einem Handwagen, der mit Stroh, Decken, Tellern, Schüsseln, einem Kochtopf, einem eisernen Dreifuß zum Kochen und anderem beladen war.
Der Oberinspektor ritt fluchend weiter. –
Inzwischen hatte Tobias dem Freund über seine Erlebnisse genau Bericht erstattet.
„Diese kleinen Sommervilla gehört jetzt also vorläufig uns, Friedel. Fern von der uns verhaßten Kultur können wir hier tun und lassen, was uns gefällt. Nahrungssorgen gibt es nicht. Und wie prächtig ist’s hier mitten in der Heide …!“
„Und wie heiß!“ stöhnte Friedel. „Die Sonne meint’s zu gut mit uns! Sieh nur, wie die Luft über dem Boden flimmert. – Was meinst du, wenn wir unser Häuschen dort unter die Büsche und Birken trügen? Wie ein kleiner Garten sieht die Stelle dort aus.“
Tobias war einverstanden. – Bald kamen die Knechte mit dem Handwagen. Selbst zwei Päckchen Rauchtabak hatte Ellen mitgeschickt.
Den beiden Stromern machte es eine fast kindliche Freude, sich jetzt hier häuslich einzurichten. Sie hatten es ja auf ihren jahrelangen Wanderfahrten gelernt, aus dem Wenigen etwas Nützliches zu schaffen. So stellten sie sich vor der Hütte in kurzem eine Art Laube her, überspannten sie mit einer Decke und schufen noch manches andere zu ihrer Behaglichkeit.
Eifrig unterhielten sie sich während dieser Arbeiten. Semper Nemo bildete den Hauptgegenstand ihres Gespräches.
Tobias war sehr in Sorge, wie sich ihres jungen Freundes Zukunft gestalten würde.
„Bedenke, Friedel, daß er eine Rolle spielt, die er nicht lange wird durchhalten können,“ sagte er. „Wir wissen, daß er keinerlei Papiere besitzt. Er hat sich als Musiker, als Sänger ausgegeben. Wer weiß, wie das endet.“
Von der weißen Haarsträhne auf dem Scheitel Erwin Vanbarens hatte er merkwürdigerweise bei seinem Bericht ganz geschwiegen. Und doch kam ihm dieses auffallende Erkennungszeichen nicht aus dem Sinn. –
Ellen hatte den Knechten auch einen großen Topf Essen für Friedel mitgegeben. Nachdem der ehemalige Schulamtskandidat sich gesättigt hatte, begann er mit der Verschönerung seines Äußeren. Frick spottete darüber. Aber Blendel meinte, wenn die junge Dame wirklich nachmittags käme, wie sie versprochen habe, um nach dem Ergehen ihrer Schützlinge zu fragen, könnte er ihr nicht gut mit seinem verwilderten Bart gegenübertreten.
Und eifrig schnitt er mit einer verrosteten Schere an seinem grauen Gesichtsvorhang herum.
„Ich wünschte, das gnädige Fräulein ließe uns in Ruhe!“ knurrte Tobias und packte etwas verlegen sein Rasierzeug aus, um die Bartstoppeln zu entfernen, die bei der Wärme bereits wieder erheblich zum Vorschein gekommen waren. „Ich ahne schon, was sie will. Sie wird mir den schönen Sommertag durch allerlei Fragen verderben. Ihre Teilnahme für mich ist fraglos nicht ganz frei von etwas Selbstsucht. Ich wette, sie ahnt, daß Semper Nemo zu uns in näheren Beziehungen steht.“
Nachher streckte er sich im Heidekraut in der Laube zum Schlafen aus. Er wollte die versäumte Nachtruhe nachholen. – Aber Tobias und Friedel hatten sich umsonst heute in Wichs geworfen. Ellen Hübner kam nicht. Und das hatte seinen guten Grund.
Vater und Tochter saßen gerade bei einem Nachmittagskaffee auf der Veranda, als sich Graf und Gräfin Palwitzki anmelden ließen. Sie blieben eine gute Stunde, waren von bezaubernder Liebenswürdigkeit und ruhten nicht eher, bis Hübners sie nach Palwitzkowo begleiteten.
„Sie müssen doch unbedingt sehen, wie es Herrn Nemo geht,“ betonte die Gräfin. „Sie werden sich wundern, daß er sich so schnell erholt hat. Er ist schon ganz frisch wieder. Nur so still und traurig, der arme Mensch. Ihn scheint etwas zu bedrücken.“ –
Als man dann im Wagen des Grafen zu viert durch die Heide fuhr, stand am Wegrand ein abgerissener Vagabund mit faltigem, verwittertem Schauspielergesicht, der vor den Herrschaften den schäbigen Filz zog.
Ellen Hübner nickte Tobias freundlich zu, was die Gräfin zu der Frage veranlaßte:
„Wer war denn das? Ein seltsames Gesicht, wirklich!“
Das junge Mädchen gab über den Alten Auskunft. Viel wußte sie ja auch nicht von Tobias Frick. Aber sie betonte, der Mann müsse früher einmal bessere Tage gesehen haben.
Und August Hübner fügte hinzu: „Es ist derselbe Landstreicher, der die Kleider des Selbstmörders gefunden hat, von dem ich vorhin erzählte.“
Das gräfliche Paar hatte für den Leichenfund kein besonderes Interesse gehabt. Man war über den Gegenstand schnell hinweggeglitten. Frau von Palwitzki war alles unangenehm, was mit Tod und Vergänglichkeit zusammenhing.
Jetzt fragte sie, eigentlich mehr, um das Gespräch nicht wieder einschlafen zu lassen:
„Weiß man eigentlich, wer der Tote ist?“
Hübners hatten nichts darüber geäußert, daß sie den Lebensmüden einmal gekannt hatten. Jetzt glaubte der Besitzer von Elgenstein jedoch nicht länger eine Tatsache verheimlichen zu dürfen, die vielleicht nachher nur entstellt in der Stadt und auf den benachbarten Gütern weiterverbreitet wurde.
So wurde denn hier unweit der Stelle, wo Erwin Vanbaren sich das Leben genommen hatte, sein Name von August Hübner erwähnt. Diesem selbst entging es, welche Wirkung die beiden Worte auf den Grafen und seine Gattin ausübten. Aber Ellen, die Palwitzki wegen der von ihnen allzu stark aufgetragenen Liebenswürdigkeit mißtraute und vermutete, jene müßten hiermit bestimmte Absichten verbinden, ließ sich durch das Bestreben des Paares, seine Verwirrung zu bemänteln, nicht täuschen und war sich sehr bald darüber einig, daß Palwitzkis der Tote ebenfalls kein Fremder gewesen sein könne. Sie tat jedoch völlig harmlos, merkte aber dann sehr wohl, wie eifrig die Gräfin anzudeuten suchte, daß sie nie von einem Maler Vanbaren gehört hätten.
Daß ihr Mißtrauen gegen das gräfliche Paar sich hierdurch nur noch verstärkte, war nicht weiter verwunderlich. Jedenfalls nahm sie sich vor, die Augen gut offen zu halten. – –
Tobias Frick hatte dem Wagen mit merkwürdig verzerrtem Gesicht nachgeschaut. In seinen Augen funkelte es wie Haß, und seine Lippen hatten unheimliche Reden geformt, die man dem alten Mann gar nicht zugetraut hätte.
„Palwitzki … Palwitzki!!“ Er lachte kurz auf. „Ob ich den Namen kenne …!! Unzählige Jahre sind es her, seit ich ihn aus eines Menschen Munde hörte. Nun nannte ihn mir hier der alte Gutstagelöhner. – Palwitzki …!! Wie ich den Namen hasse! Es hat eine Zeit gegeben, da wäre ich eines Palwitzki wegen fast zum Mörder geworden…!!“
Dann schritt er wieder weiter von Gebüsch zu Gebüsch, um trockene Zweige einzusammeln. Er und Friedel wollten sich einen Tee von Lindenblüten zum Abend kochen. Der war gesund, reinigte das Blut und … kostet nichts. –
* * *
Semper Nemo war im Herrenhaus von Palwitzkowo in einem Zimmer im Erdgeschoß untergebracht worden.
Als er aus seiner Bewußtlosigkeit erwacht war, als er sich langsam in die Wirklichkeit zurückfand, hatten zwei Mädchengestalten neben dem breiten, altertümlichen Bett gestanden, in dem er mit verbundenem Kopf und geschientem Bein lag.
Es waren Adda Palwitzki und Ellen Hübner.
Draußen hatte gerade der Morgen gegraut. Und sein fahles Licht war seltsam verwischt mit dem gleichfalls durch die Fenster eindringenden rötlichen Feuerschein der brennenden Scheune.
Kaum hatte Ellen bemerkt, daß Semper die Augen offen hatte, als sie der Komtesse etwas zuraunte, worauf beide leise das Zimmer verließen.
Semper regte kein Glied, blickte nur starr geradeaus auf die Zimmerdecke und merkte, daß in seinem Hirn die Gedanken sofort wieder wie toll umherzuwirbeln begannen, als er sich vergegenwärtigte, in welch’ unangenehme Lage er durch den Sturz mit der Leiter geraten war.
Dann kam der Kreisarzt, fühlte ihm den Puls, meinte, die ganze Geschichte hätte bei einem jungen Körper nicht viel zu bedeuten, und befahl ihm, sich ganz still zu verhalten und vorläufig möglichst wenig zu sprechen. Den Doktor löste der Assessor ab, der offenbar Tobias Frick mit dem Vagabunden gemeint hatte, der für das Schnapsgeld noch heute so dankbar wäre.
Gleich darauf schlief Semper vor Erschöpfung ein. Als er erwachte, saß Baronesse Adda am Fenster des Zimmers. Er fühlte sich so frisch, daß er mit ihr ein Gespräch beginnen wollte. Aber sie schüttelte lächelnd den Kopf, legte warnend den Zeigefinger auf die Lippen und schlüpfte hinaus. Sehr bald erschien nun Graf Palwitzki selbst, fragte nach Sempers Wünschen und schickte ihm dann durch einen Diener eine kräftige Krankensuppe – Huhn mit Reisbrühe. Während Semper noch mit bestem Appetit, aufrecht im Bett sitzend, aß, fand sich der Geheimrat ein, um nach seinem Patienten zu sehen. Er war überaus zufrieden mit dessen Befinden und meinte, Semper könne, wenn er wolle, sich nachmittags auch in dem Krankenfahrstuhl, den der Graf noch von seinem verstorbenen älteren Bruder zur Verfügung habe, in den Park fahren lassen. Nur das geschiente Bein müsse natürlich hoch gelagert und möglichst nicht bewegt werden.
Als der Kreisarzt gegangen, hatte Semper endlich die Muße, sich über seine Lage klar zu werden. Jetzt gereute es ihn sehr, jemals auf den abenteuerlichen Gedanken gekommen zu sein, sich bei Hübners in die Gesellschaft all dieser soliden Staatsbürger eingedrängt zu haben. Es konnte ja nicht ausbleiben, daß er gezwungen war, über sein Woher und Wohin Auskunft geben zu müssen. Was sollte er denn sagen? Notwendig mußte er einen ganzen Roman erfinden, um die Rolle vorläufig weiterspielen zu können, in der er bei Hübners zu erst aufgetreten war.
Dann fiel ihm der Tote ein, dessen Kleider er nunmehr trug. Und er malte sich aus, was wohl geschehen würde, wenn die entkleidete Leiche zufällig entdeckt wurde. –
Seine Unruhe, das Gefühl der Unsicherheit, stieg. Er dachte an die beiden Gefährten da draußen in der Heide, besonders an Tobias Frick, diesen seltsamen Menschen, der unter einer rauen Schale so viel Gemüt, so viel fürsorgliche Herzlichkeit verbarg. –
Ja, wenn er Tobias hätte sprechen können …! Der würde ihm sicher einen guten Rat geben und all diese Schwierigkeiten beseitigen helfen.
Das Ergebnis dieses eifrigen Nachdenkens war bei Semper der Entschluß, zunächst alles Ausgefragtwerden dadurch zu vermeiden, daß er so tat, als leide er noch stark unter den Folgeerscheinungen der leichten Gehirnerschütterung. Er wollte eben Zeit gewinnen und abwarten, wie die Dinge sich gestalten würden.
Dann schlief er wieder ein. Und gegen fünf Uhr nachmittags wurde er sehr vorsichtig in dem Krankenstuhl unter der Obhut der Komtesse Adda in den Park unter eine mächtige, uralte Linde gefahren, die zu einer Laube künstlich gezogen war.
Es war sehr schwül unter dem grünen Blätterdach. Ein Gewitter schien in der Luft zu liegen.
Teil IV
Zirkusgeschichten.
1. Kapitel.
Hübners waren bis zum Abend in Palwitzkowo geblieben. Aber etwas Gezwungenes in dem Verkehr mit der gräflichen Familie hatte diesen Besuch nicht gerade zu einem Vergnügen gemacht. Nur mit Komtesse Adda hatte Ellen sich noch weiter angefreundet.
Die Heimfahrt nach Elgenstein legten Vater und Tochter schweigend zurück. Jedes hing seinen Gedanken nach. Erst nach dem Abendbrot, als August Hübner und Ellen noch durch den Park wanderten, begann das junge Mädchen zu sprechen.
„Ich weiß nicht, Papa, – ich habe so das Gefühl, daß seit dem Auftauchen Semper Nemos hier bei uns die ganze Luft sozusagen mit Geheimnissen angefüllt ist,“ sagte sie sinnend.
Hübner war stehen geblieben und blickte sein Kind forschend an.
„Meinst du, daß Erwin absichtlich sich gerade in unserer Nähe den Tod gegeben hat?“ fragte er unsicher.
„Nein, Vater. Ich bin sogar überzeugt, daß er gar nicht gewußt hat, daß wir von Bergedorf hier nach dem Osten übergesiedelt sind. – Ich denke an anderes. Da wäre zunächst Semper Nemo. Ohne Frage eine sehr rätselhafte Persönlichkeit. Daß er sich nicht verirrt hatte, sondern absichtlich nach Elgenstein gekommen ist, darüber waren wir uns wohl schon einig, ebenso, daß zwischen ihm und diesem Tobias Frick engere Beziehungen bestehen. Weiter seine auffällige Ähnlichkeit mit Erwin, die so täuschend ist, daß ich ihn nach dem Serpentintanz im Park für Vanbaren hielt. Und nun schließlich das Neueste, Merkwürdigste: Palwitzkis müssen Erwin gekannt haben!“
Ellen berichtete nun sehr genau ihre Beobachtungen während der Hinfahrt nach Palwitzkowo.
„Gerade die Tatsache,“ fügte sie zum Schluß hinzu, „daß die Gräfin betonte, der Name und die Person eines Malers Vanbaren seien ihr gänzlich fremd, lassen es als gewiß erscheinen, daß Palwitzkis irgend einen Grund haben, Erwin zu verleugnen. Bedenke auch, daß der Graf gleich morgen früh zu uns kommen will, um die Leiche Erwins sich anzusehen. Hätte er kein Interesse an dem Toten, – wozu dann wohl dieser Wunsch, den Selbstmörder in Augenschein zu nehmen …!!“
August Hübner warf die erst halb aufgerauchte Zigarre ärgerlich ins Gebüsch.
„Ich sage ja – mit dem Parkfest fing die ganze Geschichte an …!! Verflixt noch mal, – ich liebe keine Luft, die mit Geheimnissen angefüllt ist, wie du dich vorhin ausdrücktest …! Ich bin hier nicht Krautjunker geworden, um allerlei dunklen Rätseln nachzuspüren. Und wenn …“
Er sprach nicht weiter. Die Turmuhr schlug gerade neun.
Vor den beiden Hübners war Assessor Schaumburg aufgetaucht.
„Ich bitte vielmals um Entschuldigung,“ sagte er, „daß ich noch so spät störe. Aber dieser Selbstmord hat plötzlich ein so eigentümliches Aussehen bekommen, daß ich nicht verfehlen wollte, den Herrschaften sofort hiervon Mitteilung zu machen.“
„Schon wieder was Eigentümliches!“ stöhnte Hübner. „Assessor, eben hat mir Ellen mit ähnlichem aufgewartet …! Und nun kommen Sie auch noch! – Aber – los denn! Was gibt’s?“
„Das ist bald erzählt. In Schöneck hat sich die Geschichte von der Auffindung des Toten in der Torfgrube natürlich schnell herumgesprochen. Auch der Besitzer das Hotel ‚Stadt Hamburg’ erfuhr davon, ebenso von der weißen Haarsträhne. Der Mann kam also zu mir und teilte mir mit, daß seit drei Tagen einen Gast seines Hotels unter Zurücklassung eines kleinen Koffers verschwunden sei. Und dieser Gast habe auch eine weiße Haarsträhne im Scheitelhaar gehabt. – Da erst besann ich mich, selbst einmal Semper Nemo, dem Doppelgänger Vanbarens, eines Mittags auf der Veranda des Hotels gesehen zu haben. Auf meine Frage, wie der verschwundene Gast sich genannt habe, entgegnete mir der Wirt: „Fritz Müller, Reisender für eine Farbenfabrik aus Berlin.“ – Dieser Herr Nemo, der, wie inzwischen festgestellt ist, nie in dem Dorf Branken sich einlogiert gehabt hat, obwohl er uns dies hier am Parkfest erzählte, war also in der ‚Stadt Hamburg’ zur Abwechslung als Fritz Müller abgestiegen, Grund genug für mich, mir seinen Koffer mal etwas genauer anzusehen. Und – was meinen Sie, fand ich darin? – Einen zweiten, recht abgetragenen Anzug, einen Malkasten, ein Skizzenbuch, aus dem die Hälfte der Blätter ausgerissen war, und allerlei Wäsche ohne jedes Monogramm. – Nun, ich bin ja nicht umsonst in Schöneck Strafrichter. Also durchschnüffelte ich auch den Ofen des Zimmers, in dem Fritz Müller zwei Tage gewohnt hatte. Ich hoffte eben, vielleicht verbrannte Papiere dort zu entdecken. Und – Papiere waren auch auf dem Rost vernichtet worden, aber so gründlich, daß ich nur noch diese Hälfte eines Skizzenblattes aus der Asche retten konnte. Hier ist es.“
Er hatte das halbverkohlte, stark verräucherte Blatt aus seiner Brieftasche hervorgeholt und reichte es nun dem Schloßherrn von Elgenstein.
Der stieß einen Ruf der Überraschung aus.
Das junge Mädchen riß dem Vater die Skizze förmlich aus der Hand.
„Ich – ich selbst?!“ stotterte sie dann fassungslos. „Mein Gott, was bedeutet das?! So trug ich damals das Haar, als Vanbaren bei uns verkehrte.“
August Hübner legte jetzt dem Assessor wie beschwörend die Hand auf die Schulter.
„Schaumburg – begreifen Sie das alles?“ fragte er ganz heiser. „Ich denke, es ist Semper Nemo gewesen, der im Hotel ‚Stadt Hamburg’ in Schöneck gewohnt hat …! Und nun diese Skizze, der ganze Inhalt des Koffers …? Das deutet doch mehr auf den Maler Vanbaren hin!! Und auch die weiße Haarsträhne, die dem Wirt bei seinem Gast aufgefallen ist …! Auch die läßt nur den Schluß zu, daß Vanbaren dieser Fritz Müller gewesen ist! – Wahrhaftig – mir wirbelt förmlich der Kopf …!!“
Der Assessor schaute sehr ernst drein.
„Dieselben Fragen habe ich hier auch schon vorgelegt. Vielleicht ist es gar nicht Semper Nemo gewesen, den ich damals auf der Hotelveranda beim Mittag sah, sondern sein Doppelgänger, der Maler. Aber jedenfalls trug der Betreffende denselben tadellos sitzenden Anzug, den Nemo an hatte, als er zu Ihnen kam, Herr Hübner. – Kurz, die ganze Sache ist auch mir unerklärlich. Ich finde mich darin nicht zurecht. Und nur einer vermag uns des Rätsels Lösung geben: Semper Nemo. Es fragt sich nur, ob er’s gutwillig tun wird.“
Der Schloßherr blickte Schaumburg fast ärgerlich an.
„Sie denken an die Möglichkeit eines Verbrechens, nicht wahr?“ fragte er schnell.
Der Assessor zuckte die Achseln.
„Ich tappe völlig im Dunkeln hierbei. Aber – für ausgeschlossen halte ich es nicht, daß Semper Nemo …“
„Nein, nein,“ unterbrach ihn Ellen da mit Eifer. „Es ist ausgeschlossen …! Dieser Nemo mag ein Unglücklicher sein. Ein Verbrecher ist der nie und nimmer!“
„Der Mann hat auch für mich etwas sehr Sympathisches an sich. Das kann ich nicht leugnen. – Wie seltsam ist das alles nur, wie seltsam! Zwei Leute, die sich so ähnlich sehen, daß man sie unbedingt miteinander verwechseln muß, tauchen plötzlich hier auch, und der …“
Abermals unterbrach ihn Ellen.
„Ähnlich – ja! Aber doch nicht vollständig,“ sagte sie hastig. „Soeben ist mir etwas eingefallen. Ich habe bei Semper Nemo bestimmt eine weiße Haarsträhne nicht bemerkt – ganz bestimmt. Dieses Erkennungszeichen fehlt ihm.“
Und August Hübner erklärte dazu:
„Meine Tochter hat recht. Als sie mir damals am Parkfest ihr Zusammentreffen mit Erwin Vanbarens Doppelgänger mitteilte, sagte ich gleich: ‚Wir werden ja sehen, ob er die weiße Haarsträhne im Scheitel hat’. – Sie fehlt aber. Und das gab uns neben anderen Beweisen die Gewißheit, einen Fremden vor uns zu haben.“
Schaumburg strich sich mit der Hand über die Stirn.
„Jetzt ist der Knoten nur noch verworrener. – Wer war nun bloß dieser Fritz Müller, der da in der ‚Stadt Hamburg’ gewohnt hat, – wer?!“
Ellen hob den rechten Arm und deutete in der Richtung nach der Heide hin.
„Wenn wir Klarheit gewinnen wollen,“ sagte sie schnell, „so suchen wir am besten Tobias Frick auf. Der Alte muß mehr wissen, als wir! Das ist sicher.“
Schaumburg war sofort einverstanden.
„Ich habe ja selbst gesehen, wie rot und verlegen Semper Nemo wurde, als ich den alten Landstreicher erwähnte,“ meinte er. „Gut – gehen wir.“
August Hübner war es dann, der unterwegs dem Assessor noch berichtete, was Ellen heute auf der Wagenfahrt nach Palwitzkowo beobachtet hatte, – eben gerade genug, um mit Sicherheit darauf schließen zu können, daß das gräfliche Paar den Maler Erwin Vanbaren gekannt haben müsse.
Schaumburg schüttelte nur immer wieder den Kopf.
„Auch das noch!! Was wird bei der Geschichte nur herauskommen …! Ich bin wirklich gespannt!“ meinte er seufzend.
2. Kapitel.
Tobias und Friedel lagen vor ihrer Sommervilla behaglich im Heidekraut auf dem Bauch und betrachteten mit den Augen begeisterter Naturschwärmer das wunderbare Schauspiel des Sonnenuntergangs. Die ganze Heide schien ein glühendes Meer zu sein. Selten hatten sie einen so feuriges Rot als letzten Gruß des schwindenden Tagesgestirns gesehen.
„Unbegreiflich, wie Menschen sich in Städten zusammenpferchen können,“ meinte der ehemalige Kandidat. „Ein Bild wie dieses hier wiegt doch ein ganzes Jahr in Üppig– und Behaglichkeit auf.“
Der Wolfspitz, der ein paar Schritte weiter gerade den Boden aufkratzte, um ein Mauseloch zu untersuchen, hob plötzlich den Kopf und knurrte leise.
„Es kommt jemand,“ sagte Friedel und stand auf. „Ah – die Herrschaften aus dem Schloß wahrscheinlich. – Erhebe dich, Tobias. Du mußt hier die Honneurs machen.“
Gleich darauf hatten sich fünf Personen im Heidekraut vor der Schäferhütte gelagert.
Schaumburg war es, der Tobias Frick zum Reden zu bringen suchte. Aber der Alte behauptete hartnäckig, er kennen Semper Nemo nur durch die Geldspende zum Schnaps; sonst wisse er nichts von ihm. – Auch Ellen versuchte ihr Heil – mit demselben Mißerfolg.
Da zog der Assessor andere Seiten auf. Er gab dem alten Landstreicher eine genaue Übersicht über sämtliche Geschehnisse seit dem Augenblick, als Semper Nemo sich bei Hübners eingefunden hatte. Nichts vergaß er zu erwähnen – nichts. Schließlich berichtete er auch von dem Koffer des Gastes im Hotel ‚Stadt Hamburg’, von den Malutensilien und dem halbverkohlten Skizzenblatt und zeigte dieses dem Alten als eindringliches Beweisstück für seine Annahme, daß man es hier vielleicht mit keinem Selbstmord, sondern mit einem sehr raffiniert ausgeführten Verbrechen zu tun haben könnte. Ebenso erzählte er von Ellens Beobachtung bei der Wagenfahrt, – eben daß Palwitzkis Erwin Vanbaren kein Fremder gewesen sein könne.
„Ich werde mich also möglicherweise genötigt sehen,“ sagte er zum Schluß, „diesen Semper Nemo vorläufig zu verhaften, falls er mir eben nicht den Beweis erbringt, daß er ein ganz harmloser Sterblicher ist und mit gutem Recht diesen merkwürdigen Namen führt.“
Tobias Frick hatte mit finster gerunzelter Stirn zugehört und dicke Wolken aus seiner Zigarre gesogen, die der Schloßherr ihm vorhin geschenkt hatte.
Eine Weile war es jetzt ganz still in dem kleinen Kreis. Dann sagte der ehemalige Klown mit einem tiefen Seufzer:
„Ob ich Semper Nemo vor dieser ihm drohenden Verhaftung retten kann, weiß ich nicht. Aber ich will’s jedenfalls versuchen, indem ich den Herrschaften nun alles mitteile, was ich weiß und was mit zu dieser geheimnisvollen Angelegenheit zu gehören scheint. – Wir, mein Freund Friedl und ich, kennen Semper Nemo erst seit etwa zehn Tagen. Wir sind uns zufällig auf der Chaussee weiter nach Königsberg zu begegnet. Er schloß sich uns an. Und hier in der Heide fand er dann den eleganten Anzug und den Brief am Rand des Torfstiches. In dieser feinen Kluft ging er zu Ihnen, Herr Hübner. Er wollte nochmals versuchen, sich irgendwie wieder eine Stellung zu verschaffen, wobei er auf Ihre Unterstützung rechnete. – Das ist die volle Wahrheit. Ich kann jeden Eid darauf leisten, ebenso darauf, daß weder Friedel noch ich über die Vergangenheit des Jungen näheres wissen. – So, das wäre der Anfang. Nun kamen die Verwicklungen, die sich aus Sempers abenteuerlicher Idee ergaben. Und weiter kam die Auffindung der Leiche Erwin Vanbarens, bei der ich ja auch eine bestimmte Rolle spielte. Diesen Maler haben wir, Friedel und ich, früher ebensowenig gekannt wie Semper. Aber etwas an ihm hat in mir allerlei Erinnerungen wachgerufen, – ich meine, die weiße Haarsträhne. Außerdem waren diese Erinnerungen in mir auch schon lebendig geworden, als ich an der Brandstätte den Namen Palwitzki hörte.“
Tobias Frick tat ein paar Züge aus seiner Zigarre und fuhr dann leiser fort:
„Ich stamme aus einem Pfarrhause. Tobias Frick ist mein Zirkusname, den ich annahm, als ich als fünfundzwanzigjähriger Angestellter einer Bank aus Liebe zu einer Kunstreiterin zunächst als Stallknecht bei dem Zirkus Renz eintrat. Ich liebte diese Isolde Margoni – eigentlich hieß sie Rebekka Kohn – bis zum Wahnsinn. Ihretwegen gab ich meine Familie auf. Ich wollte nur in ihrer Nähe sein. Nun – ich machte bei Renz schnell Karriere. In einem Jahr war ich einer der besten Klowns des berühmten Zirkus und bezog ein großes Gehalt. Da bot ich Isolde Herz und Hand an. Sie lachte mich aus. Aber ich konnte warten, erhoffte alles von der Zukunft. – Niemand konnte der schönen Margoni etwas nachsagen. Ihr Ruf war tadellos. So vergingen vier Jahre. Isolde war zum Zirkus Schumann übergetreten. Ich natürlich auch. Und hier feierte die blonde Jüdin mit den dunklen Nixenaugen eben solche Triumphe wie bei Renz. Ja – blond war sie … Und in ihrem prachtvollen, reichen Haar gab es seltsamerweise eine einzige weiße Strähne. Hiervon wußten aber nur wir Zirkusleute, da sie sich die Strähne stets nachfärben ließ, damit es nicht auffiel. – Bei Schumann schlug dann auch für Isolde die Schicksalsstunde. Sie lernte einen sehr reichen Edelmann kennen. Zum erstenmal glühte ihr Herz in heißer Leidenschaft auf. Ich vermochte das heimliche Glück der beiden nicht mitanzusehen. Die Eifersucht machte mich fast krank. Ich nahm eine Anstellung bei einem Provinzzirkus an und suchte Isolde zu vergessen. Drei Jahre bereisten wir West- und Süddeutschland. Dann kam ich wieder nach Berlin. Ich hatte inzwischen nichts von ihr gehört, wollte auch nichts hören … Ein früherer Kollege von Renz her erzählte mir dann eines Tages alles, was inzwischen geschehen war. Der Edelmann hatte das Weib, das ich so abgöttisch geliebt hatte, ins Unglück gebracht, hatte sie, angeblich, weil sie ihm untreu geworden war, schmählich verlassen, und die einst so gefeierte Kunstreiterin war in Armut und Elend gestorben, nachdem sie einem Kind das Leben gegeben hatte. Vergeblich habe ich eifrig nachgeforscht, um näheres über ihr Ende zu erfahren. Es war alles umsonst. Da ergab ich mich dem Trunk, sank immer tiefer, wurde … Landstreicher. – Jener Edelmann aber, der Isolde auf dem Gewissen hat, war ein Graf Erwin, Edgar, Heinz von Palwitzki …!! – So, das ist meine Lebensgeschichte – und zugleich die Geschichte der weißen Haarsträhne, die ich bei dem Maler Erwin Vanbaren genau an derselben Stelle wiedersah, wo sie auch bei Isolde Margoni saß.“
Tobias Frick schaute versonnen in das mehr und mehr verblassende Abendrot.
Wieder war’s eine Weile ganz still in dem kleinen Kreis, bis dann der Assessor leise sagte:
„Ich glaube jetzt eine Erklärung für einen Teil der uns beschäftigenden Rätsel gefunden zu haben: Erwin Vanbaren, der Maler, der über seine Herkunft selbst nichts wußte, ist des Grafen Erwin und Isolde Margonis Sohn gewesen. Und Palwitzki ist dies sehr wohl bekannt.“
Der ehemalige Klown nickte.
„Genau dasselbe denke ich auch. – Aber – wer in aller Welt ist nun Semper Nemo, der Vanbaren bis auf die weiße Haarsträhne so ähnlich sieht …?!“
Gottlieb Blendel hatte bisher nur den aufmerksamen Zuhörer gespielt. Jetzt tat er zum erstenmal den Mund auf.
Und brummig sagte er:
„Tobias, du verdienst meine Freundschaft gar nicht! Wozu hast du mir all dies bisher verschwiegen?! Von der Haarsträhne des Toten hast du keine Silbe erwähnt. Hättest du es getan, so würde ich gleich gesagt haben, daß auch Semper Nemo, dein Sorgenkind, eine solche an derselben Stelle besitzt. Tatsächlich! Er hat sie nur ziemlich kurz abgeschnitten und Scheitelhaar darüber gestrichen. Als er sich einmal wusch, habe ich’s ganz deutlich gesehen. Aber ich hielt’s nicht für so wichtig, um’s dir mitzuteilen.“
Tobias Frick schaute jetzt den Assessor ganz ratlos an.
„Ich – ich finde mich aus diesem Labyrinth nicht heraus …!“ sagte er kläglich. „Also noch eine weiße Haarsträhne …! Mein Gott – wer – wer ist nun dieser Semper – der …?!“
„Das werden wir morgen nachmittag erfahren,“ meinte Schaumburg. „Morgen nehme ich Sie mit nach Palwitzkowo, Tobias. Und da werden wir beide Semper zum Reden bringen.“
3. Kapitel.
Fritz Schaumburg saß am nächsten Vormittag gegen elf Uhr in seinem Dienstzimmer im Amtsgerichtsgebäude.
Hans Henning, der Sekretär, lehnte mit sehr rotem Gesicht und sehr verlegen am Fenster. Soeben hatte er sich dem Freund anvertraut und erwartete nun dessen Entscheidung und Rat.
Der Assessor nickte ihm herzlich zu.
„Das war verständig von Ihnen, lieber Henning, mal ganz offen mit mir zu sprechen. Gemerkt habe ich es längst, daß Sie Fräulein Ännchen lieben. Und – Sie können überzeugt sein, Sie werden sich keinen Korb holen. Sollten Sie aber wirklich zu schüchtern sein, so will ich gern Ihren Freiwerber spielen.“
„Ach ja, – das – das wäre mir am liebsten,“ sagte Henning schnell.
„Gut. Wird gemacht!“ Und Schaumburg streckte dem Sekretär die Hand hin.
Da kam auch schon der Gerichtsbote und brachte dem Assessor eine Visitenkarte.
„Der Herr bittet um eine kurze Unterredung,“ meldete er. –
Auf der Karte stand:
Georg Wachholz
Justizrat, Rechtsanwalt und Notar, Berlin.
„Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Justizrat. – Womit kann ich Ihnen dienen.“
Wachholz war ein älteres, mageres Männchen mit einer etwas hohen Schulter und einem Gesicht, von dem man nicht recht sagen konnte, ob es Verschlagenheit oder harmlose Gutmütigkeit ausdrückte. Jedenfalls eignete er sich mit seinem Äußeren recht gut zu einer Lustspielnatur.
„Ich komme in einer dienstlichen Angelegenheit, Herr Assessor. – Gestatten Sie, daß ich Ihnen zunächst so einiges erkläre. Sie kennen wohl das Majorat Palwitzkowo und seinen jetzigen Herrn, nicht wahr? – Nun gut. Der Vorbesitzer war ein Graf Erwin Palwitzki, ein selten vielseitiger, sehr geschäftstüchtiger Herr. Er ist vor etwa fünf Jahren gestorben. Dessen Rechtsbeistand war ich, mehr noch, – sein Vertrauter! Graf Erwin hatte nun ein reges Interesse an einem Manne, der, wie mir der Majoratsherr Graf Ernst gestern Abend telegraphisch mitteilte, hier vorgestern oder gestern als Leiche aufgefunden worden ist. Auf die Nachricht von dem Tode dieses Erwin Vanbaren hin bin ich sofort hierher geeilt. Ich möchte mich vergewissern, ob auch kein Irrtum vorliegt, – kurz, mir die Leiche ansehen. Und dazu erbitte ich von Ihnen als dem zuständigen Beamten hiermit die Erlaubnis.“
Schaumburg hatte sehr gespannt zugehört. Er merkte sehr gut, daß der Berliner Justizrat äußerst vorsichtig seine Worte wählte. – ‚Reges Interesse’ für Vanbaren hätte Graf Erwin gehabt. Aber Graf Erwin war längst tot. Welches Interesse hatte also wohl der Justizrat noch an dem Selbstmörder, daß er so Hals über Kopf hier nach Schöneck kam …? Und weiter – aus welchem Grund mochte nur der jetzige Majoratsherr von Palwitzkowo sofort an den früheren Rechtsbeistand seines Bruders depeschiert haben?!
Der Assessor hatte jetzt geradezu das Empfinden, daß er hier vor wichtigen Enthüllungen stand. Dem Berliner wollte er schon beweisen, daß er ihm an Schlauheit gewachsen war. Und daher ging er nun keck zum Angriff vor, ohne viele Winkelzüge. Hiervon versprach er sich am meisten.
„Wäre es nicht richtiger, Herr Justizrat, wenn wir mehr mit offenen Karten spielten?“ sagte er ein wenig überlegen. „Wozu geben Sie nicht zu, daß Graf Erwin und die Schulreiterin Isolde Margoni die Eltern des Malers waren?“
Der trockene Herr Wachholz zog in heftigem Erschrecken die eine Schulter noch höher.
„Sie … Sie … wissen …?! Ja, aber woher nur?!“ stotterte er. „Diese alten Geschichten sind doch nur den Nächststehenden bekannt …?!“
„Und dem Gericht,“ lächelte Schaumburg freundlich.
„So haben Sie wohl auch Kenntnis von dem Testament?! – Dann kann nur Graf Ernst geplaudert haben.“
„Die Frage wollen wir offenlassen,“ meinte der Assessor. Und innerlich triumphierte er jetzt mit Recht. „Jedenfalls muß ich Sie bitten, mir über all diese Dinge ganz erschöpfend Auskunft zu geben, damit ich in dieser Angelegenheit im Interesse aller Beteiligten ganz klar sehe.“
Der Justizrat zuckte die Achseln.
„Wenn dieses alte Geheimnis doch kein Geheimnis mehr ist, dann kommt es nicht weiter darauf an, Einzelheiten zu verschweigen. – Hören sie also“ –
Er schilderte nun zunächst den Liebesroman zwischen dem reichen Aristokraten und der Kunstreiterin und fuhr dann fort: „Kurz nach dem traurigen Ende Isoldes erhielt Graf Erwin die überzeugenden Beweise, daß er seiner Geliebten bitter unrecht getan hatte. Sie war ihm nie untreu gewesen. Da kam die Reue. Durch meine Vermittlung wurden die Zwillinge – es waren zwei Knaben, die sich zum verwechseln ähnlich sahen – bei braven Leuten unter der Bedingung untergebracht, daß die Kinder nie ihre Herkunft erfahren durften und von den beiden Pflegeelternpaaren für eigen angenommen wurden. Die Leute erhielten recht erhebliche Summen, sollten die Kinder aber einfach erziehen.
Die Knaben wuchsen auf, ohne daß der eine etwas von der Existenz des anderen oder seiner wahren Abstammung wußte. Doch das Blut der Zirkusreiterin, das in ihren Adern floß, verleugnete sich nicht. Beide zeigten schon in jungen Jahren ausgesprochen künstlerische Neigungen, – sehr zum Entsetzen des Grafen Erwin, der von der Kunst nichts hielt und lediglich ein großzügiger, nüchterner gräflicher Kaufmann war. Die Adoptiveltern der Brüder, ebenfalls sehr strebsame, biedere, aber nicht minder nüchterne Naturen, versuchten alles, um die Zwillinge einem soliden bürgerlichen Beruf zuzuführen. Es kam dieserhalb auch zu mancherlei Unzuträglichkeiten. Aber Erwin und Heinz ließen sich nicht in eine ihnen zuwidere Schablone pressen. Der erstere folgte seinem Hang für die Malerei, der letztere wurde Musiker. Zu dieser Zeit, als ein stark entwickeltes Selbstständigkeitsgefühl die beiden jungen Männer ihren Pflegeeltern ziemlich entfremdet hatten, starb Graf Erwin. Vorher aber hatte er ein Testament erstellt, indem er, da er selbst unverheiratet war, als Erben seines nicht zu Majorat gehörigen Barvermögens von etwa eineinhalb Millionen Mark die Zwillinge einsetzte. Aber mit gewissen Klauseln. Diese sollten weiter über ihre Herkunft in Unkenntnis gelassen werden und erst fünf Jahre nach dem Tode des Grafen die Erbschaft dann antreten dürfen, wenn sie sich inzwischen als ‚fleißige, ordentliche und gesittete Männer’ erwiesen hätten. Sollten beide im Daseinskampf sich als schwache, haltlose Naturen herausstellen, so mußte das Vermögen an den Grafen Ernst fallen, mit dem mein Mandant nie besonders gut gestanden hatte. Würde sich aber einer der Brüder der Erbschaft würdig zeigen, so sollte diesen der ganze Nachlaß gehören. – Die Beurteiler, ob diese Würdigkeit vorläge, ist nach den Bestimmungen dieses merkwürdigen Testamentes zwei Berliner Kammergerichtsräten, guten Freunden des Grafen Erwin, und mir übertragen worden. Wir drei hatten also die Pflicht, die Brüder fortgesetzt im Auge zu behalten, was auch geschehen ist. Leider erlitt jeder der Brüder dann sehr bald moralischen Schiffbruch, indem sowohl Erwin Vanbaren als auch Heinz Karsten sich an fremdem Eigentum vergriffen und auch nachher trotz mancher Anläufe zur Besserung von Stufe zu Stufe sanken. Erwin, obwohl außerordentlich begabt, hat als Dekorationsmaler häufig erhebliche Summen verdient, aber stets bewiesen, daß er ein schlechter Wirtschafter war. Nun ist er auf so traurige Weise aus dieser Welt geschieden. Noch schlechter steht es mit Heinz, der nach den letzten mir zugegangene Nachrichten in Dorfschenken zum Tanze aufspielte. Jedenfalls kommt für die Erbschaft auch Heinz nicht in Betracht. In zwei Wochen aber sind die fünf Jahren der von dem verstorbenen Grafen festgesetzten Prüfungszeit verstrichen, und das Vermögen fällt somit an den jetzigen Majoratsherrn von Palwitzkowo. – Nun werden Sie auch verstanden haben, Herr Assessor, weshalb ich auf die Depesche des Grafen Ernst unverzüglich hierher geeilt bin. Es war meine Pflicht, mich mit eigenen Augen zu überzeugen, daß der Selbstmörder tatsächlich Erwin Vanbaren ist. Außerdem wollte ich auch gleich mit dem Majoratsherrn Vereinbarungen über die demnächstige Übernahme der Erbschaft durch denselben treffen.“
Fritz Schaumburg schaute gedankenverloren durch das Fenster in den lachenden Mittagssonnenschein hinaus. Das, was ihm der Justizrat eben erzählt hatte, hatte ihn mächtig ergriffen. Menschenschicksale waren vor ihm in wechselnden Bildern wie plastische Gemälde erstanden. Und er selbst hatte einen Teil dieser Lebensdramen hier jetzt mit durchgemacht … Er dachte an Semper Nemo – oder Heinz Karsten, wie er richtig hieß … Es erschien ihm kaum glaublich, daß dieser je einen Diebstahl begangen haben könnte … Er hatte diesen Mann mit dem Zug bitterer Weltverachtung um den Mund in dieser kurzen Zeit beinahe lieb gewonnenen …
Da wurde er aus seinen Gedanken durch den Justizrat aufgestört, der an das andere Fenster getreten war und auf die Straße hinabgeblickt hatte.
„Wenn ich mich nicht irre, so ist das die Komtesse Adda Palwitzki, die da eben aus dem Wagen steigt,“ sagte der Justizrat eifrig. „Die junge Dame scheint sehr erregt zu sein …“
Gleich darauf meldete der Gerichtsdiener die Komtesse, die den Herrn Assessor in einer sehr dringenden Angelegenheit um eine Unterredung bitten ließ.
Adda von Palwitzki hatte kaum den Justizrat erkannt, als sie auch schon erklärte:
„Es ist wie ein Wink des Schicksals, daß Sie gerade hier sind. Bitte – bleiben Sie! Das, was ich Herrn Assessor Schaumburg zu berichten habe, geht auch Sie etwas an.“
Die Komtesse war trotz der draußen herrschenden Hitze geisterhaft bleich. Ihre Hände zitterten und ihre Stimme klang vor mühsam erzwungener Fassung ganz verändert.
Schaumburg schob ihr einen Stuhl hin und reichte ihr ein Glas Wasser. Gierig trank sie es leer. Dann lehnte sie sich zurück und begann leise zu fragen, indem sie die Augen starr auf das Kruzifix richtete, das auf des Assessors grünverhangenem Amtstisch stand. Es war, als wolle sie den Gekreuzigten um Kraft anflehen zu dem Werk, zu dem ihr Gewissen sie hindrängte.
„Zwischen meiner Familie und mir ist in letzter Zeit eine starke Entfremdung eingetreten. Ich billige die Anschauungen nicht mehr, denen sie aufgrund ihrer Geburt huldigen zu können glauben. Ich bin ein moderner Mensch geworden. – Das muß ich vorausschicken. – Ein Zufall hat mir nun heute den Beweis erbracht, daß meine Eltern seit Jahren ein schimpfliches Intrigenspiel getrieben haben, um das Vermögen meines Onkels Erwin an sich zu reißen. Auf dem Schreibtisch meiner Mutter fand ich Briefe und Aufzeichnungen, die mir diese entsetzliche Wahrheit enthüllten. Meine Mutter hatte vergessen, sie wegzuschließen, und der Name Erwin Vanbaren in dem obersten Brief reizte meine Neugier. Es unterliegt keinem Zweifel, daß meine Eltern durch bestochene Kreaturen zwei meinem Onkel sehr nahe stehende Brüder sowohl in den Verdacht des Diebstahles gebracht, als auch lange Jahre durch raffinierte Schachzüge dafür gesorgt haben, daß alles, was Erwin Vanbaren und Heinz Karsten anfingen, mit einem Mißerfolg endete. Ich habe in einen solchen Abgrund gewissenloser Habgier und moralischer Verderbtheit geschaut, wie ich’s nie für möglich gehalten hätte …! Mein ganzes Innere ist förmlich erstarrt vor Entsetzen und Scham! – Und – hier sind die Beweise …! Tun Sie damit, meine Herren, was Ihre Pflicht ist! – Ich werde nicht wieder in mein Elternhaus zurückkehren …“
Damit legte sie ein recht umfangreiches, verschnürtes Päckchen vor Schaumburg auf den Tisch.
Und Justizrat Wachholz streckte jetzt die Hand nach dem Kruzifix aus und sagte tief bewegt:
„Gott ist gerecht …! – Diesen Tag werde ich nie vergessen!“
* * *
Schaumburg hatte Adda zu Hübners nach Elgenstein gebracht, wo sie aufs liebreichste aufgenommen worden war.
Nachmittags gegen fünf Uhr aber trafen in Palwitzkowo mit dem Hübnerschen Auto der Justizrat und der Assessor ein.
Die Unterredung der beiden Herren mit dem gräflichen Ehepaar nahm einen sehr dramatischen Verlauf. Aber gegenüber den erdrückenden Beweisen gab es kein Leugnen.
„Leider sind Sie beide wegen des schändlichen Spieles, das Sie mit den Brüdern getrieben haben, nicht mehr strafrechtlich zu belangen,“ erklärte Schaumburg mit eisiger Verachtung zum Schluß. „Aber das, was Sie getan haben, sollte trotzdem an die Öffentlichkeit gelangen. Und die wird Sie richten!“ –
Palwitzkis verschwanden schon am folgenden Tage für immer aus dem Osten der Monarchie. Das Majorat erhielt einen Verwalter, der aber so sehr in seine eigene Tasche wirtschaftete, daß es mit dem Nichtstuerdasein für die vier Palwitzkis für immer vorbei war. Nicht nur das Ehepaar, sondern auch der Sohn und die eine Tochter, die in Adda gleichfalls nur eine unkindliche, undankbare Verräterin sahen, lernten noch Not und harte Arbeit kennen. –
Gott ist gerecht …!
* * *
Ein Jahr ist seit dem Tage verflossen, als Tobias Frick und Friedel Blendel in der Lichtung auf der Heide gelagert und den Klängen der Musik gelauscht hatten, die vom Park Elgenstein herüberklang.
In der Heide steht jetzt an derselben Stelle ein kleines Häuschen, einfach, aber sauber und nett. –
Es ist wieder ein sonnenklarer Sommertag … In dem Vorgarten des Häuschens deckt Tobias gerade in der geräumigen Laube den Kaffeetisch. Und nun kommt der ehemalige Schulamtskandidat mit einem großen Teller Brotschnitten. Dabei sagt zu dem alten Gefährten:
„Tobias, ob das Brot reichen wird? Es sind immerhin eine ganze Anzahl Kaffeegäste, die wir heut wieder einmal erwarten: den Semper und Frau Ellen, den Assessor und Frau Adda, den bescheidenen Hans Hennig und sein glückliches Ännchen, August Hübner und … ja, vielleicht kommt auch der Kreisarzt.“
Tobias Frick rückt sich die seidene, wehende Künstlerkrawatte unter dem blendend weißen Kragen zurecht und erwiderte:
„Letztens hatten wir mehr Schnitten vorbereitet. Also mach nur noch einen zweiten Teller voll zurecht.“
Dann schaut er mit einem glücklichen Lächeln über die im Sonnenglanz daliegende Heide hin und fährt fort …
„Ist unser Lebensabend nicht schön, Friedel? Hat die Vorsehung es mit uns nicht fast zu gut gemeint …?!“
Aber Friedel hört kaum zu. Er hat in der Ferne die erwarteten Gäste erspäht, läßt einen lauten Juchzer erschallen und schwenkt die helle Leinenmütze.
„Sie kommen, Tobias, – sie kommen!“
Und geschwind eilt er ins Haus.
Der frühere Klown wischt sich mit der Hand über die Augen und spricht leise, gerührt vor sich hin:
„Sie kommen – alle, die uns lieb haben und an denen unsere alten Herzen hängen …“
Anmerkungen:
- ↑ Hausmeister einer Dorfschule.
- ↑ Hagelkörner.
- ↑ Gutstagelöhner.
- ↑ Alter wend. Volksstamm, der ehemals das Gebiet zwischen der Persante und der unteren Weichsel in Ostpreußen ausfüllte.
- ↑ Gutsbuchhalter.
