Hauptmenü
Sie sind hier
Der Fakir von Nagpur

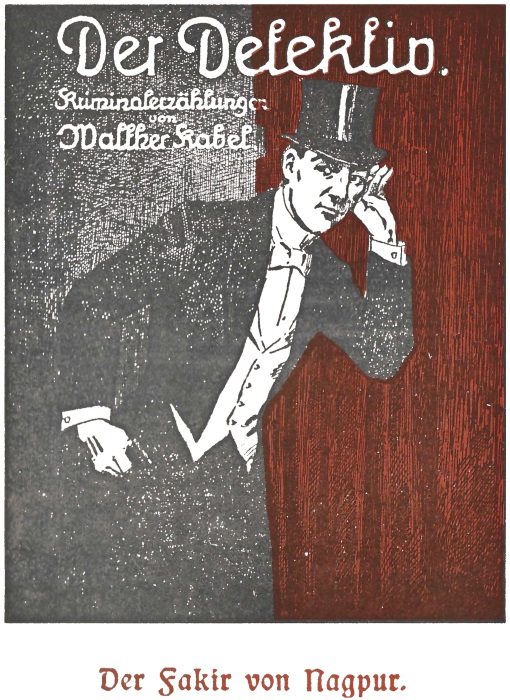
Der Detektiv
Kriminalerzählungen
von
Walther Kabel.
Band: 14
Der Fakir von Nagpur.
Nachdruck auch im Auszuge verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright 1920 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26.
Druck P. Lehmann G. m. b. H., Berlin 26.
1. Kapitel.
Erstklassiger Detektiv gesucht.
Wir saßen auf der Gartenterrasse des Fremdenheims der Frau von Tezra in Haidarabad an einem langen Tische. Die ganzen Gäste waren um uns versammelt. Man feierte Harsts Abschied. Ich spielte dabei ebenfalls eine bescheidene Rolle. Auch auf mich fiel etwas von dem Ruhmesglanz, der meinen Freund und Brotherrn umstrahlte.
Allgemein war man überzeugt, daß Harst den Feldzug gegen Cecil Warbatty weiterführen würde. Er leugnete dies auch keineswegs. Nur erklärte er jedem, der es hören wollte, daß er zunächst nach Madras reisen und dort untersuchen würde, wie Warbatty aus der Zelle des Polizeigefängnisses hätte entweichen können. – Es war dies eine für jeden schärfer denkenden Menschen ziemlich durchsichtige Verschleierung unserer wahren Absichten. Denn – was sollte es wohl für uns für einen Nutzen haben, wenn Harst sich die erbrochenen Schlösser der Türen dort wirklich ansah?!
Aber man vermutete eben hinter diesen Angaben Harsts etwas ganz Besonderes. Eine deutsche Dame fragte zum Beispiel, ob Harst imstande sei, vielleicht aus der Art der gewaltsamen Eingriffe in die Türschlösser zu entnehmen, welchen Beruf Warbatty vor Beginn seiner Verbrecherlaufbahn ausgeübt hätte.
Die Frage war unsinnig, rief jedoch einen lebhaften Meinungsaustausch darüber hervor, ob Warbatty den gebildeten Kreisen oder den einfacheren Volksschichten entstamme. Jeder hatte ja bereits über dieses Verbrechergenie in den Zeitungen gelesen. Warbatty war eben jetzt zur Tagesberühmtheit geworden, etwa ähnlich wie seiner Zeit Jack der Bauchaufschlitzer, der monatelang die Riesenstadt London in Angst und Schrecken versetzt hatte. –
Wer Warbatty war, wie er in Wahrheit hieß, wußte bisher niemand, selbst Harst nicht. Gewiß – des Verbrecherkönigs Bruder hatte in Kolombo auf Ceylon unter dem Namen Sagton für kurze Monate gelebt und auch Papiere auf diesen Namen besessen. Es hatte sich dann aber herausgestellt, daß er diese Papiere nur gestohlen und daß er kein Recht gehabt hatte, sich Sagton zu nennen. Warbattys Persönlichkeit umhüllte also noch genau dasselbe Dunkel wie damals, als unser Kampf gegen ihn in Berlin begann.
Mir war es ganz interessant, daß Harst jetzt aus Anlaß dieses Meinungsstreites seiner Ansicht über Warbattys Vorbildung, Herkunft und so weiter dahin Ausdruck gab, daß er erklärte, er halte diesen Menschen für einen Zugehörigen der besten Gesellschaftskreise, der lediglich aus krankhafter Lust am Verbrechen der Menschheit den Krieg angesagt habe und diesen Krieg nun mit allen Mitteln hochentwickelter Intelligenz und einer alles umfassenden Allgemeinbildung völlig erhaben über jede Rücksicht auf Menschenleben führe.
„Gerade diese brutale Mordgier Warbattys hat etwas so dämonisches an sich, daß ich fast geneigt bin, anzunehmen, er müsse Arzt sein, – eben einer jener Ärzte, die durch ihren Beruf das Leben für nichts zu achten gelernt haben,“ fügte er hinzu und belegte dann diese seine Ansicht mit fein durchdachten Beweisen, deren Geistesblitze den meisten Anwesenden jedoch unverständlich geblieben sein dürften.
Ich erwähne diese unsere Abschiedsfeier in Haidarabad und diesen Gesprächsstoff aus Gründen, die der Leser nachher schon durchschauen wird.
Um Mitternacht hatte das kleine Fest ein Ende. Wir verabschiedeten uns, tauschten mit diesen Zufallsbekanntschaften zahllose Händedrücke und zogen uns auf unser Zimmer zurück. Es war dies ein Raum der Privatwohnung der Frau von Tezra im Erdgeschoß, wie erinnerlich sein dürfte.
Harst drehte das Licht an, schloß das Fenster, zog die Vorhänge zu und meinte nun, indem er sich aufseufzend in einen Sessel fallen ließ:
„War das ein Stumpfsinn! Nein – all diese Menschen waren mir nie so entsetzlich langweilig mit ihrem Sensationshunger – denn ihre Teilnahme für mich ist doch schließlich nichts anderes, als gerade an diesem Abend, wo ich wirklich an genug anderes zu denken hatte –“
Er griff in die Tasche, reichte mir die heutige Morgenausgabe der in Haidarabad erscheinenden englischen Zeitung.
„Du wirst darin etwas finden, das uns angeht,“ sagte er, und plötzlich gewahrte ich an ihm alle Zeichen einer gesteigerten geistigen Anspannung. „Suche jedoch im Annoncenteil, nicht etwa unter Allerneuestes.“
Er rauchte sich eine Zigarette an. Ich lehnte neben ihm am Tisch und überflog die Reihen der Anzeigen.
Ich fand nichts. Nur ein einziges Inserat schien mir beachtenswert. Besondere Wichtigkeit konnte ich jedoch auch ihm nicht beimessen.
Ich ließ die Zeitung sinken, zuckte die Achseln, sagte:
„Du wirst schon so liebenswürdig sein müssen, mir die Anzeige näher zu –“
„Aber – Du hast ja soeben so eindringlich diese Annonce angestarrt!“ fiel er mir ins Wort. „Es ist die dort rechts oben letzte Seite –“
Ah – also hatte ich doch richtig vermutet!
Dieses Gesuch lautete:
Erstklassiger Privatdetektiv, Ehrenmann mit nur besten Empfehlungen erhält außerordentlich lohnenden Auftrag. – Eingehende Zuschriften unter Masty Mastra postlagernd Nagpur. –
Nagpur! – Der Name hatte mich gleich stutzig gemacht. Und dann der – „erstklassige Privatdetektiv“!
Denn Nagpur war ja unser wahres Reiseziel. Dort mußten wir Warbatty wiederfinden, weil wir die Beweise besaßen, daß er dort einen seiner berüchtigten großzügigen Pläne vorbereitet hatte.
„Nun, lieber Alter, – was hältst Du von dieser Anzeige?“ fragte Harst jetzt gespannt.
„Hm – sie wird von Warbatty oder einem seiner Helfershelfer eingerückt worden sein. – Es wird sich um so etwas wie eine Falle handeln –“
Harst schüttelte den Kopf.
„Glaube ich nicht. – Dieselbe Anzeige steht seit drei Wochen in dieser Zeitung und zwar jeden dritten Tag. Und vor drei Wochen waren wir unterwegs nach Bombay. – Nein – hier hat Warbatty seine Hand nicht mit im Spiel –“
In demselben Augenblick klopfte es.
Es war der Portier des Fremdenheims, ein älterer Hindu, der recht gut deutsch sprach.
„Herr Harst, soeben ist für Sie eine Kiste abgegeben worden, eine sehr große Kiste,“ meldete er. „Sie ist sehr schwer. Zwei Lastträger brachten sie auf einem Wagen. Sie steht in der Vorhalle. Die Leute sagten, es seien alte Tonfiguren darin, die Sie gekauft hätten –“
Harst eilte schon hinaus.
In dem umfangreichen Gebäude schlief alles längst. Der Portier hatte nur noch den Nachtzug von Madras abgewartet, mit dem zuweilen Fremde eintrafen.
Ich folgte Harst. Wir besichtigten die Kiste sehr sorgfältig, beide wohl erfüllt von demselben Mißtrauen, der Holzkasten könnte eine Höllenmaschine oder dergleichen enthalten.
Der Kistendeckel und der eine Seitenteil waren nur durch Haken befestigt. Schon dies genügte uns mit äußerster Vorsicht beim Öffnen zu Werke zu gehen.
Harst schickte den Portier und mich mehr in den Hintergrund der Halle, als wir die sämtlichen Haken geöffnet hatten.
„Ich möchte nicht, daß Euch etwas zustößt, falls es sich hier um irgend eine Heimtücke handelt,“ sagte er.
Wir mußten gehorchen. Widerspruch duldete er nie.
Wir sahen, daß er den Deckel und den Seitenteil abhob und beiseite stellte. Die große Ampel der Vorhalle beleuchtete das Innere des Kastens ganz deutlich.
Darin befand sich irgendein Gegenstand, der mit einem Stück Leinwand zugedeckt war.
Ich kam näher. Harst nahm die Umhüllung weg.
Ein Blick – und wir beide prallten zurück. Hinter uns stieß der braune Portier einen Schreckensruf aus.
Was wir sahen? – Wenn ich dies hier beschreibe, so kann es auch nicht im entferntesten die Wirkung haben wie das Bild, das sich uns darbot.
Der Kasten hatte gerade Raum für einen sitzenden Menschen. Und – auf einem Zwischenbrett saß auch ein Mensch – oder besser – Teile eines Menschen!
Jetzt, wo ich dies niederschreibe, denke ich unwillkürlich an die grausigen, phantastischen Erzählungen Edgar Allan Poes.
Also ein Mensch saß in dem Kasten; saß darin mit herabhängenden gefesselten Armen. Ebenso waren Beine, Kopf und Oberarme an die Rückwand des Kastens festgebunden.
Der Ärmste trug nur Leinenhosen. Sonst war er nackt.
Und nun das Furchtbare, geradezu Schauer des Entsetzens Hervorrufende:
Der Mann war ein Weißer; war jener Ernst Müller, den wir in den Indra-Ruinen festgenommen, dann aber wieder freigelassen hatten; und diesem Menschen, der uns feierlichst Besserung gelobt hatte, waren die Rippen an beiden Seiten der Brust so herausgeschnitten worden, daß man die oberen inneren Organe völlig frei liegen sah wie ein anatomisches Präparat.
Aber das Grausigste: diese Organe arbeiteten; das Herz schlug, die Lungen dehnten sich, zogen sich zusammen.
Der Mann lebte noch. Und Leben lag in seinen weit aufgerissenen Augen; ein Ausdruck war in diesem Blick, der uns musterte, daß es hätte einen Stein erbarmen können, – ein Ausdruck wahnsinnigster Todesangst und gleichzeitig stummen Flehens um Hilfe.
Harst faßte sich schneller als ich, trat hinzu, zog Müller den Knebel aus dem Munde.
Doch – in demselben Moment ging mit dem dem Tode Verfallenen urplötzlich eine jähe Veränderung vor sich. Ein Lächeln glitt über das leichenblasse Gesicht; die Augen lächelten mit. Und geradezu bleiern-schwerfällig formte die bereits halb gelähmte Zunge die Worte:
„Warbatty läßt Sie grüßen, Harald Harst. Und er verspricht Ihnen, daß er Sie zu einem ähnlichen chirurgischen Experiment einst benutzen wird –“
Der Mund klappte fast hörbar zu. Die Augenlider schlossen sich. Das Gesicht bekam etwas Leichenähnliches. Und zugleich wurde die Herztätigkeit schwächer und schwächer, bis das schauerliche Bild der arbeitenden Brustorgane in die Todesstarre überging.
„Vorüber, – ausgelitten!“ sagte Harst leise. „Ausgelitten – als ob eine Maschine zu arbeiten aufhört. Denn dieser Unglückliche war nichts anderes mehr wie eine willenlose Maschine. Warbatty hat ihm den Befehl in der Hypnose erteilt, diese Worte zu mir zu sprechen; und nur die ungeheure Macht einer durch Hypnose vermittelten Willenskonzentration hat das Leben in dieser entblößten Brust noch für einige Zeit festgehalten. – Warbatty ist Arzt! Einen besseren Beweis hierfür konnten wir kaum erhalten. Und welch geschickter Operateur muß er sein. Was für Experimente muß er bereits mit Menschen angestellt haben, um etwas derartiges zustande bringen zu können!“
Harst deckte das Tuch über die Leiche, legte den Deckel und den Seitenteil auf den Kasten und klammerte beide fest. Dann winkte er dem Portier und mir. Wir faßten mit an, trugen die Kiste hinaus in den Garten und in einen leeren Verschlag des Stalles.
2. Kapitel.
Das Auto des Nizam.
Wir saßen wieder in unserem Zimmer. Harst stierte mit gerunzelter Stirn geistesabwesend vor sich hin. Ich wagte ihn in seinen Gedanken nicht zu stören. Plötzlich sagte er dann leise:
„Warbatty hat in seinem sogenannten Testament selbst erklärt, daß er sich für geistig nicht normal hält. Auch mir ist dieser Gedanke bereits früher gekommen. Und – es wird sicherlich zutreffen! Dieser Verbrecher gehört zu jenen krankhaft veranlagten Personen, bei denen die Intelligenz lediglich für verbrecherische Zwecke ausgenutzt wird, bei denen der Trieb zum Verbrechen so stark entwickelt ist, wie etwa bei einer anderen Art von Geistesgestörten die Sucht, ganz zwecklos Gebäude anzuzünden oder Tiere qualvoll zu töten. – Ich wünschte, ich wäre Warbatty nie begegnet – nie! Die Vorstellung, gegen einen Wahnsinnigen zu kämpfen, hat für mich etwas Lähmendes –“
Ich begriff das vollständig.
Harst holte aus seinem Koffer eine Kognakflasche hervor, schenkte uns die kleinen Aluminiumbecher voll und trank mir mit den Worten zu:
„Ich bin neugierig, was sich hinter dem Gesuch in der Zeitung verbirgt. Ich habe heute bereits einen Brief nach Nagpur vorausgeschickt –“
Mir hatte er dies bisher verschwiegen.
„Du glaubst also, daß es mit dieser Anzeige eine besondere Bewandtnis haben müsse?“ fragte ich nun.
„Ohne Zweifel. Die Annonce ist jetzt siebenmal erschienen. Sie ist von großem Umfang. Die wichtigsten Worte sind gesperrt gedruckt. Der dreifache Rand macht sie noch auffälliger. Billig kann sie nicht sein. Und – zwecklos wirft niemand sein Geld zum Fenster hinaus. Nein – mir klingt dieses Gesuch wie ein Hilferuf. Jemand, der sich von einer Gefahr umgeben weiß und doch davon nur kaum merkliche Anzeichen spürt, hat dieses Inserat in der Angst, eines Tages sich dieser Gefahr in einer bis dahin unmöglich zu ahnenden Art und Größe gegenüber zu sehen, eingerückt. Es muß etwas Geheimnisvolles dabei mitspielen. Sonst hätte dieser Jemand wohl die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen, etwas Geheimnisvolles und gleichzeitig das Privatleben des Betreffenden Berührendes. – Die Öffentlichkeit weiß bisher jedenfalls nichts von diesen Dingen. Ich habe die Zeitungen der letzten Wochen durchgeblättert. Nirgends war auch nur ein Vorfall vermerkt, der irgendwie mit diesem Masty-Mastra-Inserat[1] hätte in Verbindung gebracht werden können.“
Mein Interesse an der immerhin ungewöhnlichen Anzeige war bereits im Schwinden begriffen. Ich hatte ja schon vorher Harst noch über dieses letzte entsetzliche Verbrechen Warbattys, diese Übermittlung einer Todesdrohung an Harst durch einen Sterbenden, etwas fragen wollen. Ich tat es jetzt.
„Würdest Du mir Deine Ansicht darüber entwickeln, weshalb Warbatty seinen Komplicen Ernst Müller in dieser Weise hingeschlachtet hat? – Lediglich, um seinen Helfershelfer für immer stumm zu machen?“
„Nur deshalb? – Nein! Ich bin überzeugt, Warbatty lag weit mehr daran, mir zu beweisen, wie groß seine Macht ist, was er alles zu bewerkstelligen vermag. Er ist überaus eitel. Er sucht mir zu imponieren, nebenbei mich auch einzuschüchtern. Ich gebe zu, daß so manchen dieses grausige Bild des die Worte lallenden Menschen in der Kiste in Gedanken an ein ähnliches Schicksal abgeschreckt hätte, mit Warbatty weiterhin anzubinden. Selbst mir ist dieser entsetzliche Anblick stark an die Nerven gegangen.“
Er füllte die kleinen Becher abermals mit Kognak.
Dann schickte er mich zu Bett. „Ruhe Dich aus, lieber Schraut. Du hast ohnedies nur noch drei und eine halbe Stunde zu schlafen. Und Du bist der ältere von uns. Ich werde packen. Um sechs Uhr steht das Auto des Nizam (Fürsten) von Haidarabad für uns vor der Tür –“
Ich erwachte um halb sechs ganz von selbst. Im Zimmer war’s bereits tageshell. Und – ich sah Harst in einem der Sessel sitzen und – eine Zigarette rauchen, sah sein Bett unberührt, sah auf der Aschenschale mindestens fünfzehn Mundstücke von Zigaretten liegen.
Er nickte mir zu, lächelte, meinte: „Ja, lieber Kerl, – wenn man im Erdgeschoß wohnt und wenn man einen Warbatty zum Feinde hat, wenn die Fenster keine Laden haben und die Oberfenster sogar nur mit Drahtgaze bespannt sind, dann tut man besser, die Nacht über Licht zu brennen und zu wachen.“ –
Eine halbe Stunde drauf verließen wir den Speisesaal, wo wir noch schnell gefrühstückt hatten, und bestiegen das Auto Seiner Hoheit des Nizam von Haidarabad, das dieser uns liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hatte.
Der Chauffeur trug die Abzeichen der fürstlichen Beamten. Er war ein Inder. Ebenso auch der Diener, der neben dem geöffneten Schlage stand und der sich mit über der Brust gekreuzten Armen tief verneigte. Dann sagte er wie auswendig gelernt:
„Seine Hoheit grüßt den deutschen Sahib Harst und wünscht glückliche Reise.“ –
Das große, bequeme, offene Auto glitt davon. Wir hätten auch mit der Bahn sehr bequem Nagpur erreichen können. Harst jedoch wollte einmal vom Auto aus Indien kennen lernen, zumal die Hauptverkehrsstraße nach Norden zu sich in tadellosem Zustande befinden sollte.
Unsere Koffer waren hinten auf dem Gepäckhalter aufgeschnallt. Nur unsere Büchsen hatten wir auf Anraten des englischen Residenten, der Harst einen Höflichkeitsbesuch gestern gemacht und ihm für Nagpur ein Empfehlungsschreiben an den dortigen höchsten Verwaltungsbeamten mitgegeben hatte, neben uns gestellt, da man in den gebirgigen Gegenden zuweilen auf Bergziegen zum Schuß kommen sollte.
Mittags erreichten wir die unbedeutende Stadt Medik. Sie liegt am Nordabhang eines Höhenzuges, den der Kraftwagen nur dank seinem starken Motor auf dem Serpentinenwege überwand.
Es war glühend heiß. Trotz unserer Gesichts- und Nackenschleier hatten wir auf den Wangen Sonnenbrand. Wir machten am Rasthause in Medik halt. Dieser Ersatz für Hotels ist in kleineren Orten Indiens die einzige Möglichkeit, Unterkunft zu erhalten, falls man nicht gerade unbekannte Europäer um ein Quartier bitten will.
Wir ruhten hier zwei Stunden aus. Entweder war Harst wirklich ebenso erschöpft von der Fahrt wie ich, oder aber er hatte wieder seinen schweigsamen Tag. Unser leidlich sauberes Zimmer mit den leichten Bettgestellen wurde durch eine Riesenpunka (beweglicher Fächer) einigermaßen abgekühlt. Harst lag mit offenen Augen da und regte sich nicht. An Schlafen war nicht zu denken[2]. Meine Versuche, wenigstens eine gleichgültige Unterhaltung zu beginnen, schlugen fehl.
Das Rasthaus war außer uns nur von wenigen Eingeborenen besetzt. Die wie bei den Bungalows der Europäer um das Haus herumlaufende Veranda diente in recht störender Weise dem allgemeinen Verkehr. Vor den nur mit Gaze überzogenen Fenstern eilten immer wieder Gestalten vorbei und brachten die Dielen der Veranda zu mißtönendem Knarren.
„Weshalb bist Du eigentlich so nachdenklich?“ fragte ich Harst abermals, nachdem ich vorhin auf dieselbe Frage keine Antwort erhalten hatte.
„Ich überlege, ob wir nicht doch lieber mit der Bahn die Reise fortsetzen sollen. Dieses Städtchen hier ist Station der Strecke nach Nagpur. Wir hätten es also sehr bequem, könnten das Auto zurückschicken und den Abendzug benutzen.“
Ich war überrascht.
„Weshalb denn so mit einem Male diese interessante Fahrt aufgeben?!“ meinte ich und setzte mich aufrecht auf den Bettrand.
„Weshalb? – Hm – die Fahrt ist mir zu interessant, zu aufregend. – Aber – das dürfte schon unser Diener sein, der da anklopft. – Herein!“
Der hagere Inder trat ein, verbeugte sich und fragte:
„Sahib, werden wir jetzt aufbrechen? Die zwei Stunden sind um.“
„Ja. Nimm nur gleich unsere Büchsen mit –“
Diese standen in einer Ecke. Der Inder verließ mit ihnen das Zimmer, nachdem er noch erklärt hatte, der Kraftwagen würde nach fünf Minuten vor dem Haupteingang[3] bereitstehen.
Harst war mit einem Satz aus dem Bett, kam dicht zu mir heran und nahm neben mir Platz.
„Schraut,“ flüsterte er leise, „jetzt werde ich die Entscheidung herbeiführen. Warte hier. Ich bin sofort zurück.“
Ich blieb mit einem recht verständnislosen Gesicht auf dem Bettrande sitzen. Ich hörte, wie Harst von der Veranda aus dem Diener zurief, er wolle sich nur noch Zigaretten einkaufen. Das Auto solle erst nach zehn Minuten vorfahren.
Die zehn Minuten waren noch nicht um, als er plötzlich vergnügt pfeifend eintrat.
„So – alles erledigt. Ich habe bei der hiesigen Polizeistation sofort Unterstützung erhalten,“ meinte er. „Aha – der Kraftwagen kommt schon um das Haus herum. Nimm Deinen Revolver und stecke ihn entsichert in die Außentasche.“
„Was in aller Welt bedeutet das?“ fragte ich kopfschüttelnd. „Polizei – Revolver – ja, was –“
„Vorwärts – die Geschichte kann beginnen,“ unterbrach er mich. „Sollte einer der Halunken fliehen wollen, so knalle ihm in die Beine –“
Er ging voran. Das Auto stand auf der Straße; der Diener des Nizam am offenen Schlag; ganz wie bei der Abfahrt aus Haidarabad.
Unsere Gewehre lehnten neben den Sitzen im Innern des Wagens. Und – ich begriff nichts – nichts!
Vor dem Rasthause hatte sich eine Schar splitternackter Kinder und einige erwachsene Neugierige eingefunden. Für das Städtchen war ein Auto mit dem Schlangenwappen des Nizam und den uniformierten beiden Leuten eine kleine Sensation.
Harst tat, als wollte er einsteigen, ergriff dann aber die beiden Gewehre, öffnete blitzschnell bei dem einen die Kammer und rief sofort dem schwarzbärtigen Inder, dem Diener des Nizam, zu:
„Wer hat die Patronen aus den Läufen entfernt?“
„Ich tat es, Sahib,“ dienerte der Inder unterwürfig. „Die Büchsen hätten vielleicht beim Stoßen des Wagens von selbst sich entladen können –“
Das weitere spielte sich so schnell ab, daß ich kaum recht die Vorgänge verfolgen konnte.
Plötzlich sprangen zwei der Neugierigen, zwei baumlange braune Kerle, dem Chauffeur an den Hals, rissen ihn aus dem Wagen heraus. Harst selbst hatte auf den Diener mit dem Revolver angeschlagen, drohte ihm:
„Keine Bewegung, mein Bursche, sonst knallt’s!“
Und noch zwei einheimische Polizisten, die sich schnell in harmlose Zuschauer verwandelt hatten, nachdem Harst auf der Polizeistation gewesen, mischten sich ein, packten den Diener, rangen ihn zu Boden und nahmen ihm zwei geladene Revolver und einen Dolch ab.
Auch der braune Chauffeur war genau so bewaffnet gewesen.
Die beiden Kerle wurden gebunden. Dann stellte Harst auf offener Straße mit ihnen in Gegenwart des Polizeimeisters von Medik ein kurzes Verhör an.
„Wem gehört das Auto?“ fragte er den Chauffeur, der offenbar der intelligentere der beiden war.
Der Inder schwieg. Doch der Polizeimeister wußte mit diesen Leuten umzugehen.
„Ich lasse Dich sofort aufhängen, wenn Du nicht die Wahrheit sagst,“ donnerte er den verstockt Dastehenden an. „Ich habe Dich längst an der Tätowierung auf den Backen erkannt. Du bist der steckbrieflich gesuchte frühere Chauffeur des Oberrichters aus Haidarabad; Du hast Deinem Herrn außer Geld auch allerhand Papiere gestohlen –“
Das genügte. Der Inder wurde gefügig.
„Das Auto wurde vor zwei Wochen durch einen Beauftragten des Nizam an den Kaufmann Sadik Gassar in Haidarabad verkauft, da es dem Nizam nicht gefiel. Sadik hat es gestern vormittag einem Manne geliehen, der sehr viel dafür bezahlte, den ich aber nur einmal gesehen habe, nämlich als er mich und Achmed in einer Teestube anwarb.“
„Nur einmal?“ meinte Harst zweifelnd.
„Ja, Sahib, – nur einmal. Der Mann war ein Goanese der Tracht nach (Bewohner der portugiesischen Kolonie Goa). Er war sehr klein und mager. Und er hatte an der linken Hand nur vier Finger –“
„Aha!“ machte Harst. „Dacht’ ich mir! – Und dieser Goanese hat Euch beide für diese Fahrt angeworben und für Euch auch die Uniformabzeichen des Nizam besorgt. Ihr solltet uns unterwegs dann überfallen und fesseln. Damit Ihr unsere Büchsen nicht zu fürchten hättet, wurden die Patronen entfernt. – Wo sollen wir denn überfallen werden?“
„Auf der Brücke über den Ispari-Fluß.“
„Ah – also dicht hinter Medik. – Der Goanese wollte Euch an der Brücke helfen?“
„Ja, Sahib. Er und noch ein zweiter Goanese, ein Bruder von ihm.“
Harst wandte sich an den Polizeimeister. „Wir werden versuchen, die beiden bei der Brücke abzufassen. Wir wollen dies –“
„Verzeih, Sahib,“ mischte der Chauffeur sich ein, „Du wirst den Goanesen dort nicht finden. Der, der uns angeworben hat, stand vorhin dort hinter jener Hütte und sah, wie wir gebunden wurden –“
Harst biß sich auf die Lippen. Ich sah ihm an, wie ergrimmt er war, weil Warbatty sich auch hier wieder so gut gegen jede nachteilige Möglichkeit geschützt hatte.
„Wann geht der nächste Zug nach Nagpur?“ fragte er den Polizeimeister kurz.
„Erst gegen 7 Uhr abends. Wir haben jedoch eine Motordraisine zur Verfügung, die in wenigen Minuten abfahrtbereit sein kann.“
3. Kapitel.
Der Yogi und das Mädchen.
Gegen vier Uhr nachmittags verließen wir das Städtchen auf der Draisine, die sehr bald eine überraschende Geschwindigkeit entwickelte. Ihr Wagenkasten war so hoch, daß wir, auf der Polsterbank sitzend, nichts von der über uns pfeifend hinwegstreichenden Zugluft merkten.
Als Bedienung des Eisenbahnwägelchens begleiteten uns zwei Ingenieure. Sie hatten sich freiwillig dazu erboten. Ihnen war es sehr lieb, daß sie der Langenweile in Medik für einen Tag entgehen konnten. Sie ließen den Benzinmotor an Kraft hergeben, was nur aus ihm herauszuholen war. Sie waren Engländer, und sie hatten mit dem Polizeimeister in Medik gewettet, die Strecke bis Nagpur in kürzerer Zeit zurückzulegen als der Eilzug. Zuweilen war die Geschwindigkeit denn auch geradezu beängstigend, besonders wenn’s bergab ging.
Als wir gegen acht Uhr abends die Draisine von den Schienen heben mußten, da uns ein Zug entgegenkam, benutzte ich die Gelegenheit, Harst zu bitten, mir nun endlich darüber Aufklärung zu geben, wann und weshalb er gemerkt hätte, daß wir nicht in einem Auto des Nizam, sondern in einem von unserem alten Gegner gemieteten Kraftwagen gesessen hätten.
Auch die beiden Ingenieure, die in Harst den Detektiv von Weltruf fast über Gebühr bewunderten, schlossen sich meiner Bitte an.
Harst lächelte. „Die Sache ist eigentlich so verblüffend einfach,“ wandte er sich mehr an unsere Begleiter, „daß ich mich beinahe schäme, nicht sofort Verdacht geschöpft zu haben. Wir waren bereits eine Stunde unterwegs, als mir die schlechte Beschaffenheit der Sitzpolster auffiel. Es gab in dem Leder sogar zwei geflickte Risse. – Niemals, sagte ich mir, hätte der Nizam mir ein solches Auto geschickt, – er, der doch wie alle indischen Fürsten etwas darin sucht, sich in jeder Beziehung nur des Allerbesten zu bedienen, das es irgend gibt. Dann, bei einem kleinen Aufenthalt, schaute ich mir das auf die Türen gemalte Schlangenwappen des Nizam genauer an und stellte so fest, daß es offenbar erst ganz kürzlich von wenig geübter Hand aufgebessert oder neu hergestellt worden war. Schließlich hatte der eine Hinterreifen drei geflickte Stellen. Und – der Nizam von Haidarabad hat es nicht nötig, ausgebesserte Pneumatiks zu benutzen. – Dies waren die Beobachtungen, die mir genügten, um die beiden angeblichen Leute des Fürsten schärfer zu beobachten. Bei der Ankunft in Medik merkte ich so, daß sie Wert darauf legten, unsere Büchsen im Wagen zu behalten. Sie wollten also doch höchstwahrscheinlich entweder die Patronen entfernen oder aber die Kugeln lockern und das Pulver ausschütten. Nachher fand ich ja auch diese Vermutung bestätigt.“
„Und – der „echte“ Wagen des Nizam, – wo mag der geblieben sein?“ fragte einer der Ingenieure.
„Der Chauffeur wurde gestern abend von dem Goanesen, also von Warbatty, wie er mir noch bei einer kurzen Unterredung unter vier Augen eingestanden hat, angeblich als mein Beauftragter zu dem Hausminister des Nizam geschickt mit der Bitte, der Kraftwagen des Fürsten möchte mich erst zwei Stunden später, also um acht Uhr, von dem Fremdenheim von Tezra abholen. Ein sehr einfacher Trick Warbattys, – einfach, aber doch schlau. – Ich hatte mir sofort gedacht, daß Warbatty auf diese Weise das Auto des Nizam ausgeschaltet hatte. Deshalb fragte ich den Chauffeur auch, ob er wirklich den Goanesen gestern nur einmal gesprochen hätte. Er mußte nun zugeben, das er gelogen hatte.“
„Jedenfalls sind Sie einer großen Gefahr entgangen, Master Harst,“ meinte der Engländer. „Ich möchte nicht gern einen Menschen zum Todfeind haben wie diesen Cecil Warbatty. Hoffen Sie denn nun, ihn in Nagpur festnehmen zu können?“
„Das hoffe ich – stets!“ sagte Harst gutgelaunt. „Bisher habe ich mich leider jedoch ebenso stets getäuscht!“ –
Um Mitternacht waren wir in Nagpur. Dieses könnte man mit einem etwas kühnen Vergleich das indische Venedig nennen. Die Straßen der älteren Stadtteile sind nämlich zumeist von breiteren und engeren Kanälen durchzogen. Modern gebaut ist nur das Europäerviertel, das für eine Stadt von etwa 2000 Weißen und rund 130 000 Farbigen (Hindu und Mohammedaner) überraschend ausgedehnt ist und wie eine Weltstadt im Kleinen wirkt.
Wir stiegen im Hotel Viktoria ab. Harst suchte zwei Zimmer im zweiten Stock aus, in die von außen nicht einzudringen war, wovon er sich durch einen Blick durch das Fenster überzeugte. Wir hatten den Nachtportier herausklingeln müssen, der dafür ein anständiges Trinkgeld erhielt und der uns auch noch einen Imbiß besorgte. Wir schliefen bis gegen neun Uhr vormittags und begaben uns dann zu Fuß nach dem Postamt, wo wir auch postlagernd einen Brief für Harst vorfanden. Es war dies die Antwort auf Harsts Meldung auf das Detektivgesuch hin.
Als wir dann in dem öffentlichen Parke, der wie alle diese Anlagen in Indien vortrefflich gepflegt war, auf einer Bank saßen, las Harst mir das Schreiben vor.
Es lautete in tadellosem Englisch:
Sehr ehrenwerter Master Harst!
Erst heute früh ließ ich auf der Post nach Briefen für Masty Mastra durch einen vertrauten Diener nachfragen. Ich hatte bereits wiederholt Angebote von Leuten erhalten, die sich als Detektiv mir empfahlen. Doch keiner kam mir vertrauenswürdig genug vor, ihm das mitzuteilen, was mich seit vielen Wochen als Geschäftsmann und Vater bedrückt. Wie glücklich war ich, als nun Ihr Schreiben mich erreichte. Umgehend habe ich diese Antwort verfaßt. – Ich bitte Sie höflich, mich alsbald zu besuchen. Ich wohne im Europäerviertel in der Prince of Wales-Straße. Mein Geschäft ist leicht zu finden. Ich bin der Goldwaren- und Edelsteinhändler Amar Mansur, bin Parse und vielleicht der reichste Mann der Stadt – bis vor kurzem gewesen. Die geheimnisvollen Diebstähle haben mich jedoch bereits die Hälfte meines Vermögens gekostet, da mir gerade die wertvollsten Edelsteine geraubt wurden. – Ich bin in aufrichtiger Verehrung Ihr – Amar Mansur.
„Hm,“ meinte Harst, „die Sache verspricht so allerlei, lieber Schraut. Gehen wir sofort zu diesem Mansur, der nicht lediglich durch die Diebstähle schwer „bedrückt“ ist, sondern an dessen Herzen wohl noch ein anderer Kummer nagt. Sonst hätte er nicht geschrieben „als Geschäftsmann und Vater“. – Die Parsen sind die tüchtigsten Kaufleute Indiens. Besinne Dich nur auf Bombay. Dort gab es viele, die mehrfache Millionäre waren.“
Wir schritten den Hauptweg entlang. Dort, wo dieser in die Drakitta-Straße, die nach dem Europäerviertel führt, einmündet, hatte sich auf den Rasen ein wandernder Fakir niedergesetzt und zeigte einem andächtigen Kreise von Weißen und Farbigen seine Kunststücke.
Die Bezeichnung Fakir – darauf habe ich schon einmal hingewiesen – ist eigentlich falsch. Man sollte stets Yogi sagen. Diese Zauberer der Yogi-Kaste sind sämtlich Hindu; zumeist recht alt, ihre Kleidung schmutzig und zerlumpt, und sie selbst zu Ehren Brahmas seit Jahren ungewaschen. Oft arbeiten sie mit einem oder zwei Gehilfen. Und gewöhnlich sind sie gleichzeitig Schlangenbeschwörer.
Ich sah einen „echten“ Yogi heute zum ersten Mal. Was er an Künsten zeigte, waren ja ganz geschickte Taschenspielersächelchen, aber nicht geradezu Verblüffendes. Interessanter war der Mann selbst. Er war abschreckend mager. Aus einem Skelettgesicht mit weißem Bart leuchteten ein Paar übernatürlich große Augen, schwarze Augen von einem Feuer hervor, als ob Fieberglut diese Blicke erhitzt hätte. Dabei hatten die Augen aber einen Ausdruck, als sähen sie nichts von dem Kreise der Zuschauer ringsum, sondern stets nur Gestalten, die übernatürlicher Art waren. Niemals wieder habe ich jedenfalls derartige Augen gefunden.
Harst sprach leise mit einem Offizier[4] der indischen Kolonialarmee, der neben ihm stand und der ein paar Damen bei sich hatte, die offenbar erst kürzlich von England herübergekommen waren.
Ich hörte, wie der Offizier[5] erklärte, der Yogi tauche regelmäßig jeden dritten oder vierten Tag hier an derselben Stelle auf, sitze hier bis Mittag etwa und verschwinde wieder. – „Wir nennen ihn den Fakir von Nagpur,“ fügte er hinzu. „Er ist in vielem ein wandelndes Geheimnis. Niemand weiß, wo er seine Hütte hat, wie er heißt, obwohl er bereits seit zwanzig Jahren in Nagpur sozusagen heimisch ist.“
Nach einer Weile stieß Harst mich an und flüsterte mir zu: „Dort – das junge, schöne Weib mit dem mattgelben Gesicht!“
Ich blickte suchend über die Zuschauer hin. Ich fand das Mädchen sofort. Sie war ganz europäisch gekleidet, in Weiß, hielt den mattroten Sonnenschirm aufgespannt und verfolgte die Vorführungen des Yogi mit einer solchen Aufmerksamkeit, daß sie sich um nichts anderes kümmerte.
Der Fakir nahm jetzt eine flache Tonschale zur Hand, schüttete eine Menge Reiskörner hinein, setzte die Schale weit vor sich auf den Boden und deutete dann auf das schöne, junge Weib, die zusammen mit dem Schirmstock in der Linken auch ein feines Spitzentaschentuch hielt.
Sie warf ihm das Tüchlein zusammengeballt hin, das er langsam glatt strich und dann über die Schale deckte. Als er es nach wenigen Sekunden mit einem Ruck wegnahm, waren die Reiskörner zu einem leicht dampfenden Häuflein zusammengeballt und sahen ganz wie gedünstet aus. Er legte nun die Hände dicht darüber, als wollte er den Reis herausheben, öffnete die Hände wieder, und – darin lag jetzt eine der kleinen indischen Sumpfschildkröten, die kaum die Größe eines Fünfmarkstückes erreichen. Der Reis aber war bis auf das letzte Körnlein verschwunden.
Harst wechselte einige leise Worte mit dem Offizier. Ich verstand nur des letzteren Antwort:
„– Tochter eines Parsen, – bekannter Edelsteinhändler –“
Da zog Harst mich mit sich fort. „Komm, mein Alter,“ sagte er gutgelaunt und schob seinen Arm in den meinen, „wir haben Glück gehabt –“
„Weshalb denn?“
„Weil ich Amar Mansur nun bestimmt helfen kann. – Frage aber nicht weiter. Du wirst alles früh genug erfahren.“
4. Kapitel.
Fatima.
Das Geschäft des Parsen lag in einem modernen Hause, hatte zwei große Schaufenster und enthielt schon in diesen eine Unmenge wertvollster, teilweise antiker Schmuckstücke. Als wir eintraten, schrillten sofort zwei sehr laute elektrische Glocken, und aus einem Nebenraum erschien sogleich auch ein älterer Mann, den man ebenso gut für einen Spanier hätte halten können. Und doch war’s Mansur, der Parse, einer jener farbigen Bewohner Indiens, die äußerlich vollständig Europäer geworden sind. Sein gewandtes, sicheres Benehmen, seine liebenswürdigen Umgangsformen und die Offenheit seines Blickes nahmen sofort für ihn ein.
Er bat uns in sein Privatkontor, das mit seiner eleganten Einrichtung jedem ersten Berliner Geschäftshause Ehre gemacht hätte. – Auf Harsts Frage nach den Geschehnissen, die ihn zu der Anzeige veranlaßt hätten, erzählte er recht übersichtlich folgendes.
Vor zwei Monaten hatte er zum ersten Male das Verschwinden eines einzelnen, großen Smaragds bemerkt. Der Stein war etwa 20 000 Mark wert gewesen. Von da an kamen ihm in jeder Woche gerade die kostbarsten seiner ungefaßten Diamanten abhanden, ohne daß es je gelungen wäre, den Dieb zu erwischen. Er hatte deshalb auch seine beiden langjährigen Angestellten schließlich entlassen, da auch der hiesige Detektivinspektor erklärt hatte, nur einer von den beiden könnte der Dieb sein, oder aber sie arbeiteten gemeinsam.
Doch – trotzdem verblieb es bei den unerklärlichen Diebstählen. Selbst die allerschärfste Bewachung des Ladens half nichts. Stets geschahen die Beraubungen der Kästen am Tage und stets so, daß nicht einmal der Schimmer eines Verdachts auf irgend jemand fiel.
„Sie können sich meine Aufregung und meine Verzweiflung denken, Master Harst,“ fuhr der Parse fort. „Noch ein halbes Jahr, und ich bin ruiniert. Ich flehe Sie an: Klären Sie dieses geradezu unlösbare Rätsel auf[6]! Wer bestiehlt mich – wer in aller Welt?!“
Sein verstörtes Gesicht war wirklich mitleiderregend.
„Und Ihre andere Herzensangst?“ fragte Harst freundlich. „Wie steht es damit?“
„Oh – ich will Ihnen nichts verschweigen – gar nichts! – Es handelt sich um mein einziges Kind, meine Tochter Fatima. Ich bin mit ihr schon in Bombay bei einem der berühmtesten Ärzte gewesen. Nichts vermag sie von dem entsetzlichen Wahne zu befreien, daß sie zeitweise in einen Marabu verwandelt wird –“
„Marabu?!“ (indische Storchart) fragte Harst schnell.
„Ja. – Ich sehe Ihnen an, Master, wie sehr Sie dies in Erstaunen setzt. Es gibt gewiß zahllose Formen zeitweiliger Geistesstörung. Doch – so wie sich das Leiden bei Fatima äußert, hat es selbst Professor Sinclair in Bombay noch nie beobachtet. Wenn es nicht so unendlich traurig wäre, könnte man über all das lachen, was in diesen Stadien der Bewußtseinstrübung von meiner Tochter als Marabu getrieben wird. Nicht nur daß sie mit langsamen Storchenschritten im Hause hin und her wandert, nein, sie spricht dann auch nicht ein einziges Wort, ahmt vielmehr nur das Schnabelklappern nach und nimmt auch nur mit dem Munde, ohne Fingerbenutzung, direkt vom Teller Speisen auf –“
Man merkte, wie schwer es ihm wurde, dies Unglück vor Fremden zu enthüllen. Harst winkte ihm denn auch zu, sagte sehr herzlich:
„Ich danke Ihnen. Das Gehörte genügt mir. Nur noch eine Frage: Seit wann hat Ihre Tochter diese Anfälle und wie oft?“
„Seit vielleicht zwei Monaten und fast regelmäßig ein bis zwei Mal in der Woche.“
„Wie lange halten die Anfälle an?“
„Zumeist kaum eine Stunde.“
„Haben sie sich auch mal außerhalb des Hauses eingestellt?“
„Nein – niemals. Eigentlich regelmäßig stets vormittags.“
„Hatte Ihre Tochter heute einen Anfall?“
„Ja. Vor etwa anderthalb Stunden.“
„Was sagte der Professor zu dieser Krankheit?“
„Er hielt sie für den Beginn völliger Geistesumnachtung.“
Harst schüttelte den Kopf. „Da kann ich Sie jetzt schon beruhigen. Von Geistesumnachtung ist keine Rede. – Ich möchte aber noch einiges über die Diebstähle wissen. – Wann vermißten Sie den letzten Wertgegenstand?“
„Vor drei Tagen. Es war ein hellblauer Diamant.“
„Heute vermissen Sie nichts?“
„Oh – das kann ich erst abends nach Geschäftsschluß feststellen, wenn ich die Schaufensterkästen hereinnehme und den Inhalt dieser und der Auslagen des Verkaufstisches in den Stahlschrank für die Nacht lege.“
„Bitte – tun Sie’s ausnahmsweise sofort,“ meinte Harst.
„Weshalb? – Daß ich wieder bestohlen werde, Master Harst, – entweder heute oder morgen, das weiß ich ja leider ganz bestimmt. – Aber – selbstverständlich tue ich ganz, wie Sie es wünschen –“
Bereits eine Viertelstunde drauf konnte er Harst, gänzlich verstört jetzt, erklären, daß ein Brillant, den er für den Maharadscha von Bikara hatte umschleifen sollen, verschwunden sei. Vorhin habe der Stein, so behauptete er jammernd, noch auf der Schleifbank gelegen. Und kein Fremder habe die einem Stahlkäfig gleichende kleine Werkstatt neben dem Kontor betreten.
„Sie werden den Stein wiedererhalten,“ sagte Harst tröstend. „Verlassen Sie sich ganz auf mich. – Ich muß jetzt schnell noch anderswohin. Ich gebe Ihnen jedoch noch heute genaue Verhaltungsmaßregeln.“
Wir eilten dann wieder dem öffentlichen Parke zu.
„Ich kann Dir jetzt schon mitteilen,“ erklärte Harst mir unterwegs, „daß der alte Yogi bei alledem eine mir bis jetzt noch etwas unklare Rolle spielt. Wir müssen unbedingt versuchen, ihm auf den Fersen zu bleiben und festzustellen, wo er seinen Schlupfwinkel hat. Wir werden zu diesem Zweck getrennt arbeiten. Der eine von uns, ich selbst, will hinter dem Fakir hergehen; Du aber siehst zu, Dich seitwärts von ihm zu halten.“
Der Yogi saß noch auf dem Rasen wie vorhin. Der Zuschauerkreis war noch dichter geworden. Wir hatten Glück gehabt. Der Alte hätte ebenso gut auch bereits seine Vorstellung beendet haben können.
Wir schritten daher gemächlicher auf den Menschenhaufen zu. Als wir noch fünf Schritt entfernt waren, packte Harst plötzlich meinen Arm, blieb stehen und starrte wie gebannt geradeaus. Dann machte er kehrt. Sein Tempo wurde immer schneller. Eine Rikscha kam uns entgegen. Er rief den Kuli an. Wir stiegen ein und ließen uns nach dem Hotel fahren. Hier erklärte Harst dem Geschäftsführer, wir würden auf vier Tage einen Jagdausflug unternehmen. Unsere Zimmer sollten für uns freigehalten werden. Gleich darauf brachte uns dieselbe Rikscha nach der Polizeidirektion. Der hiesige Detektivinspektor hieß Smith und war ein rothaariger Engländer von etwas polteriger Art. Als Harst sich ihm vorstellte, war er sofort die Liebenswürdigkeit selbst, wenn auch auf seine Weise, lachte dann aber schallend los, als der deutsche Liebhaberkollege ihm erklärte, man würde nun vielleicht die Diebe der Juwelen des Parsen Mansur fassen können.
„Diebe, Master Harst, – Diebe?!“ meinte er. „Lassen Sie sich doch keinen Bären von Mansur aufbinden. Der schlaue, reiche Herr schwindelt ja. Von den Diebstählen ist kein Wort wahr. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe ihm das auch durch die Blume zu verstehen gegeben. Seitdem läßt er uns in Ruhe und sucht zum Schein einen Privatdetektiv. Die Parsen sind die gerissensten Geschäftsleute. Er hat seine „Verluste“ bisher auf etwa 15 000 Pfund angegeben. Die braucht er jetzt nicht mehr zu versteuern! Das ist der Witz!“
Harst sah den Inspektor ernst an. „Das ist nicht der Witz, Master! Ganz im Gegenteil! Ich habe die Beweise, daß die Diebe existieren. Vielleicht genügt Ihnen das, wenn ich so etwas sage.“
Smith wurde unsicher. „Wirklich, Master Harst? – Da bin ich gespannt. Erzählen Sie doch bitte.“
„Später werde ich es tun. Jetzt möchte ich Sie bitten, drei gewandte Beamte hinter dem sogenannten Fakir von Nagpur herzuschicken, die jedoch lediglich feststellen sollen, wo der Alte sein Versteck hat, – nichts weiter, und natürlich, ohne sich sehen zu lassen –“
„Hinter – dem Fakir?!“ Smith war sprachlos. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich jedoch schnell. „Oh – von dem Manne müssen wir die Finger weglassen, Master Harst! Den verehren die hier hausenden Hindu als Heiligen. Meine Beamten sind sämtlich Hindu, und –“
„Schon gut. Dann geben Sie mir bitte alles Nötige, daß wir uns schleunigst als Eingeborene maskieren können. Und – schweigen Sie gegen jedermann! Daß muß ich unbedingt von Ihnen verlangen. Ich habe Ihr Wort, nicht wahr?“
„Gewiß – gewiß –“
In Smiths Dienstzimmer verwandelten wir uns in kurzem in durchaus echt aussehende Hindu der ärmeren Volksschichten. – Und – wir hatten abermals Glück. Der Yogi schickte gerade die Zuschauer weg, als wir in die Nähe seines altgewohnten Platzes kamen. Wir hatten uns getrennt und taten, als ob wir nicht zusammengehörten.
Die Menge verlief sich. Bei dem Alten, der jetzt sein Handwerkszeug in einen Korb packte, blieben nur ein paar Kinder und ein Buckliger zurück, dem Anzuge nach gleichfalls ein Heiliger mit Vorliebe für eine Schmutzkruste und einen zerlöcherten Mantel.
Der Bucklige, dessen Turban bis über die Ohren reichte, nahm jetzt den Korb und ging davon. Der Fakir folgte langsam, sich auf einen Stecken stützend, und machte des öfteren halt, als müsse er ausruhen. Bei dem lebhaften Verkehr auf den Straßen konnten wir, seine Verfolger, gar nicht auffallen. Aber – wir konnten ihm leider auch nicht auf den Fersen bleiben. In der Eingeborenenstadt bestiegen er und der Bucklige nämlich ein kleines Boot auf einem der breitesten Kanäle und verschwanden rasch in dem Gewirr der schmalen, labyrinthartigen Wasserstraßen.
Harst gesellte sich mir wieder zu. „Lieber Schraut, das war vorauszusehen!“ meinte er. „Nun – wenn wir den Yogi nicht mit den Augen finden können, müssen wir’s mit dem Verstande tun. Gehen wir zu dem Parsen. Aber wieder einzeln. Vielleicht spukt Warbatty hier bereits herum.“
Mansur, der Edelsteinhändler, erkannte uns nicht. Erst als Harst ihm seinen Namen zuflüsterte, nickte er verständnisinnig und führte uns in sein Privatkontor.
Hier machte Harst ihm den Vorschlag, er solle uns den Seinen gegenüber als neue Geschäftsbekannte gleichzeitig aber als Naturheilkundige vorstellen, die Fatima vielleicht von ihrem Leiden befreien könnten.
Wir gingen in Mansurs Privatwohnung hinauf, die vollständig europäisch eingerichtet war. Auch seine Frau, eine wandelnde Fettmasse, besaß ganz das Benehmen einer europäischen Dame. Fatima selbst war ein auffallend schönes Mädchen, wie ich bereits bemerkt habe, und gab sich völlig zwanglos, obwohl sie sofort hörte, daß Harst versuchen wolle, sie zu heilen.
Er begann sie auszufragen. Sie erklärte, sie selbst wisse nichts davon, daß sie zeitweise ihr Menschentum abstreife und sich ganz wie ein Marabu benehme.
Weiter gab sie an, nie ernstlich krank gewesen zu sein. Nur an Zahnschmerzen litte sie viel; und sie sei eigentlich dauernd bei dem indischen Arzte und Zahnarzte Doktor Kodowira hier in Nagpur in Behandlung.
Wir erfuhren, daß dieser Doktor in England studiert habe und einer der gesuchtesten Ärzte der Stadt, etwa fünfzig Jahre alt sei und im Eingeborenenviertel in der Nähe des großen Brahmatempels in einem prächtigen, modernen Hause wohne.
Was mir an Fatima auffiel, war eine gewisse ängstliche Scheu im Blick, die zu ihrem sonstigen Benehmen wenig paßte. Sie vermied es, Harst bei dieser Unterredung anzusehen. Schaute sie ihm gelegentlich ins Gesicht, so glitten ihre Augen schnell darüber hinweg.
Harst bat uns jetzt, ihn mit Fatima allein zu lassen. Erst nach einer halben Stunde betrat er das Nebenzimmer, in dem ich mit Mansurs Gattin saß. Wir verabschiedeten uns, und unten im Laden erklärte Harst dem Parsen, er hoffe jetzt ganz bestimmt ihm all seine Betrübnis nehmen zu können; nur müsse er noch ein paar Tage Geduld haben.
Wir suchten darauf Inspektor Smith wieder auf, der uns bei dem Pförtner der Polizeidirektion, einen Mohammedaner, unauffällig unterbrachte. Wir bewohnten dort ein winziges Zimmerchen.
In den folgenden Tagen ließ Harst mich viel allein. Ich durfte nur nach Dunkelwerden mit ihm zusammen eine Stunde spazieren gehen. Er wechselte die Verkleidung häufiger, und ich merkte, daß er mit den Erfolgen seiner Spürtätigkeit sehr zufrieden war. Was er jedoch eigentlich zur Tages- und Nachtzeit außerhalb des Hauses trieb, darüber schwieg er beharrlich.
5. Kapitel.
Das Taschentuch.
So kam der Abend des dritten Tages heran. Smith saß in unserem Zimmerchen und ließ sich von Harst die Verhaltungsmaßregeln für den nächsten Vormittag geben. Der Inspektor war jetzt Feuer und Flamme für diesen stark geheimnisvollen Feldzug gegen die Juwelendiebe. Inzwischen hatte er eingesehen, daß ein Mann wie Harst nicht auf Scheinbeweise hin behaupten würde, Mansur sei tatsächlich fortgesetzt auf sehr raffinierte Art bestohlen worden.
Harst verlangte, daß ein starkes Polizeiaufgebot ganz unauffällig den Platz umstellen solle, wo der Yogi seine Künste zeigte.
„Ich weiß bestimmt, daß er morgen wieder auftauchen wird,“ sagte er. „Er ist ein ganz gefährlicher Betrüger, Inspektor, und Sie werden staunen, welche Enthüllungen der morgige Tag bringt.“
Nachdem Smith gegangen, warteten wir noch bis gegen zehn Uhr. Dann begaben wir uns nach Mansurs Haus, der unten im dunklen Laden bereits aufgepaßt hatte und uns sofort einließ. In seinem Privatkontor verbrachten wir die Nacht, in bequemen Korbsesseln sitzend.
Um sieben Uhr kam Mansur, öffnete die eisernen Fensterladen und begann seine kostbaren[7] Waren einzuräumen. Wir selbst hatten uns in dem Privatkontor in einer Ecke verborgen, vor die Mansur einen kostbaren indischen Vorhang drapiert hatte.
Plötzlich kam der Parse zu uns geeilt, flüsterte:
„Fatima hat wieder einen Anfall –“
Nach einer Weile betrat das arme Mädchen das Kontor. – Ich hatte bereits davon gehört, daß es Irre gibt, die wie Hunde bellen und ganz wie Hunde sich benehmen, daß andere wieder wähnen, Frösche zu sein und dauernd nur auf allen Vieren hüpfen.
Fatimas Storchengang, ihre Kopfbewegungen, das Nachahmen des Geklappers des Schnabels wirkten mehr als unheimlich. Sie ging, ohne sich um ihren Vater zu kümmern, hin und her, war bald im Laden, bald im Kontor, bald in der kleinen Werkstatt.
Mansur hatte auf Harsts Anraten auf die Platte des Schreibtisches drei ungefaßte, große Diamanten gelegt. Dann geschah ganz unerwartet etwas, das ich mit geradezu entsetzten Augen beobachtete.
Fatima beugte sich über den Tisch, nachdem sie sich scheu umgesehen hatte, und hob mit dem Munde die Edelsteine nacheinander auf, ging dann langsam hinaus und in die Wohnung nach oben.
Der Parse, der im Laden einen Kunden bedient hatte, wurde jetzt von Harst hereingewinkt.
Harst deutete auf die leere Tischplatte.
„Ihre Tochter hat die Edelsteine an sich genommen,“ sagte er. „Sie handelt unter einem unwiderstehlichen Zwange. Tun Sie nichts, überlassen Sie alles mir. Sie werden Ihr Eigentum zurückerhalten.“ –
Anderthalb Stunden später.
Der alte, weißbärtige Yogi hatte heute einen sehr dichten Zuschauerkreis um sich versammelt. Nichts verriet jedoch, daß Inspektor Smith besondere Maßnahmen getroffen hatte; seine Beamten hatten sich als harmlose Müßiggänger unter die Menge gemischt. Er selbst saß in der Nähe im Parke auf einer Bank, rauchte behaglich seine Zigarre und schien lediglich für seine Zeitung Interesse zu haben.
Harst stand als ärmlicher Inder in der vordersten Reihe der Zuschauer mit dem Gesicht nach dem Fakir hin, der wieder am Boden hockte und links neben sich den Korb mit seinen Geräten aufgestellt hatte.
Ich hatte meinen Platz programmäßig hinter dem Yogi. Rechts von mir befand sich der kleine Bucklige, dessen zotteliger Bart, Riesenturban und löcheriger Mantel ihn völlig „echt“ erscheinen ließen.
Und doch wußte ich jetzt, daß dieser Hindu und Vertraute des Fakirs kein anderer als Warbatty war. Harst hatte es mir erst auf dem Wege hierher gesagt und mir gleichzeitig den Befehl gegeben, Warbatty niederzuschießen, falls er einen Fluchtversuch mache.
Unser alter Feind schien sich durchaus sicher zu fühlen. Er rauchte eine langstielige Pfeife, hielt sie in der linken Hand und zeigte ganz unbekümmert seine vier Finger.
Ich beobachtete Harst verstohlen. Und ich merkte, daß sich in seinem Gesicht eine gewisse Unruhe widerspiegelte. Er schaute des öfteren auf den Buckligen, und seine Blicke wurden dabei immer nachdenklicher.
Der Yogi nahm jetzt aus dem Korbe eine über ein Meter lange Brillenschlange heraus und ließ sie nach den Klängen einer Flöte jene pendelnden Bewegungen mit hochgerichtetem Oberleibe ausführen, die man als Tanz ansprechen kann. Dann griff er abermals in den Korb und holte eine grün und gelb gefleckte, dünne Baumschlange hervor, die er jedoch vorsichtig mit einem unten gespalteten Stabe dicht unterhalb des Kopfes gefaßt hatte. Diese Art Baumschlangen, die die Hindu Bindraka nennen, sind überaus giftig. Das Reptil, das einer anderthalb Meter langen Gerte glich, machte verzweifelte Anstrengungen frei zu kommen. Die Zuschauer waren unwillkürlich mehr zurückgewichen. Auch ich folgte und sah auch, daß Harst sich hinter eine soeben aufgetauchte junge Dame stellte. Und diese war – Fatima, die Tochter des Edelsteinhändlers.
Der Fakir warf die Baumschlange mit einem Male in den Korb zurück und deckte den dicht schließenden Deckel darüber. Dann begann er das uns bereits bekannte Kunststück mit der flachen Schale und den Reiskörnern. Alles spielte sich wie vor vier Tagen ab. Fatima hielt wieder ihr zusammengeballtes Taschentuch in der Hand.
Nun warf sie es dem Yogi zu.
In demselben Augenblick hatte Harst eine Trillerpfeife an den Lippen.
Der Pfiff schrillte gellend.
Im Nu hatten die verkleideten Beamten den Fakir gepackt. Ich schaute nach Warbatty hin, zog den Revolver.
Da bekam auch schon Inspektor Smith den Buckligen beim Kragen. Zwei seiner Leute griffen zu. Handschellen schlossen sich um des völlig Überrumpelten Gelenke.
Harst hob das Taschentuch auf. Es breitete sich aus, und heraus fielen die drei Edelsteine, die Fatima heute im Munde mit sich genommen hatte.
Dann – riß er dem Yogi den Turban samt der zotteligen Perücke ab, auch den falschen Bart, rief nun:
„Inspektor, verhaften Sie diesen Betrüger und Dieb, den Doktor Kodowira, der hier den Fakir von Nagpur spielt, und der als Zahnarzt der Tochter des Parsen Mansur diese seit Monaten geistig völlig in seiner Gewalt durch die Macht der Hypnose hat, der sie zu den Diebstählen zwang, der ihr in der Hypnose den Befehl erteilte, sich wie ein Marabu zu benehmen, damit sie in diesem Zustande stumm blieb und die gestohlenen Juwelen im Munde in Sicherheit bringen konnte.“
Dann wandte Harst sich an den Buckligen. Auch ihm riß er den Turban ab.
Aber – welche Enttäuschung! Bart und Haar stellten sich als echt heraus.
„Wer bist Du?“ brüllte Harst den Menschen in einer Erregung an, wie ich ihn selten gesehen habe.
„Ein Schuhmacher aus Kamthi, Sahib,“ erklärte[8] der Bucklige zitternd. (Kamthi ist die Militärstation unweit Nagpur) – „Ich habe nichts verbrochen, Sahib nichts. Der weiße, kleine Sahib hat mich gestern gut bezahlt dafür, daß –“
„Meine Ahnung!“ rief Harst. „Das heutige Verhalten Warbattys kam mir auch zu seltsam vor. Und nun ist’s nur sein getreues Ebenbild!“
Dann wieder fragte er den Doktor Kodowira in wilder Hast:
„Wo ist Warbatty geblieben? Er wohnte in Ihrem Hause. Ich weiß es bestimmt. Gestehen Sie alles ein. Es ist am besten für Sie –“
Der Arzt gab seine Sache verloren, erklärte:
„Warbatty ist krank. Er liegt in einem geheimen Gemach neben meinem Arbeitszimmer.“
Gleich darauf eilten wir dem Hause des Doktors zu, der uns begleiten mußte. Aber – wir fanden das Nest leer.
„Natürlich – entflohen!“ meinte Harst und schaute Kodowira nachdenklich an. Wir standen jetzt in dessen elegantem Sprechzimmer. – „Ich habe etwas Ähnliches sofort vermutet, als mir schon vorhin bei den Vorführungen des Fakirs Zweifel aufstiegen, ob ich den echten Warbatty vor mir hätte. – Doktor Kodowira, Sie haben die gestohlenen Juwelen vielleicht noch sämtlich hier im Hause verborgen,“ wandte er sich dem entlarvten Betrüger wieder zu. „Wollen Sie nicht einmal nachsehen, ob Ihr Verbündeter Warbatty nicht vielleicht nur deshalb jetzt nach Nagpur gekommen ist, um Ihnen diese Beute von vier Monaten heimlich zu rauben?“
Kodowira zuckte zusammen. In seine Augen trat ein Ausdruck des Mißtrauens, der aber Warbatty galt. Dann eilte er nach der einen Wand hin, nahm ein Bild herab und öffnete ein tadellos verborgenes Geheimfach.
„Leer!“ brüllte er. „Leer! Auch mein Geld hat der Schurke gestohlen!“
„Ja – Sie sind ein betrogener Betrüger!“ sagte Harst ernst. „Warbatty legt seine Helfershelfer zumeist hinein. – Ich kann Ihnen ziemlich genau sagen, wie er sich Ihrer für diesen neuesten Streich bedient hat. Sie werden ihn zufällig kennen gelernt haben –“
„Nein, Master Harst, nicht zufällig. – Ich bin hier seit vielen Jahren als „alter Yogi“ aufgetreten, um mir größere Einnahmen zu verschaffen. Die freiwilligen Gaben flossen nach den Vorstellungen stets sehr reichlich. Außerdem machte ich als Fakir für mich als Arzt insofern Reklame, als ersterer eben, um Rat in Krankheitsfällen gefragt, die Betreffenden stets an den Doktor Kodowira wies.“
„Sie sind wenigstens ehrlich jetzt,“ meinte Harst.
„Lügen hat ja keinen Zweck mehr. Ganz besonders jetzt nicht, wo ich erkannt habe, welch gemeiner Schurke dieser Warbatty ist. – Er war es ja, der mich zum Verbrecher gemacht hat. Denn das Doppelspiel als Yogi und Arzt mag verwerflich gewesen sein, aber – ich schädigte dadurch niemand, im Gegenteil, ich habe zahllose arme Patienten ganz umsonst behandelt. Erst Warbatty hat mich geradezu gezwungen, auf seine Pläne einzugehen. Das kam so. Vor einem halben Jahre etwa erschien er eines Abends in meiner Wohnung und sagte mir auf den Kopf zu, daß ich und niemand anders der berühmte Fakir von Nagpur sei; er habe mich heimlich verfolgt, habe mich tagelang beobachtet und würde mich der Polizei anzeigen, wenn ich nicht mit ihm gemeinsame Sache mache. – Er ist von Hause aus selbst Arzt, wie er mir eingestand, und er unterbreitete mir den Vorschlag, den Juwelenhändler Mansur mit Hilfe von dessen Tochter allmählich gehörig auszuplündern. Erst von ihm lernte ich, andere Leute mit Hilfe meines durchdringenden Blickes und der Fähigkeit, meinen Willen auf einen bestimmten Punkt zu sammeln, mir durch Hypnose untertan zu machen. Bei Fatima gelang mir dies sehr leicht. Schrittweise sozusagen unterwarf ich sie mir, bis ich auf sie so schrankenlosen Einfluß hatte, daß sie selbst posthypnotische Befehle befolgte, also solche, die sie erst nach ihrem Erwachen aus dem Zustande der Einschläferung ausführen sollte. – Ich tat alles, was Warbatty mir vorgeschrieben hatte. Fatima litt infolge hypnotischen Befehles an scheinbarer zeitweiser Geistesstörung, hielt sich dann für einen Marabu, wanderte planlos durch das Haus, mußte aber bei guter Gelegenheit während dieser Anfälle stets einen oder mehrere Steine im Munde aus dem Laden nach dem Garten tragen, hier verstecken und mir nachher sofort in dem Taschentuche zuwerfen, damit niemand eine Verbindung zwischen ihr und dem Yogi ahnen oder durch irgend einen Zufall herausmerken könnte. Daß sie zu meinen Vorführungen sich fast regelmäßig einfand, war nicht weiter auffällig. Ich habe zahlreiche regelmäßige Bewunderer meiner Künste. Auch daß gerade sie mir das Taschentuch stets lieh, fiel nicht weiter auf. – Als Warbatty nun vor fünf Tagen bei mir erschien (er hatte sich bereits brieflich von Bombay aus angemeldet), lagen in dem geheimen Wandfach für etwa 15 000 Pfund Juwelen (300 000 Mk.). Er wollte mir die Hälfte des Wertes in Banknoten auszahlen, wollte aber auch gegen Mansur jetzt insofern noch auf andere Weise vorgehen, als ich Fatima durch hypnotischen Befehl zwingen sollte –“
„Ich danke,“ unterbrach Harst ihn hier. „Ich weiß Bescheid. Ich habe Fatima gestern abend wiederum hypnotisiert. Und da mein Wille noch stärker als der Ihre ist, Doktor Kodowira, hat sie mir berichten müssen, was sie auf Ihren Befehl tun sollte. Sie sollte heute nacht ihrem Vater die Schlüssel zum Laden und zum Stahlschrank heimlich wegnehmen und sie Ihnen an einem Bindfaden um Mitternacht aus dem Fenster zureichen. Dann wollten Sie und Warbatty den Tresor völlig ausplündern, einen gewaltsamen Einbruch vortäuschen, Fatima die Schlüssel wieder aushändigen und auf diese Weise erreichen, daß der große Raub für alle Zeit in undurchdringliches Dunkel gehüllt blieb. – Inspektor Smith und Du, mein lieber Schraut, – Ihr dürftet wissen wollen, wie ich hinter diese in ihrer Art geradezu raffiniert ausgeklügelten Diebstähle gekommen bin. Ein paar Worte genügen. – Ich schaute dem Fakir zu. Als Fatima diesem das Taschentuch hinwarf, merkte ich sofort, daß sich darin etwas Schweres befinden müßte. Ein Taschentuch ohne Inhalt fällt bedeutend langsamer in einer Bogenlinie herab. Außerdem fing es der Yogi aber auch so auf, bekam es so zu fassen, daß darin notwendig etwas verborgen sein mußte. – Dies sah ich, bevor ich Mansur zum ersten Male besuchte. Dann, auf dem Rückwege von ihm, bemerkte ich den Buckligen. Dieser konnte nur Warbatty sein. Aber – Fakir und Warbatty entgingen unserer Verfolgung. – Ich habe Fatima noch an demselben Tage probeweise hypnotisiert, wiederholte dies des öfteren und erreichte, daß mein Einfluß auf sie wuchs. Gegen Doktor Kodowira hatte ich sofort Verdacht geschöpft, als ich von der monatelangen Zahnbehandlung hörte und als ich ebenso schnell die zeitweise Geistesverwirrung als Folge eines hypnotischen Befehls erkannt hatte. Ich sagte mir, daß gerade der Doktor die beste Gelegenheit hätte, Fatima einzuschläfern, und die derart Willenlose zu allem Möglichen auszunutzen. Von dieser Erkenntnis bis zu dem Argwohn, Fatima allein müßte die geheimnisvollen Diebstähle ausgeführt haben, war nur ein Schritt. Und ebenso leicht ließ sich zwischen den geraubten Juwelen, dem Taschentuche mit Inhalt und dem Fakir eine Verbindung herstellen. So kam ich dazu, das Haus des Doktors nachts zu umschleichen; so sah ich, daß Warbatty dort als heimlicher Gast weilte, so fand ich heraus, wer der Yogi in Wirklichkeit war. – Gewiß – ich habe nun dieses Verbrechen aufgeklärt. Und doch ist es wieder nur ein halber Erfolg gewesen. Warbatty hat – was ich erst zu spät merkte – Verdacht geschöpft, ich sei hinter ihm her, hat dann gestern den buckligen Schuhmacher aus Kamthi angeworben, damit dieser mich täuschen sollte, was ihm ja auch gelungen ist. Er selbst hat auf diese Weise einen Vorsprung von mehreren Stunden gewonnen. Mithin hat er eigentlich wieder – gesiegt! – Noch eine Frage, Doktor Kodowira. – Wie hat Warbatty Ihnen gegenüber die Anwerbung dieses Stellvertreters begründet?“
„Der Schuster kam vor fünf Tagen als Patient zu mir. Da sah ihn Warbatty. Und sofort machte er sich eine Maske zurecht, daß er dem Schuster völlig glich. Er sagte mir, daß Sie hier vielleicht auftauchen würden, Master Harst, und daß es gut sei, wenn wir Sie durch den Schuster, falls nötig, hineinlegen könnten. Gestern abend begann er den Kranken zu spielen. Ich mußte den Schuster sofort holen, und diesem befahl er, während meiner Vorführung genau die Zuschauer zu beobachten, ob er vielleicht darunter zwei verkleidete Weiße bemerke.“ –
Ich habe diesem Abenteuer nur noch einiges hinzuzufügen. Fatima genas vollständig. Die Marabu-Anfälle stellten sich nicht wieder ein. Ihr Vater wurde für seine Verluste durch des Doktors Besitztümer voll entschädigt. Er schenkte Harst und mir je einen wertvollen, altindischen Amulettring. Doktor Kodowira kam mit einer geringen Strafe dank Harsts Bemühungen davon. Er ist später in einer anderen Stadt wieder ein vielgesuchter Arzt geworden. –
Wir beide blieben nur noch zwei Tage in Nagpur. Dann reisten wir nach Allahabad weiter. Was wir dort erlebten, war vielleicht das seltsamste, was uns je begegnet ist. Wenn ich an den Wunderelefanten des Singar Chani zurückdenke, so …
Doch – davon erzähle ich besser im nächsten Bande von Harsts Orientabenteuern.
Der weiße Elefant des Singar Chani.
1. Kapitel.
Unser schwimmendes Heim.
Als wir uns von Inspektor Smith auf dem Bahnhof in Nagpur verabschiedeten, sagte er zu Harst: „Sie kommen zu einer für Ihre Zwecke recht ungünstigen Zeit nach Allahabad, wie mir soeben einfällt. Während sich dort nämlich im Dezember und Januar nur etwa eine Viertelmillion Pilger einfinden, um im heiligen Flusse Ganges zu baden, versammeln sich alle zwölf Jahre an diesem berühmten Wallfahrtsorte reichlich eine Million gläubiger, fanatischer Hindu. Und – Sie haben Pech! Gerade dieses Jahr ist wieder dasjenige, in dem die schmutzigen Gangeswasser besonders segensreich wirken sollen. Sie werden dort also in ein Millionengewimmel von Menschen hineingeraten, und es dürfte Ihnen schwer fallen, in der überfüllten „Stadt Gottes“ – Allah abad heißt ja Allahs Stadt – Cecil Warbatty herauszusuchen. Nun – jedenfalls viel Glück, Master Harst!“
Wir fuhren Allahabad aus diesem Grunde auch mit geringer Hoffnung entgegen, dort endlich unser schlaues Wild zur Strecke zu bringen. Seit September waren wir nun ununterbrochen hinter diesem Verbrechergenie her, hatten jedoch zumeist bei diesem Kampf nur leidlich abgeschnitten, hatten sozusagen stündlich in Lebensgefahr geschwebt und immer wieder einsehen müssen, daß wir es hier mit einer Persönlichkeit zu tun hatten, die an Intelligenz Harst gleichwertig war, der aber an brutalen Instinkten ein derartiges Übermaß zur Verfügung stand, daß schon deshalb dieser erbitterte Streit Harst-Warbatty für ersteren unendlich schwer zu einem siegreichen Ende zu bringen war.
Detektivinspektor Smith hatte Harst einen Empfehlungsbrief an einen reichen eingeborenen Kaufmann namens Alam Bandur mitgegeben. Bandur sollte ein in jeder Beziehung zuverlässiger und vielerfahrener Mann sein, der uns sehr nützlich sein würde.
Smith hatte in dieser Beziehung nicht zu viel gesagt. Der völlig zum Europäer gewordene Hindu empfing uns auf das liebenswürdigste und bedauerte unendlich, uns nicht mehr als Gäste in sein Haus aufnehmen zu können, stellte uns aber seinen großen, wenig benutzten Motorkutter zur Verfügung, der zwei geräumige, wohnliche Kajüten besaß und auf dem Ganges unweit der Festung zwischen zwei Pfählen vertäut lag.
In den Hotels, Pensionen und so weiter waren nicht einmal mehr die Dachkammern infolge des Pilgerandranges frei. Wir mußten also froh sein, dieses Unterkommen gefunden zu haben, nahmen dankend an und wurden von einem Diener Bandurs nach der Uferstelle des Ganges geführt, der gegenüber etwa zehn Meter ab der Kutter träge vor seinen Ketten schaukelte. Ein Bootverleiher setzte uns über. Der Diener Bandurs wollte mit unserem Gepäck sofort nachkommen.
Als wir jedoch an dem Motorboote anlegten, fanden wir es bereits von zehn Pilgern besetzt, die einfach die Tür zu den Kajüten erbrochen und sich darin häuslich eingerichtet hatten.
Es waren sechs Männer und vier Weiber, Zugehörige der untersten Kaste. Harst tat es leid, sie verdrängen zu müssen, und er einigte sich mit ihrem Wortführer dahin, daß die braune Gesellschaft sich auf dem Vorderdeck ein Zelt aus den Notsegeln des Kutters errichten sollte. Die Leutchen waren überglücklich und dankten den Sahibs wortreich.
Über das Kastenwesen der Hindu habe ich an anderer Stelle schon einiges gesagt. Es gibt vier Hauptkasten: Priester-, Krieger-, Gelehrten- und Kaufmannskaste. So rechnen zum Beispiel Lastträger, Diener, Arbeiter, Bauern und ähnliche Berufe mit zur Kaufmannskaste, während schon jeder Schreiber oder Barbier zur Gelehrtenkaste zählt. Im allgemeinen gilt die Regel, daß niemand sich zu einer höheren Kaste aufschwingen kann. Der Sohn des Wasserträgers muß wieder Wasserträger werden, der des Schusters wieder Schuster. Wollte die englische Kolonialregierung hieran ernstlich etwas zu ändern suchen, würde sie auf geschlossenen Widerstand selbst bei der untersten Kaste stoßen. Der Hindu hält mit fanatischer Zähigkeit an den alten Überlieferungen fest.
Von unseren zehn Mitbewohnern erklärten sich zwei der Männer, die etwas Englisch verstanden, sofort bereit, unsere Diener gegen geringe Bezahlung zu spielen. Harst sagte ihnen das Doppelte ihrer Lohnforderung zu, und von dem Augenblick an wären die sämtlichen Männer für uns durchs Feuer gegangen. Der Hindu ist ja überhaupt alles in allem ein hochanständiger Charakter. Ich wünschte, wir gebildeten Europäer würden uns an den Bekennern Brahmas ein Beispiel nehmen, was dankbare und aufrichtige Gesinnung anbetrifft.
Am Nachmittag hatten wir unsere schwimmende Wohnung auf dem Ganges bezogen. Zwei Stunden drauf, als wir es uns gerade etwas bequem gemacht hatten, erschien ein Boot mit einem sehr fetten Chinesen, und dieser schlitzäugige „Sohn des Himmels“ stellte sich uns als der Koch vor, den Alam Bandur für seine Gäste gemietet hätte. Der bezopfte Fettkloß brachte auch gleich zwei Riesenkörbe mit Lebensmitteln mit. Der Kutter hatte eine saubere, winzige Küche, und Atsi-Fo hat darin für uns manch Göttergericht zusammengebraut. Bevor er aber sein Amt antrat, mußte er Harst seine Hände vorzeigen. Er hatte alle zehn Finger. – Harst war vorsichtig. Warbatty verstand selbst einen zwei Zentner schweren Chinamann zu mimen, hatte jedoch bekanntlich an der Linken nur vier Finger. Der Zeigefinger fehlte. – Ebenso mußte Atsi-Fo, den wir sehr bald kurz in Hatschi umtauften, von den Speisen des ersten Abendbrots kosten. Warbatty operierte ja auch mit Gift.
So begann unser Aufenthalt in Allahabad. – Wir hatten keine Lust, uns gleich am ersten Abend in das Straßengewühl zu stürzen, hatte ja auch bereits einen Vorgeschmack von dem Treiben in einer indischen „heiligen“ Stadt während der sog. „Begeisterungszeit“ während der Fahrt vom Bahnhof durch die Straßen erhalten.
Jetzt, als wir in bequemen Bambusliegestühlen auf dem Kajütendeck unter dem gestreiften Sonnensegel saßen, zwischen uns ein Tischchen mit eisgekühlter Limonade, – jetzt genoß ich ein Bild, wie ich es eigenartiger und, man kann ruhig sagen märchenhafter nicht wieder schauen sollte.
Der riesige, heilige Ganges lag vor uns. Und neben uns zogen sich die fünffachen, siebenfachen Ketten von allerhand Fahrzeugen hin, die vor ihren Ankern und Tauen im Abendwinde sacht schwankten; Boote darunter, die man getrost jedem Altertumsmuseum hätte einverleiben können, gefertigt aus jenem rotbraunen Holze, das unverwüstlich ist, das nie fault; Boote in allen Größen und Formen bis zum schonerartigen Fahrzeug mit zwei Masten. Und all diese Kähne und Schifflein bedeckt mit kribbelnden, schreienden, badenden menschlichen Ameisen, bedeckt auch die Ufer des Stromes mit Unzähligen, die ihre frommen Waschungen vornahmen, um dereinst nach beendeter Seelenwanderung in den Himmel Brahmas leichter als andere einzuziehen.
Menschen überall – braune Leiber; Männer, Weiber, Kinder; eng zusammengepfercht Tausende und Abertausende; am engsten an der Südspitze der riesigen, durch die Einmündung der Dschamma in den Ganges gebildeten Halbinsel; denn an dieser Südspitze liegt das große, Jahrhunderte alte Fort, das in seinen Wällen den Hindu besonders heilige Dinge einschließt: den unterirdischen Brahmatempel, darin den sogenannten ewigen Feigenbaum und die berühmte Steinsäule des Azoka, die über und über mit Inschriften bedeckt ist.
Es war ein Bild, das selbst den Gleichgültigsten aufgerüttelt hätte; es war eben Indien, das Märchenland. –
Harst träumte bei seiner Zigarette vor sich hin. Auf dem Vorderdeck bewegten sich bescheiden und lautlos unsere Mitbewohner. In der kleinen Küche klapperte der chinesische Fettkloß mit Tellern und Töpfen.
„Die beste Gelegenheit für einen Gauner, im Trüben zu fischen,“ sagte Harst plötzlich. „Denn viele der reicheren Pilger, nein, wohl alle, schleppen Geschenke mit nach Allahabad und weihen sie den verschiedenen Göttern in den verschiedenen Tempeln. Der Engländer Gadby hat vor zwei Jahren den Wert dieser jährlichen Opfergaben für ganz Indien auf fünf Milliarden berechnet. Nimm an, daß davon auf Allahabad nur jährlich eine Million fällt, so kannst Du ungefähr berechnen, was in den Tempeln an totem Kapital aufgehäuft liegt. Kein Wunder, wenn diese Schätze immer wieder europäische Hochstapler nach Indien locken. Besinne Dich nur auf Bombay und die alte Tempelstadt. Dort schon versuchte Warbatty einen Anschlag auf Teile dieses toten Kapitals. Vielleicht will er hier etwas Ähnliches unternehmen. Es wird uns unmöglich sein, ihm diesmal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie sollen wir ihn hier wohl herausfinden?! – Ausgeschlossen – wenn uns nicht ein Zufall hilft –“
„Gestatte mir eine Bemerkung,“ sagte ich nun, und ich brachte damit etwas zur Sprache, das mir schon seit unserer Ankunft hier auf der Zunge brannte. „Wir haben diesmal darauf verzichtet, irgend eine Maske anzulegen. Wir sind hier keck als Harst und Schraut aufgetreten, ganz wie Du dies schon letztens vorhattest, indem Du hofftest, dadurch Warbatty leichter zu einem Gewaltstreich gegen uns zu verführen und ihn dabei endgültig „erledigen“ zu können. Ich muß Dir nun offen erklären, daß ich diese neue Art des Kampfes wider unseren schlauen Gegner sehr –“
„– klug finde,“ vollendete er lächelnd. „Nicht wahr – das wolltest Du doch sagen?! – Du hast ganz recht, lieber Alter. Diese neue Kampfesweise hat nämlich bereits die besten Früchte getragen –“
Ich horchte auf. „Du erklärtest doch soeben, daß uns nur ein Zufall helfen könnte,“ meinte ich unsicher.
„Ganz recht. Aber – ich hatte nicht daran gedacht, daß Warbatty den Bahnhof hier hat überwachen lassen können und daß einer seiner Helfershelfer uns leicht auf den Fersen bleiben konnte! – Als ich von dem „Zufall“ sprach, wußte ich auch noch nicht, daß der geriebene Cecil schon seine Fühler nach uns ausgestreckt hat. Erst vor Sekunden stellte ich dies fest, – gerade da, als ich Dir ins Wort fiel.“
Ich beugte mich weit vor. Die Abenddämmerung nahm schnell zu. Ich wollte Harsts Gesicht ganz genau sehen.
„Was hast Du festgestellt?“ fragte ich atemlos.
„Oh – ich kann mich auch geirrt haben. Dringe jetzt nicht weiter in mich. – Schau’ Dir lieber dort am Ufer die badenden Elefanten an. Prächtige Tiere sind’s –“
Erst jetzt bemerkte ich vier dieser Kolosse, die ganz in unserer Nähe von einer auf den Fluß mündenden Gasse aus ihr Abendbad nahmen. Einer davon war von sehr heller Hautfarbe.
„Heilige Elefanten,“ sagte Harst. „Drei der Mahuts (Lenker), die zwischen ihren Ohren hocken, sind Priester, Brahmanen. Also handelt es sich um Tiere, die Eigentum irgend eines Tempels sind –“ – Er rief einen der Inder vom Vorderdeck herbei, den Ältesten der Pilger; er hieß Rawaiku, und er sprach das Englische leidlich.
„Du könntest mir einen Gefallen tun,“ meinte Harst. „Nimm das kleine Beiboot des Kutters und rudere ein Stück flußaufwärts, erkundige Dich dann auf einem der verankerten Fahrzeuge, zu welchem Tempel die vier Elefanten dort gehören. Tu’s aber unauffällig, Rawaiku, und sage niemandem, daß ich Dich beauftragt habe. Verschweige auch den Deinen, daß Du diese fünf Rupien (die Rupie 1,10 Mark) leicht verdienen wirst.“ Er steckte ihm die kleine Banknote unauffällig zu.
Der alte Hindu dienerte überglücklich, lächelte schlau und flüsterte:
„Sahib, Du wirst mit Rawaiku zufrieden sein. Ich war bis vor zwei Jahren in Salatola Hilfspolizist und beziehe eine kleine Pension.“ Man merkte, er war sehr stolz auf seine frühere Tätigkeit.
Er verschwand dann. Daß er wirklich als Gehilfe brauchbar war, bewies er dadurch, daß er nicht sofort das winzige Beiboot loskettete, sondern sich erst noch zu den Seinen setzte und zehn Minuten verstreichen ließ, bevor er davonruderte, und zwar zusammen mit seiner Tochter, einem dreizehnjährigen, vollerblühten Mädchen von angenehmen Zügen.
Er blieb eine Stunde aus. Es war bereits dunkel, als er wieder an dem Kutter anlegte und dann in die vordere Kajüte kam, wo wir jetzt bei einem Glase Tee beim Scheine der großen Petroleumdeckenlampe die neuesten Zeitungen lasen, die der aufmerksame Alam Bandur uns durch einen Diener zugeschickt hatte. In Allahabad selbst erscheinen zwei englische Tageszeitungen. Bandur hatte uns jedoch noch die Morgenblätter aus Benares beigefügt.
„Sahib,“ meldete der alte Hindu, „drei der Elefanten gehören dem kleinen Dschihan-Tempel im Norden der Stadt. Einer von ihnen, der weiße, ist Eigentum des Brahmanen Singar Chani; er steht aber in demselben Tempelanbau mit den übrigen. Man nennt ihn auch den Wunderelefanten von Allahabad. – Ich bin jetzt zum sechsten Male hier, Sahib, und jedesmal besuchte ich auch den Wunderelefanten. Er ist so klug wie alle übrigen Elefanten Indiens zusammengenommen. Er versteht jedes Wort seines Herrn. Er schreibt auf eine Tafel den Namen vieler Götter und den seines Herren in englischen Buchstaben. Wenn Du ihn etwas fragst, was Dir wichtig erscheint, antwortet er durch Kopfbewegungen, rät Dir so, ob Du dies oder jenes tun oder unterlassen sollst. Sein Herr verdient viel Geld mit ihm. Singar Chani ist uralt. Er weiß selbst nicht, wie alt. Er kann nicht mehr gehen und läßt sich morgens vor den Tempelanbau tragen, wo er den Tag über sitzen bleibt und unter dem Vordach die Pilger empfängt. Der weiße Elefant steht dann hinter ihm und wartet auf die Fragen der Bekenner Brahmas.“
„Ich danke Dir, Rawaiku. Hier hast Du noch fünf Rupien. Erkundige Dich heimlich noch heute abend, wer der Mahut war, der heute den weißen Elefanten zum Baden führte. Berichte mir morgen früh, was Du hierüber in Erfahrung gebracht hast.“
2. Kapitel.
Wachsfiguren.
Wir waren wieder allein.
„Ich bin jetzt doch schon etwas klüger,“ meinte ich zu Harst. „An dem Mahut des weißen Elefanten muß Dir etwas aufgefallen sein – ohne Frage! Hältst Du ihn etwa für einen Verbündeten Warbattys?“
„Würdest Du Verdacht gegen einen Menschen schöpfen, der als Mahut recht unauffällig durch ein kleines Taschenfernrohr, das er in ein Tuch gehüllt hat, gerade nach unserem Kutter hinüberspäht? – Die Entfernung betrug etwa achtzig Meter. Wenn der Mann an uns nicht ein besonderes Interesse gehabt hätte, wären seine Augen genügend gewesen, zwei auf dem Kajütendach in Liegestühlen sitzende Europäer sich anzusehen. Das Taschenfernrohr war das ausschlaggebende.“
„Allerdings. Ich bewundere nur, wie Dir so schnell derartige Kleinigkeiten auf solche Entfernung auffallen!“
„Übungssache! Ich habe Dir so oft schon gesagt, daß die meisten Menschen blind sind. – Lerne sehen, lieber Schraut! Es ist ja nur eine gewisse Trägheit, wenn man den Blick über die einzelnen Dinge und Gestalten unserer Umgebung hinweggleiten läßt, ohne jede Einzelheit in sich aufzunehmen. Kannst Du mir zum Beispiel sagen, wie viel Stufen die Kajütentreppe hat, ob und wie viel Leichenreste vorüberschwammen, als wir auf Deck die Abendluft genossen, und wieviel Pferdedroschken vor dem Bahnhof bei Ankunft unseres Zuges heute warteten?“
Ich möchte hier einfügen, daß die Hindu ihre Toten bekanntlich verbrennen und die Asche, wenn irgend möglich, in den Ganges streuen. Leider aber nicht immer nur die Asche, sondern oft genug noch halb verkohlte Leichenteile. Nach ihren religiösen Anschauungen dürfen Leichen stets nur auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Erlischt dieser durch irgend einen Zufall zu früh, so werden häufig erst halb verbrannte Tote den heiligen Fluten anvertraut. Die Engländer halten daher auch streng darauf, daß die Gangeskrokodile geschont werden, da diese als Vertilger dieser eklen treibenden Gebeine durchaus notwendig sind. Die Krokodile sind übrigens vollständig harmlos, greifen höchstens mal Kinder beim Baden an. Sie finden eben so reichlich Nahrung, daß sie sich dieserhalb nicht zu bemühen brauchen. –
Ich konnte Harsts Fragen nur durch ein: „Nein – ich habe nicht gezählt“ beantworten.
„Siehst Du, wie wenig Du gesehen hast!“ sagte er recht ernst. „Wenn Du besser auf alles achten würdest, hättest Du auch gemerkt, daß der eine der vierzehn Wagenbesitzer am Bahnhof sich dreimal an uns herandrängte. Schon da wollte ich argwöhnisch werden und diesen braunen Droschkenkutscher für eine Kreatur Warbattys halten. Ich stellte dann aber fest, daß der Mann ebenso zudringlich zu anderen Reisenden war. Der leise Argwohn schwand wieder.“
„Du bist eben Harald Harst!“ schmeichelte ich ihm gutgelaunt.
Er zuckte die Achseln. „Worte – nichts als Worte, die Deine Sehträgheit bemänteln sollen! – Morgen werden wir nun doch wieder in ein Kostüm schlüpfen, lieber Schraut! Ich will mir von dem weißen, weisen Elefanten Bescheid holen, ob wir Warbatty diesmal fangen werden. – Als Europäer dürfen wir uns nicht unter die Pilger mischen. Hier liegt eine absolute Notwendigkeit vor, uns abermals in ärmere Hindu zu verwandeln. Ich habe mir inzwischen auch überlegt, daß es richtiger ist, wenn wir noch in dieser Nacht von hier verschwinden. Wir warten die Rückkehr des alten Inders ab, lassen uns von ihm mit Kleidungsstücken aushelfen und verschwinden in dem Beiboot. Rawaiku muß nötigenfalls unserem liebenswürdigen Gastgeber mitteilen, wir seien auf ein paar Tage ins Innere gereist.“
Er stand auf, zog die Vorhänge vor den kleinen Fenstern ganz dicht zu und entnahm seinem Koffer die nötigen Hautfärbemittel und anderes, was wir zu unserer Veränderung brauchten. Wir färbten Gesicht, Hals, Teile des Nackens, Hände und Arme bis zum Ellenbogen braun. Dies beanspruchte, zumal wir auch auf das Befestigen der Bärte sehr viel Sorgfalt verwandten, über anderthalb Stunden.
Die Uhr in der Kajüte, die wir aufgezogen und gestellt hatten, zeigte genau fünf Minuten nach Mitternacht, als wir hörten, wie das Beiboot außenbords entlangschrammte. Harst öffnete schnell eins der Fenster und rief Rawaiku an.
Als dieser die Kajüte betrat, prallte er erst leicht zurück, erlaubte sich dann aber ein verständnisvolles Lächeln und sagte leise:
„Die weißen Sahibs sind schnell zu Indern geworden. Mein Vorgesetzter in Salatola war ein Engländer, der mir viel erzählte, wie man in Europa Verbrecher fängt. – Ich kann schweigen!“ fügte er mit besonderer Betonung hinzu.
„Das mußt Du auch, Rawaiku,“ meinte Harst. „Es wird Dein Schade nicht sein. – Was hast Du erfahren?“
„Nicht viel, Sahib. Der Mahut stammt aus Goa, ist ein sehr strenggläubiger Hindu, der seit fünf Monaten den weißen Elefanten lenkt, füttert und dauernd um ihn ist. Er heißt Dsangpo. Die Seele seines Vaters wohnt jetzt in dem Wunderelefanten. Deshalb verlangt er auch von dem Brahmanen Singar Chani keinerlei Bezahlung. Er ist sehr angesehen, dieser Dsangpo, und er nimmt keinerlei Geschenke an, wie man mir erzählte. Er könnte leicht reich werden, wenn er einzelne Pilger früher als die anderen in den Tempelhof einließe.“
„Ich danke Dir, Rawaiku. – Der Andrang zu dem Wunderelefanten ist wohl sehr groß?“
„Ja, Sahib. Die Pilger strömen schon mit Tagesanbruch herbei und lagern sich vor dem Hoftore.“
„Kannst Du uns zwei Anzüge besorgen, Rawaiku? – Ich will Dir anvertrauen, daß wir einen sehr gefährlichen Verbrecher verfolgen, der jetzt in Allahabad weilt.“ –
Bereits zehn Minuten drauf verließen zwei Hindu den Motorkutter in dem kleinen Beiboot, ruderten stromaufwärts bis nach den Parkanlagen des Europäerviertels, lenkten hier in einen breiten Kanal ein, der sich bald zu einem künstlichen See verbreiterte, übergaben hier das Boot einem Parkwärter zur Beaufsichtigung und wandten sich nach Norden zu, bis sie auf eine Straße gelangten, die westwärts nach dem Dschihan-Tempel führte.
Die Inder waren Harst und ich. Wir hatten, eingebunden in Tücher, Lebensmittel für einen Tag mit, und wir wollten uns für den Rest der Nacht dicht vor dem Hoftore des Tempels niederlegen, um möglichst mit den ersten Pilgern hineinzugelangen.
Die Nacht war heiß. Harst benutzte diese Wanderung dazu, mir über den Brahmanismus eingehend Aufschluß zu geben, insbesondere über den Seelenwanderungsglauben der Hindu, denen je nach dem Verdienste ihrer irdischen Handlungen eine neue Existenz als Gott, Mensch oder Tier beschieden wird und die erst dann von dieser steten Verwandlung befreit werden, wenn sie eine gottähnliche geistige Reife erlangt haben. – Mithin verehrte der Mahut des Brahmanen Singar Chani in dem weißen Elefanten (als „weiß“ bezeichnet man hellgraue Tiere, die äußerst selten sind) seinen Vater, wodurch seine selbstlose Betreuung des Wundertieres durchaus verständlich wurde, wie Harst betonte.
An uns kamen dauernd kleinere und größere Pilgergruppen vorüber. Sie alle strömten der Stadt zu. An der Straße waren große Zelte und Bretterbuden errichtet, – Notquartiere, in denen die Wallfahrer für billiges Geld ein Unterkommen fanden. Dann standen da auch die Buden der Zuckerbäcker, der Kaffeehändler, der Limonadenverkäufer; andere Inder – und dies ist eins der vielen Vorrechte der Brahmanen – boten Amulette feil; ferner waren die Wegränder geradezu gespickt mit Bettlern, Yogis und Tänzerinnen, die sogar bei Fackelbeleuchtung ihre Künste zeigten. Kurz – von nächtlicher Stille war hier nichts zu merken. Es war das reine Jahrmarkttreiben.
Wir blieben häufig stehen, um Studien zu machen. Harst zeigte mir dies und jenes, was an den Pilgern oder an der Budenstadt interessant war. So kamen wir auch an einem Zelte vorüber, dessen Riesenschild auf englisch und in der Landessprache ein – Wachsfigurenkabinett „allerersten Ranges“ anpries. Neben dem Eingang hingen Tafeln, auf denen die ausgestellten Berühmtheiten vermerkt waren, auf der linken, obenan: König Edward von England, gleich darunter: Jack, der Massenmörder, dann: „der Sultan von Konstantinopel“ – und so weiter.
Plötzlich lachte Harst hell auf, deutete auf die rechte Papptafel.
Und da stand:
Der berühmteste Detektiv der Welt,
der Deutsche Harald Harst!
„Den muß ich mir ansehen!“ meinte der lebende Harst. „Wer weiß, welch armer Sterblicher hier als Harald Harst gezeigt wird!“
Selbst dieses Wachsfigurenkabinett hatte Zuspruch. An der Kasse saß ein sehr würdig ausschauender Hindu. Der Eintritt kostete eine halbe Rupie. Das Zelt war quadratisch mit etwa acht Meter Seitenlänge. Die Beleuchtung bestand aus Petroleumlampen. Ein zweiter Hindu machte den Erklärer. Wir fragten sofort nach dem berühmten Detektiv. Er zeigte auf einen Vorhang.
„Kostet eine halbe Rupie extra,“ dienerte er. „Dort in der besonderen Abteilung befindet sich auch die Königin Viktoria im Sarge.“
Wir bezahlten, schlugen den Vorhang zurück und traten ein.
Hier brannte nur eine einzige Lampe. In der Mitte stand der Sarg mit der Wachsfigur der englischen Herrscherin. Rechts davon waren zwei Männergestalten undeutlich zu erkennen.
Harst nahm seine Taschenlampe zur Hand, schaltete sie ein.
„Ich muß doch genau sehen, wie man –“
Das war das letzte, was ich hörte.
Von hinten hatten sich zwei Hände mit eisernem Druck um meinen Hals gelegt. Ich wurde zu Boden gerissen, verlor das Bewußtsein. Nachher erfuhr ich, daß hinter dem Zelt ein Wagen gewartet hatte, der uns wegschaffte.
Ich erwachte auf einem Strohlager. Allmählich klärten sich meine Gedanken. Ich spürte, daß ich an Händen und Füßen gefesselt war. Im Munde steckte mir ein Knebel. Ich hob den Kopf. Neben mir lag Harst. Er hatte die Augen offen.
Ich stellte weiter fest, daß wir uns in einem vielfach geflickten Spitzzelte befanden. Durch die Risse der Leinwand schien das Tageslicht herein. Von der einen Zeltstange hing an einem Draht eine Petroleumlaterne herab, deren rötlicher Schein auch noch einen dritten, offenbar fest schlafenden Menschen, einen Inder, beleuchtete.
Harst setzte sich leise aufrecht. Das Maisstroh raschelte. Aber der Inder atmete weiter tief und ruhig.
Harst beobachtete ihn. Dann wandte er sich mir zu, machte eine Kopfbewegung. Ich verstand. Sehr vorsichtig richtete ich mich gleichfalls auf.
Und dann senkte Harst den Oberkörper, bis er mit den Zähnen meine Handfesseln erreichen konnte. Er ließ sich Zeit. Ich fühlte, wie er eine Schlinge aufzog, noch eine.
Nun hatte ich die Hände frei, riß mir den Knebel aus dem Munde, japste förmlich nach Luft, hatte aber sehr bald in meiner Tasche mein Messer gefunden.
Da – von draußen ein krächzendes Lachen. Und urplötzlich stand, durch den Zeltvorhang hineinschlüpfend, Warbatty vor uns, – Warbatty, als indischer Wasserträger verkleidet, und doch sofort an dem heiseren Lachen zu erkennen.
In seiner Rechten hielt er einen gespannten Revolver.
Gleichzeitig hatte sich auch der schlafende Inder aufgerichtet, packte mich, fesselte mir im Nu die Hände wieder auf dem Rücken. Ich war viel zu überrascht, um an Gegenwehr zu denken.
„Ich begrüße Sie als liebe, hochverehrte Gäste,“ meinte unser Feind mit teuflischem Hohn. „Sie glauben gar nicht, Herr Harst, welche Mühe es mich gekostet hat, für Sie beide eine Falle zu ersinnen, die den Reiz der Neuheit mit der Gewißheit des Erfolges verband. Ich hoffe, Herr Harst, Sie werden einige Worte der Anerkennung für diese meine Leistung finden und nicht wieder behaupten, Sie hätten das Extrakabinett als Falle erkannt.“
Er nahm Harst den Knebel aus dem Munde.
„Ich bewundere Sie tatsächlich,“ erklärte mein Freund und Meister nun. „Sie haben sich diesmal selbst übertroffen. Wenn ich mir jetzt die Tatsachen nochmals vergegenwärtige, die mich auf diesen Trick hätten aufmerksam machen müssen, schäme ich mich ein wenig meiner Begriffsstutzigkeit. – Nicht wahr, der Mahut sollte mich nur dazu verleiten, nach dem Dschihan-Tempel zu kommen? Er hat absichtlich mit dem Taschenfernrohr operiert, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Daß ich dann sehr wahrscheinlich das Zelt betreten würde, daß der – berühmte Detektiv der Welt als Lockmittel genügen würde, war gleichfalls sehr fein berechnet.“
„Allerdings!“ grinste Warbatty. „Sie mußten dort vorüber. Es führt nur der eine Weg nach dem Tempel und[9] weiterhin ins Innere. Der Besitzer der Schaubude ahnt nicht, weshalb ich ihm das Extrakabinett für zwei Tage abgemietet habe. Der „Erklärer“ war mein Freund Shamana Driga dort –“ Er wies auf den Inder. „Jetzt befinden Sie sich ganz in der Nähe des Tempels in einem Wäldchen, das zu dem Gehöft Drigas gehört. Um Hilfe rufen hat keinen Zweck –“
Warbatty entspannte den Revolver und steckte ihn in seine kurze Leinenhose. Dann durchsuchte er unsere Taschen, nahm uns alles ab, was wir bei uns hatten, und verabschiedete sich mit einem ironisch-höflichen „Auf Wiedersehen, meine Herren“.
[Beide verließen das Zelt und Harst rief grimmig ein „ganz gewiß!“][10] ihnen zu.
„Hm,“ meinte Harst. „Da sitzen wir ja in einem reizenden Käfig fest –“
„Käfig?“
„Ja. Bitte – krieche nur, so gut es geht, bis zum Eingang und stecke den Kopf hinaus –“
3. Kapitel.
Der Tierbändiger Shamana Driga.
Ich tat’s. Ein Blick geradeaus, einer nach links, einer nach rechts genügten.
Unser löcheriges Zelt stand inmitten eines viereckigen Käfigs aus Eisenstäben, der den Mittelpunkt eines ganzen Raubtierhauses aus Käfigen bildete. Ich konnte ja nur einen Teil überschauen. Aber auch das genügte. Ich bemerkte vier Käfige; rechts und links als äußerste des quadratischen Raubtierhauses je eine größere Abteilung; darin je zwei ausgewachsene Tiger. Vor mir einen breiteren und einen schmäleren, langgestreckten Verschlag; darin je ein Tiger. Der schmälere Verschlag war offenbar gleichzeitig der Zugang zu unserem Mittelraum, wie die eingefügten Gittertüren bewiesen. Und wahrscheinlich war der eine Tiger vorhin noch mit der anderen einzelnen Bestie zusammengesperrt und jetzt erst in diesen gangartigen Käfig hineingelassen worden, um uns jeden Fluchtversuch unmöglich zu machen.
Ein letzter Blick nach oben zeigte mir ein mit Zinkblech unten beschlagenes, weit überragendes Holzdach. – Darauf kroch ich wieder auf unser Maisstrohlager zurück. Harst empfing mich mit den Worten:
„Ich habe inzwischen dort durch den Riß die andere Hälfte des großen Käfigs mir angesehen. Auch dort gibt es vier Abteilungen, darin einen Tiger, zwei Panther, zwei Tiger, einen Tiger. – Daß wir uns in dem Dressurkäfig eines Raubtierhauses befanden, sagte mir schon der Geruch, der bei diesem Abenteuer mit das unangenehmste ist. Du kennst meine Abneigung gegen Tierausdünstungen.“
Harald Harsts oft geradezu unnatürliche Kaltblütigkeit hatte ich ja mehr als einmal anzustaunen Gelegenheit gehabt. Heute aber erschien sie mir gegenüber der verzweifelten Lage, in der wir uns befanden, geradezu frivol; ganz besonders hielt ich seine Äußerung über seinen Widerwillen gegen Tiergerüche für ganz unangebracht angesichts des Schicksals, das uns bevorstand.
Ich schwieg daher. Ich bin nicht feige. Mein Mut ist der eines Durchschnittsmenschen, der die Gefahr ein wenig durch das Beispiel eines Harald Harst verachten gelernt hat. Ich schwieg und starrte vor mich hin.
Dann hörte ich draußen eine befehlende Stimme, das zornige Fauchen eines Tigers, das Klirren einer Gittertür und bald einer zweiten.
Der Inder trat gebückt ein, der uns vorher bewacht und den fest[11] Schlafenden gespielt hatte. Er hatte einen prächtigen, langen schwarzen Vollbart, war hager, aber muskulös, und besaß jenen starren, festen Blick, der zum Berufe des Dresseurs notwendig sein soll.
Er setzte sich uns gegenüber und zog den Zeltvorhang auf, so daß das Tageslicht voll hereinfiel.
„Sahib Harst,“ begann er in leidlichem Englisch „ich bin Shamana Driga, der Tierbändiger. Mein Name ist bis Hamburg bekannt. Ich habe für Hagenbeck schon oft Tiger, Panther und Elefanten geliefert. Ich stehe mit den Direktoren aller Tiergärten Indiens in geschäftlicher Verbindung. Ich habe durch den Umgang mit Europäern meinen Blick erweitert. Ich begreife durchaus, daß mein Freund Warbatty, den ich nun ein halbes Jahr kenne und der mir verschiedentlich gefällig gewesen ist, Deinen und Deines Gehilfen Tod wünscht. – Hast Du mal etwas von der Putra Rakisana gehört?“
„Ja, Shamana Driga. Ich weiß, daß, wie Brahmaputra Sohn des Brahma heißt, Putra Rakisana Bruder des Schwertes bedeutet. Die Schwertbrüder sind eine uralte Geheimsekte Indiens, waren einst erbitterte Gegner aller Weißen, sind jetzt aber zu einem Verbrecherbunde herabgesunken. Ich nehme an, daß Du ein Putra Rakisana bist. Sonst hättest Du nicht diese Frage an mich gerichtet.“
„Es ist so, Sahib. Warbatty ist vorgestern in den Bund aufgenommen worden. – Kennst Du den unterirdischen Tempel im alten Fort?“
„Nein. Ich bin zum ersten Male in Allahabad.“
„Die Tempelräume dort sind in die Felsen eingehauen. Die Brahmanen, die den Tempel bewachen[12], haben das Geheimnis verloren, wie man in die untersten Räume gelangt, in der noch vor fünfzig Jahren trotz aller Verbote der Engländer der blutigen Kali heimlich Menschenopfer dargebracht wurden. Übermorgen ist dort ein Fest. Zahlreiche Thugs befinden sich unter den Pilgern. Da sollt Ihr beide der Kali zu Ehren geopfert werden.“
Er schaute Harst forschend an. Er hoffte wohl, der weiße Sahib würde vor Schreck erbleichen.
Aber – Harst lächelte.
Und das brachte den Hindu in Verwirrung. Etwas ärgerlich rief er nun halblaut:
„Die Thugs sind eine Geheimsekte wie die Schwertbrüder, Sahib! Du scheinst das nicht zu wissen. Sie haben gelobt, die blutige Göttin Kali durch Erdrosselung von Menschen zu ehren. Die Engländer verfolgen die Thugs mit allen Mitteln. Und doch verschwinden noch heute zahlreiche Menschen, ohne daß man den Mördern auf die Spur kommt.“
Harst nickte. „Mir ist das alles sehr wohl bekannt, Shamana Driga. Die Engländer hängen jeden Thug auf. Auch Du bist ein Thug. Du tust mir leid –“
Der Inder wurde abermals verwirrt.
„Ich tue Dir leid?“ meinte er unsicher. „Was willst Du damit –“
„Ich will damit sagen, daß Du sehr bald öffentlich gehängt werden wirst. Weiter nichts.“
Shamana Driga kannte Harald Harst nicht. Wie sollte er ahnen, daß es Harst wie kein anderer verstand, menschliche Schwächen schnell zu ergründen und auszunutzen?!
„Woher – weißt Du das?“ fragte der Bändiger stockend.
„Ich weiß es. Das genügt. Willst Du dem Schicksal entgehen, daß Dein Leib drei Tage am Galgen den Geiern zum Fraße angeboten wird und daß nur noch Deine Gebeine von den heiligen Flammen des Scheiterhaufens geläutert werden, so rate ich Dir, Warbatty nichts davon zu sagen, daß Dir der Tod so nahe ist. Sonst entflieht Warbatty rechtzeitig, der bisher ja stets seine Verbündeten im Stiche gelassen und seine eigene Haut in Sicherheit gebracht hat.“
Der Hindu hatte seine Gesichtszüge schlecht in der Gewalt. Etwas wie ungewisse Angst malte sich auf seinem braunen Antlitz. Er versuchte es mit einem höhnischen Lächeln. Aber dieses mißlang genau so, wie der Ton seiner folgenden Worte zu deren Sinn in Widerspruch stand.
„Du willst mich ängstigen! Ich verlache Dich! Du wirst sterben! Und ich werde leben –“
„Umgekehrt, Shamana Driga, – umgekehrt! – Doch – was wolltest Du eigentlich von uns?! Uns nur die lächerliche Ankündigung unseres Opfertodes überbringen?“
„Nein –“ Der Inder war zerstreut. „Nein, Sahib Harst. – Warbatty läßt Dir folgendes ausrichten: Er wird hier in Allahabad eine Beute sich aneignen, wie sie ihm noch nie zu erlangen vergönnt war. Er kennt Dich als klug und listenreich. Er würde Dir beweisen, daß Du diesmal, wenn Du frei wärest, ihm nicht schaden könntest. Du würdest das, was er plant, nicht verhindern können. – Willst Du ihm Dein Wort geben, nach zwei Tagen genau um diese Stunde Dich wieder hier einzufinden, ohne jemandem zu verraten, daß Du Dich in die Gefangenschaft zurückbegeben mußt, – dann will er Dich freilassen. – Er sagt, Ihr Deutschen haltet Euer Ehrenwort ganz bestimmt. Er muß großes Vertrauen zu Dir haben.“
„Mit Recht. Ich würde mein Wort nicht brechen, selbst wenn ich dem sicheren Tode entgegenliefe. – Ich werde mir Warbattys Angebot überlegen. Warte eine Weile.“
Harst starrte durch den Zelteingang ins Freie hinaus.
Durch die Gitterstäbe sah auch ich ein Palmenwäldchen; zwischen den Stämmen zog sich eine sehr hohe Mauer aus Lehmziegeln hin. Rechter Hand erblickte ich noch die eine Ecke eines größeren Gebäudes sowie einen vierräderigen plumpen Wagen mit großem, geschlossenem Holzkasten und drei weidende Zugochsen, die an die Nähe der Raubtiere offenbar vollständig gewöhnt waren.
Minuten verstrichen. Dann sagte Harst:
„Ich nehme den Vorschlag unter folgenden Bedingungen an: Auch mein Freund Schraut muß auf sein Ehrenwort hin freigelassen werden; es muß mir während der zwei Tage freistehen, gegen Warbatty vorzugehen, wie es mir geeignet erscheint; nur die Kenntnis Eurer – Deiner und seiner Zusammengehörigkeit will ich in nichts ausnutzen; falls ich Warbatty finde und seinen Plan vereitle oder ihm die Beute wieder abjage – alles in diesen zwei Tagen, bin ich der Verpflichtung, hierher zurückzukehren, überhoben.“
Der Inder nickte zustimmend. „Warbatty war auf diese Bedingungen vorbereitet, Sahib. Sie sind gewährt. Nur muß ich noch bemerken, daß auch er seinerseits alles tun kann, um Dich unschädlich zu machen.“
„Selbstverständlich.“
„Weiter müßt Ihr auch ohne Waffen Euch hier wieder einfinden.“
„Ebenso selbstverständlich. – Nur müssen wir jetzt sofort all das zurückerhalten, was Ihr uns weggenommen habt. – Ich gebe Dir also mein Wort, genau so zu handeln, wie vereinbart. – Schraut, tu’ dasselbe.“
Ich gehorchte widerwillig. Diese ganzen Abmachungen kamen mir wie ein freventliches Katz- und Maus-Spiel vor, bei dem wir jedoch die Mäuse waren.
Shamana Driga löste unsere Fesseln. Dann führte er uns durch den schmalen Käfig ins Freie, hieß uns warten, betrat das Haus und kam mit unserem sämtlichen Tascheninhalt wieder, händigte uns die Sachen aus und führte uns an das Holztor der Lehmmauer, öffnete eine kleine Pforte daneben und sagte zum Abschied sehr kleinlaut und offenbar von einer unbestimmten Angst beseelt:
„Sahib Harst, wenn Du nun Glück haben solltest und Warbatty wirklich finden solltest, dann darfst Du mich trotzdem nicht verraten. Dies ist in Dein Versprechen miteinbegriffen.“
„So?! Davon ist vorhin nichts erwähnt worden,“ meinte Harst ernst und mit Nachdruck. „Wenn ich Warbatty beseitige, das heißt, ihn durch seine Festnahme unschädlich mache, sind auch seine Mitwisser verloren!“
Er hatte plötzlich den Revolver in der Hand, fügte drohend hinzu:
„Laß Deinen Dolch stecken, Shamana Driga! – Du verdienst es, gehängt zu werden. Du fütterst Deine Tiger und Panther mit menschlichen Leichen. Ich habe nicht weniger als drei zerbissene Schädel in den Käfigen bemerkt. Hüte Dich vor mir! Deine Stunde hat geschlagen.“
Harst schritt von dannen. Und hinter uns drein die Stimme des Hindu:
„Sahib – Sahib, – ich will Dir helfen –“
Doch Harst begann plötzlich zu traben, rief mir zu: „Es ist besser, wir suchen schleunigst bewohntere Gegenden auf, lieber Schraut. Der Kerl bekommt es fertig und schickt uns einen seiner Tiger nach –“
4. Kapitel.
Der weise, weiße Elefant.
Wir erreichten sehr bald die Straße. Nachdem wir dann noch ein Wäldchen durchquert hatten und nun bereits mitten in dem der Stadt zuflutenden Pilgerstrome uns befanden, gingen wir gemächlich weiter. Links von uns lag auf einer bewaldeten Anhöhe der Dschihan-Tempel, einer jener uralten Bauten, an denen Indien so überreich ist, daß man an ihnen sehr bald achtlos vorbeisieht, wenn sie nicht gerade durch etwas ins Auge Fallendes sich irgendwie auszeichnen.
Das Dschihan-Heiligtum konnte jedoch nichts Merkwürdiges aufweisen als lediglich sein Alter. Schon der Steinmauer sah man es von weitem an, daß sie Jahrhunderte überdauert hatte. Was an Gebäuden über ihre vier Meter Höhe hinwegragte, war plump und massig; schwerfällige Säulen bildeten vor dem Tempel eine Art Vorhalle. Das Dach war mit Steinplatten gedeckt, die im Laufe der Jahre eine immer dickere Moosschicht erhalten hatten. Nur stellenweise war das Moos weggekratzt. Dort blinkten viereckige Fensterluken. Die Anbauten rechts und links hatten flache Dächer und Verzierungen in Gestalt von Tierfiguren. –
Harst zog mich jetzt in das dichteste Gewühl hinein, das nach dem Tempel hindrängte und hier auf der Straße als zweiter Menschenstrom, der dem anderen nach der Stadt zuhastenden entgegenkam, sich hinschob.
„Folge mir dicht auf dem Fuße,“ raunte er mir zu. „Ganz dicht! Mach’ Dich klein, nimm eine andere Haltung an; markiere einen Verwachsenen –“
Auch er wurde plötzlich fast zum Zwerge. So gelangten wir, Püffe austeilend und erhaltend, bis an die Bude eines Kaffeehändlers, die von Pilgern dicht umlagert war.
Wir schoben uns dicht bis an die Hinterseite des Zeltes vor, wo die beiden Gehilfen des Händlers auf einem Herde von Lehmziegeln unter einem Bretterdach in zwei Kesseln den wirklich verlockend duftenden braunen Trank herstellten. – Hier war es menschenleer.
Ein Fünfrupienschein sicherte uns die Gunst der beiden Hindu. Sie wiesen uns in das Zelt, wo in der hinteren Abteilung ein paar Tische und Bänke standen. Für weitere fünf Rupien erhielten wir Kaffee, flache, noch warme Brote und kaltes gebratenes Hammelfleisch. Während wir aßen und tranken, beobachtete Harst unausgesetzt durch den halb zurückgeschlagenen Vorhang die beiden Hindu bei ihrer Arbeit, schwieg aber im übrigen beharrlich. So verging eine halbe Stunde.
„Ich bin jetzt überzeugt,“ sagte er dann plötzlich, „daß Warbatty oder seine Helfershelfer, die uns natürlich vor des Tierbändigers Gehöft aufgelauert haben, um sich an unsere Fersen zu heften, uns verloren haben. In der ganzen Zeit, wo wir hier sitzen, habe ich nichts Verdächtiges bemerkt. Trotzdem werden wir vorsichtig sein –“ Er erhob sich und untersuchte die Zeltwände auf Risse und Löcher, durch die jemand von außen hätte hineinspähen können.
Dann rief er den einen der Kaffeeköche herein, gab ihm einen Zehnrupienschein und bat den noch jungen Menschen, uns aus der Stadt zwei Frauengewänder und Gesichtstücher zu holen.
Der Inder machte große Augen.
„Wir sind von der Polizei,“ flüsterte Harst. „Wenn Du über diesen Auftrag nicht schweigst, wirst Du den Schaden davon haben. Ersinne eine Ausrede Deinem Herrn gegenüber. Wir werden Dich dort drüben in jenen Büschen erwarten.“
Der Hindu gehorchte bereitwilligst. – Als er uns dann das Paket brachte, bezahlte Harst den Preis – 30 Rupien – – und legte noch weitere fünf hinzu.
Die Büsche standen so dicht, daß wir ganz unbeobachtet die weiten, mantelartigen Kleider anlegen konnten.
In Indien tragen nur die mohammedanischen Weiber Gesichtstücher. Von den Hindufrauen tun es nur die reicheren und auch nur die aus ganz bestimmten Gegenden. Unter den Pilgern sah man sehr selten ein verschleiertes Weib. Trotzdem konnten wir mit unseren Gesichtstüchern, in die für die Augen Löcher geschnitten waren und die sich nach oben zu einer haubenartigen Mütze auftürmten, kaum irgendwie auffallen. Jedenfalls war diese Art Maske die beste, die Harst ersinnen konnte.
Er gab mir dann genaue Verhaltungsmaßregeln. Wir trennten uns. Ich blieb stets ein Stück hinter ihm. Weshalb er jetzt den Dschihan-Tempel besuchen wollte wo die größte Tageshitze nahte, war mir unklar. Ich konnte mir nicht recht vorstellen, weshalb er gerade dort Warbatty zu finden hoffte. Mehr hatte er mir nämlich nicht gesagt als nur: „Wenn wir Glück haben erwischen wir Freund Cecil heute noch –“
Gewiß – Warbatty steckte ja mit dem frommen Mahut Dsangpo des weißen Wunderelefanten unter einer Decke. Aber – er hatte ihn doch nur dazu benutzt gehabt, uns nach dem Tempel zu locken. Sollte etwa Harst vermuten, daß Warbatty gegen den Tempel irgend einen Anschlag plane?! – Ich mußte dies den Umständen nach fast annehmen. –
Es war jetzt etwa zehn Uhr vormittag. Die Sonne brannte bereits mit echt indischer Freigebigkeit auf die Menschenmassen herab, die sich dem kleinen Heiligtume zuschoben.
In Berlin hatte ich oft genug auf der Straße im Gedränge gestanden, um dies oder jenes Schauspiel zu genießen, hatte dabei den sogenannten „Menschengeruch“ in allen Variationen genossen.
Was ich damals auf dem Wege zum Dschihan-Tempel in dieser Beziehung zu ertragen hatte, war des Guten denn doch zu viel. Außer den Düften der braunen Leiber aber folterte mich auch noch das Frauengewand. Ich schwitzte nicht, nein, ich löste mich förmlich in Schweiß auf. – Schweißperlen liefen mir in die Augen. Ich konnte kaum sehen, was um mich her geschah.
Freilich – einen Vorteil hatte die Verkleidung gerade in diesem Gewoge doch: man nahm Rücksicht auf mich! Man gab mir keine Rippenstöße; man duldete, daß ich mich vordrängte, – wie Harst es auch tat.
Ich habe damals während der zehn Minuten, bis wir den Tempelhof erreichten, so und so oft gefürchtet, den Sonnenstich zu bekommen. Und ich war überglücklich, als Harst nun das Tor passierte, als auch ich dann zwei Schritt links von ihm mich in den Schatten der hohen Mauer niederkniete und mich bald ganz lang wie in größter Andacht ausstreckte.
Welche Wohltat! Der Hof war mit Steinfliesen ausgelegt. Und – wie kühl waren sie!
Vor uns lagen etwa zweihundert Pilger auf den Knien, rutschten allmählich weiter nach vorn mit wahrer Engelsgeduld, bis auch sie die drei Stufen erreicht hatten, die zu der Estrade vor dem linken Tempelanbau emporführten.
Und auf dieser Estrade stand der weiße Elefant, den mächtigen Kopf der Menge zugekehrt. Fast zwischen seinen Vorderbeinen auf einer Art Sessel saß der weißbärtige, offenbar schon sehr gebrechliche Besitzer des Wundertieres in einem sauberen, hellgrauen Mantel. Sein runzliges Gesicht war von so hellem Braun, wie man dies bei vielen Brahmanen findet, die als vornehmste Kaste tatsächlich auch äußerlich von den übrigen Hindu sich unterscheiden. (Heiraten zwischen Angehörigen verschiedener Kasten sind verboten.)
Halb hinter einer Säule wieder, das Gesicht dem Elefanten zugekehrt, hockte der fromme Mahut, auf den Harst mich durch ein vorsichtig geflüstertes „Dsangpo!“ aufmerksam machte.
Die ganze Szenerie ringsum war eigenartig, phantastisch, – eben echt indisch! Ich könnte darüber viel schreiben, muß mich aber mit kurzen Andeutungen über das Wichtigste begnügen.
Der Elefant hatte prachtvolle Stoßzähne. Sie waren mit schweren, goldenen Ringen verziert, in denen Brillanten glänzten. Um den Hals trug das riesige Tier einen Goldreif mit beweglichen Gliedern, von dem bis auf die Rüsselwurzel hinab eine breite, schildartige Goldplatte herabhing, in der das Bild Brahmas, der Weltseele, in Edelsteinen mosaikartig schillerte.
Die Stufen der Treppe zu der überdachten Estrade waren von großen Tongefäßen flankiert, in die jeder der Pilger, sobald der Wunderelefant die im Flüsterton an ihn gerichtete Frage beantwortet hatte, ein Geschenk hineinwarf. –
Harst hatte jetzt offenbar nur für die Pilger Interesse. Ich ahnte: er suchte Warbatty!
Nach gut einer Stunde mußten wir dann, wenn wir nicht durch unser Ausharren an derselben Stelle auffallen wollten, uns gleichfalls denen anschließen, die langsam den Stufen näherrutschten.
Harst raunte mir zu: „Um zwölf Uhr etwa macht der Wunderelefant Mittagspause bis drei Uhr. Wir können uns dann heimlich drücken, denn bis wir an die Reihe kommen, würden noch anderthalb Stunden vergehen –“
Die Rutschpartie begann; leider wieder in praller Sonne und umweht von keineswegs lieblichen Düften.
Um mir die Zeit zu vertreiben, spähte auch ich unauffällig nach Warbatty aus. Im Schatten des Vordaches rechts und links von dem Wundertiere, aber in respektvoller Entfernung, hatten sich Pilger niedergehockt und verzehrten mitgebrachte Eßwaren. Jeder dieser braunen Gläubigen konnte Warbatty sein – jeder! Denn einem so glänzenden Verkleidungskünstler wie unserem Cecil gelang jede Maske. Das Suchen war mithin recht zwecklos. Nur Warbattys linke Hand war verräterisch – diese Hand mit dem fehlenden Zeigefinger. Ich achtete deshalb auch lediglich auf die Hände der dort Sitzenden.
Zwischenein schaute ich auch wieder zu, wie der weiße Elefant den mächtigen Kopf schüttelte oder bejahend nickte. Zuweilen hob er auch den Rüssel und stieß einen kreischenden Laut aus. Das sollte dann wohl heißen: „Die Frage ist ungehörig, o Bekenner Brahmas!“
Ich will noch erwähnen, daß ich bereits auf den Gedanken gekommen war, der Mahut Dsangpo würde sehr wahrscheinlich den Elefanten durch heimliche Zeichen zu den Antworten Ja oder Nein oder zu dem ablehnenden Trompetenton veranlassen. Daß dieses Elefantenorakel ein plumper Schwindel war, stand ja außer Zweifel.
Abermals verging so eine halbe Stunde.
Da gab es plötzlich eine ganz unvorhergesehene Unterbrechung. Der Brahmane Singar Chani schwankte ein paarmal hin und her und sank dann offenbar bewußtlos vornüber.
Der Mahut sprang zu, hob ihn auf. Einige Brahmanen, von Pilgern herbeigerufen, kamen aus dem Haupttempel angelaufen und trugen den Greis durch die breite Tür, vor der der Wunderelefant stand, ins Innere des Anbaues.
Auch der weißgraue Koloß ward gleich darauf von Dsangpo durch dieselbe Tür in seinen Stall geführt.
Die Pilger warteten geduldig. Nach zehn Minuten erschien Dsangpo wieder und rief der Menge zu, Singar Chani sei plötzlich verstorben; sie sollten daher morgen früh sich wiedereinfinden.
In die Hunderte kam Leben. Sie standen auf, drängten dem Tore zu. Auch wir schlossen uns an. Aber wieder einzeln, ohne unsere Zusammengehörigkeit zu verraten.
5. Kapitel.
Der indische Tierarzt.
Harst schlug den Weg nach der Stadt ein. Ich merkte, daß er dann im Eingeborenenviertel gerade die engsten Gäßchen durchquerte, wo wenig Verkehr war und wo er sich unschwer davon überzeugen konnte, ob jemand uns folgte.
Dann betrat er eine Kaffeestube. Sie war überfüllt. Niemand achtete auf uns. – Es gab hier auch warme Gerichte. Wir aßen jetzt zusammen in einer Ecke und hatten ein Tischchen für uns. Zu uns Frauen setzte sich niemand.
Wir bestellten nur zum Schein etwas. Nach zehn Minuten gingen wir durch den Hinterausgang, der auf den Platz der Großen Moschee führte, hinaus.
Harst fühlte sich nunmehr ganz sicher.
„Mein Alter,“ sagte er in bester Laune, „wir haben Warbatty bereits halb hineingelegt. Warten wir nun ab, was weiter geschieht, oder mischen wir uns sofort ein? – Eine schwierige Frage –“
Wir gingen langsam über den Platz. Die Große Moschee ist das hervorragendste Bauwerk Allahabads. Ich war so in den Anblick des prächtigen Tempels versunken, daß ich kaum auf Harsts Worte geachtet hatte.
Als er nun aber hinzufügte: „Warbatty stand nämlich vor dem Hoftore des Dschihan-Heiligtumes, mein Lieber!“ da vergaß ich sehr schnell die Moschee. – „Ja – er stand dort allein vor der Bude eines Amuletthändlers als reicher Brahmane in sehr kostbarem Anzuge; als einarmiger Brahmane! Natürlich fehlte ihm anscheinend der linke Arm. – Er handelte um ein Amulett. Aber seine Augen waren lediglich auf den dem Tore entquellenden Menschenstrom gerichtet. – Was nun?! Kehren wir nach dem Dschihan-Tempel zurück und lassen wir Warbatty durch die Polizei festnehmen? – Ich weiß nicht recht, was ich tun soll. Halb bin ich mir über seine Absichten hier noch im unklaren –“
„Nur halb?“ – Ich war ehrlich erstaunt.
„Ja, nur halb, mein lieber Schraut. – Darf ich Dein Detektivtalent durch einige Bemerkungen unterstützen? Darf ich Dich darauf hinweisen, daß unser Kuttermitbewohner Rawaiku berichtete, der Mahut Dsangpo sei vor etwa 5 Monaten in die Dienste des Brahmanen Singar Chani getreten. Vor fünf Monaten! Und um die Zeit ist Warbatty, wie wir bestimmt wissen, in Indien gewesen. Wir wissen es nicht nur durch die Einzelheiten unseres Abenteuers in Nagpur, sondern auch durch den Tierbändiger Shamana Driga, der uns heute sagte, Warbatty sei seit sechs Monaten sein Freund, – das heißt doch, sie haben sich vor einem halben Jahre kennen gelernt. Und um dieselbe Zeit tritt Dsangpo seine Mahut-Stellung ohne Bezahlung zu verlangen bei dem Besitzer des Wunderelefanten an, dessen Stirnschild auf vier Millionen Rupien geschätzt wird. Die 12 größten Edelsteine sollen nach einem Aufsatz in der Benares-Post, den ich gestern abend in der Kutterkajüte las, rund 2½ Millionen wert sein. Wie nun, wenn Warbatty und der Mahut Dsangpo das nette Plänchen ausgeklügelt haben, den Stirnschild zu rauben?! – Ich halte dies für sehr wahrscheinlich. Dsangpo hat sich ohne Entlohnung zu fordern, dem greisen Brahmanen angeboten, hat das rührende Märchen erfunden, gerade in dem weißen Elefanten wohne die Seele seines Vaters, hat ferner durch fünf Monatelang treue Dienste sich das vollste Vertrauen Singar Chanis und der anderen Brahmanen des Dschihan-Tempels erworben, hat auf Warbattys Anraten geduldig gewartet, bis dieser aus Europa wieder zurückkehrte, und – ein Zufall?! – gerade heute wird sich vielleicht für die Verbrecher eine Gelegenheit ergeben, den Schild zu stehlen, der ja fraglos stets so tadellos bewacht und verwahrt wird, daß an ihn unter gewöhnlichen Umständen nicht heranzukommen ist. – Na, mein Lieber, wie denkst Du über alles dies; bist Du einverstanden, daß wir dort drüben das Gebäude der Polizeidirektion betreten und dem hiesigen Detektivinspektor uns vorstellen?! – Natürlich muß der Tierbändiger wegfallen. Mein Wort halte ich. Erst wenn wir Warbatty fest haben, kommt auch Shamana Driga heran.“ –
Der Detektivinspektor Master Hamilton fiel aus allen Wolken, als Harst sich ihm vorstellte. Man konnte es ihm nicht verargen. Zwei verschleierte Frauen und zwei deutsche Liebhaberkollegen – da hätte wohl jeder gestaunt!
Hamilton hatte jetzt alle Hände voll zu tun. Die Million Pilger zog stets auch einige tausend dunkle Existenzen nach Allahabad. Die Polizei war daher durch Beamte aus den Nachbarstädten verstärkt worden.
Der Inspektor sagte uns bereitwilligst seine Hilfe zu, rief drei seiner zuverlässigsten Leute herbei, mit denen Harst dann genau unser gemeinschaftliches Vorgehen gegen Warbatty besprach.
Während wir noch so zu sechsen in Hamiltons Dienstzimmer saßen, rasselte plötzlich das Telephon. Der Inspektor meldete sich, lauschte, nickte Harst vielsagend zu, legte den Hörer weg und rief:
„Master Harst – Sie haben richtig vermutet! Der Schild des Wunderelefanten ist zwar nicht als Ganzes gestohlen, aber – die größten Steine – 28 an der Zahl – sind herausgebrochen und verschwunden. – Dies meldete soeben die Polizeiwache Nord. Die Brahmanen des Tempels bitten um schleunigste Untersuchung des Falles. – Kommen Sie mit? – Ich muß sofort hin –“
Harst überlegte. „Nein. Wir werden hierbleiben. Es genügt, wenn Sie mir nachher genau den Sachverhalt schildern.“ –
Drei Stunden später war Hamilton wieder bei uns. Wir hatten inzwischen in sein Dienstzimmer eingeschlossen gesessen, seine Zigaretten geraucht und im ganzen wenig gesprochen.
Der Inspektor war sehr aufgeregt, rief Harst sofort zu:
„Denken Sie – auch der Wunderelefant ist vor einer halben Stunde krepiert – ganz plötzlich. Die Brahmanen behaupten natürlich, aus Gram über den Tod seines Herrn! Ein solcher Blödsinn! Das Vieh ist einfach überfüttert worden. Es war ja für seine Gefräßigkeit bekannt. Und gerade an Herzverfettung sterben viele der sogenannten heiligen Elefanten.“
„Erzählen Sie bitte von dem Diebstahl,“ meinte Harst, dem der Tod des Wundertieres sehr gleichgültig schien.
„Oh – da gibt’s nicht viel zu sagen. – Der Goldschild wurde von Singar Chani stets in einer altertümlichen Eisentruhe im Schlafraume der Brahmanen aufbewahrt. Die Truhe enthält auch die sonstigen Kleinodien des Tempels und wird dauernd mindestens von einem Brahmanen bewacht. Nach dem Verscheiden Singar Chanis heute vormittag kümmerten die Brahmanen sich zunächst nicht weiter um den Elefanten, den der Mahut Dsangpo in den Stall geführt hatte. Dieser Stall hat nur einen Zugang von dem Tempelanbau aus und nur ein sehr stark vergittertes Fenster. Ein Fremder kann unmöglich hineingelangen. – Als die erste Aufregung über Singar Chanis Tod sich gelegt hatte und als der Oberpriester nun den Goldschild und den anderen Schmuck des Elefanten in die Truhe hineintun wollte, bemerkte er, daß die 28 Steine aus dem Schilde fehlten. Da die Tempeltüren verschlossen gehalten waren, hatte ein Unberufener nicht eindringen können; er wäre auch unfehlbar gesehen worden. Unwillkürlich lenkte sich der Verdacht auf den bei allen beliebten Mahut als den einzigen, der nicht zur Priesterkaste gehörte. Dsangpo fühlte diesen Verdacht und verlangte dann selbst, daß die Polizei gerufen wurde. – Ich habe ihn verhört. Er konnte beweisen, daß er den Seitenanbau inzwischen nicht verlassen hatte, also auch niemandem draußen die Steine zugesteckt haben könnte. Außerdem hatte sich innerhalb der Tempelmauern auch kein Fremder befunden. – Kurz – wenn Dsangpo der Dieb ist, muß er die Juwelen irgendwo im Innern versteckt haben. Wir suchten anderthalb Stunden, Master Harst. Ich gehe jetzt jede Wette ein: in dem Seitenanbau ist der Raub nicht verborgen worden. Wir verstehen zu suchen. – Meine Leute sind noch draußen. Aber sie werden nichts finden.“
Harst nickte. „Das glaube ich auch. – Vielleicht habe ich später mehr Glück.“
„Hm – ich zweifele daran, Master Harst. Entschuldigen Sie schon – aber wo Percy Hamilton gesucht hat, da –“ Er machte eine bezeichnende Handbewegung.
„Was geschieht nun mit dem Elefanten?“ meinte Harst.
„Der wird morgen früh im Tempelhofe feierlich begraben. Ich habe dies aus sanitären Gründen verlangt. Die Brahmanen wollen noch heute eine Grube ausheben.“
„So so. – Und die Stoßzähne? Wird man die nicht absägen?“
Hamilton lächelte. „Abschrauben wird man sie. Sie sind nämlich unecht – nur auf den Stümpfen der echten befestigt. Dies wird hier oft getan. So mancher Lieblingselefant eines Maharadscha trägt falsche Stoßzähne –“
„Und die Haut? – Die ist doch auch wertvoll –“
„Da kennen Sie die frommen Hindu schlecht! Ein so heiliges Tier abhäuten! Niemals würden die Brahmanen das dulden. Sie haben schon dem Tierarzte zunächst Schwierigkeiten gemacht, der gern die Todesursache des Wunderviehs feststellen wollte –“
„Tierarzt?“
„Gewiß, Master Harst. Auch die gibt es hier in Indien.“
„Ist dieser Tierarzt Ihnen näher bekannt?“
„Nein. Er ist als Pilger hergekommen. Der Mahut Dsangpo kennt ihn und hat ihn gestern getroffen. Es ist ein Eingeborener aus Gwalior namens Jang Aud[13]. Abends wird er den Elefanten sezieren und die Organe untersuchen. Der Mahut behauptet, der Elefant sei vergiftet worden. Das hat er aber nur mir anvertraut. Er meint, einer der Brahmanen habe[14] es getan, der ihm feindlich gesinnt sei und ihn mit dem Vorwurf habe belasten wollen, den Elefanten unzweckmäßig gefüttert zu haben.“
„Sehr schlau! – Wir werden dieser Sektion nicht gerade beiwohnen, Master Hamilton, aber uns den Tierarzt Jang Aud nach der Sektion genauer ansehen. Lassen Sie jedenfalls abends den Tempel umstellen. Ich habe sehr triftige Gründe hierfür.“
Weiter äußerte sich Harst hierzu nicht. –
Wir verbrachten die Stunden bis gegen sechs Uhr in Hamiltons reizendem Bungalow im Europäerviertel. Er hatte uns im geschlossenen Auto dorthin geführt, und wir verlebten dort einen angenehmen Nachmittag in Gesellschaft seiner jungen, liebenswürdigen Gattin, einer Deutschamerikanerin, die offenbar aus sehr reichem Hause stammte. Die zahlreiche Dienerschaft war durchaus zuverlässig, so daß wir Verrat nicht zu fürchten brauchten. Erst gegen ¾6 legten wir unsere Frauengewänder wieder an, und dasselbe Auto schaffte uns nach einem entlegenen Wege nordöstlich des Dschihan-Tempels. Wir stiegen aus und wanderten zusammen bis zur Nordecke der Tempelmauer. Hier, wo der Gemüsegarten der Tempelbrahmanen und außerhalb der Mauer ein Gehölz lag, erkletterte Harst einen Baum. Er konnte so bis auf den Platz vor dem linken Seitenanbau entlangschauen. Er rief mir leise zu, daß der tote Elefant gerade durch die übrigen Elefanten durch Taue in den Hof gezogen würde.
„Außer dem Mahut ist noch ein Hindu da, der wohl der Tierarzt sein dürfte,“ sagte er, als er wieder zu ebener Erde vor mir stand.
In demselben Augenblick tauchte Hamilton auf. Auch er war in Eingeborenentracht, um nicht aufzufallen.
Erst jetzt erklärte Harst ganz unvermittelt:
„Wir werden Warbatty diesmal fangen, wenn wir nicht ganz besonderes Pech haben. Er selbst ist der angebliche Tierarzt.“
Ein Beamter Hamiltons kam herbeigelaufen.
„Sie schneiden den Elefanten schon den Leib auf,“ berichtete er.
„Dann lassen Sie bitte Ihre Leute von allen Seiten in den Hof eindringen,“ meinte Harst zu dem Inspektor. „Der Mahut und der Tierarzt müssen sofort gepackt werden –“
Der Beamte eilte davon. Fünf Minuten drauf, als wir bereits vor dem Tore der Mauer standen, erscholl von drinnen ein schriller Pfiff.
Harst warf schnell die Frauengewänder ab. Das Tor wurde geöffnet. Harst jedoch regte sich nicht. Hamilton und ich schauten ihn verwundert an, denn er starrte mit fest zusammengepreßten Lippen einer Rikscha nach, die nach der Stadt zu verschwand.
„Ich bin meiner Sache zu sicher gewesen,“ sagte er leise. „Ich fürchte, er wird uns wieder entwischt sein –“
Dann ging er langsam in den Tempelhof hinein und auf den Elefanten zu. Mit verstörten Gesichtern und scheuen Augen blickten die beiden Gefangenen uns entgegen.
Harst trat auf den Tierarzt, einen schmächtigen, älteren, gutgekleideten Hindu zu. Aber der Mann hatte an seiner Linken seine fünf Finger.
„Warbatty ist vorsichtiger gewesen, als ich glaubte, Master Hamilton,“ sagte Harst darauf zu dem Detektivinspektor. „Er hat einen anderen beauftragt, damit er fliehen könnte, falls die Sache noch im letzten Moment schief ging. Und er ist geflohen. Die Rikscha entführte ihn. Er sah uns drei vor dem Tore erscheinen. Da wußte er Bescheid. – Ich hatte bestimmt erwartet, er würde hier den Tierarzt spielen.“
Hamilton und auch ich machten ziemlich verständnislose Gesichter. Harst hatte ja wieder nach alter Gewohnheit die Lösung dieses Diebstahlproblems für die Schlußszene sich aufgespart.
Er wandte sich jetzt wieder an den Tierarzt Jang Aud. „Sie geben das Spiel nunmehr wohl verloren,“ meinte er nicht gerade unfreundlich. „Ich kann mir denken, daß Sie lediglich der Verführte sind. Warbatty gewinnt leicht Einfluß auf Menschen. – Beenden Sie die Sektion! Sie ahnen wohl schon, daß ich diesen in seiner Art meisterhaft ausgeklügelten Schwindel durchschaut habe –“
Der Hindu war verständig genug, sich zu fügen.
Der Inspektor, die Beamten, ein paar Tempelpriester und ich standen in fieberhafter Spannung da.
Der schmächtige Tierarzt hatte die Ärmel hoch aufgekrempelt und holte nun mit einem eisernen Haken die Gedärme hervor, dann den Magen. Jetzt schnitt er diesen auf, wühlte in dem eklen Inhalt umher, legte dann einen mit Blutgerinnsel überzogenen Stein auf die Fliesen des Bodens, – noch einen – noch einen, wühlte weiter, bis er – alle 28 gestohlenen Diamanten beisammen hatte.
„Verdammt schlaue Schurken!“ rief Hamilton kopfschüttelnd. „Wer hätte wohl an diese Aufklärung gedacht!“
„Den Trick zu durchschauen, war für mich nicht allzu schwer,“ meinte Harst. „Die Freundschaft Warbattys mit dem Mahut deutete zur Genüge darauf hin, daß Warbatty es auf einen Teil der Kostbarkeiten des Dschihan-Tempels abgesehen hatte. Daß gerade diese Diamanten gestohlen werden sollten, wußte ich jedoch nicht. – Als Schraut und ich hier im Hofe den Wunderelefanten bei seiner Orakelarbeit beobachteten, bemerkte ich, daß der Mahut Dsangpo das Tier mit kleinen, länglichen Brötchen dreimal fütterte. Nachher überbrachten Sie, Master Hamilton, mir dann die Nachricht von dem Tode des weißen Elefanten. Ich fragte, da mir dieses plötzliche Ende des Tieres sofort verdächtig erschien, ganz beiläufig, was mit dem Kadaver geschehen würde. So erfuhr ich, daß gerade Dsangpo diese Sektion gewünscht und auch schon einen Bekannten bei der Hand hatte, der sie ausführen sollte. Eine logische Verbindung zwischen dieser Sektion und den verschwundenen 28 Steinen ließ sich zwanglos herstellen. Ich kombinierte folgendermaßen: Dsangpo wollte die Diamanten auf eine Weise – auf Warbattys Anraten! – stehlen, die ihn in keinem Falle irgendwie in Verdacht der Täterschaft bringen konnte. Er gibt also morgens zunächst dem Brahmanen Singar Chani ein Gift, das erst nach einigen Stunden wirkt. Er rechnet darauf, daß er in der allgemeinen Aufregung die Steine aus dem Goldschilde herausbrechen, in Brötchen drücken und diese den Elefanten verschlingen lassen kann. Dann vergiftet er das Tier, wahrscheinlich durch ein letztes Brötchen, das ein sehr schnell wirkendes Gift enthält. Die Steine sind auf diese Weise tatsächlich spurlos verschwunden. Der Mahut selbst hat den Seitenanbau nicht verlassen. Ihm ist also nicht nachzuweisen, daß er sie etwa einer anderen Person zugesteckt hat. Der Tierarzt aber kann die Diamanten bei der Sektion ganz unauffällig an sich nehmen. – So sollte der Hergang sein. – Dsangpo, habe ich recht?“
Der Mahut nickte nur mit dem Kopf.
„Master Hamilton,“ fuhr Harst fort, „vielleicht empfiehlt es sich, sofort ein paar Ihrer Leute zu dem Tierbändiger Shamana Driga zu schicken und diesen verhaften zu lassen. Er hat uns gegenüber eingestanden, zu den Schwertbrüdern zu gehören. Wahrscheinlich ist auch Dsangpo ein Putra Rakisana, ein Bruder des Schwertes, ebenso der Tierarzt, obwohl dieser auf mich einen harmlosen Eindruck macht.“
„Sahib,“ rief Jang Aud da, „ich bin nicht Mitglied des Geheimbundes. Erst vorgestern hat Dsangpo mich mit Warbatty bekannt gemacht. Ich sollte 1000 Rupien für die Sektion erhalten und ein Zwanzigstel von dem Werte der Steine.“
„Mag sein,“ sagte Harst. „Das aufzuklären, ist Sache des Gerichts. – Auf Wiedersehen, Master Hamilton. Ich bin müde und sehne mich nach meinem Kojenbett auf dem Kutter.“
Wir wanderten der Stadt zu.
„Lieber Alter,“ meinte Harst, „ich habe heute böses Lehrgeld bezahlt. Ich war zu siegesgewiß. Das taugt nicht. Warbatty ist abermals halber Sieger geblieben.“ –
Der Tierbändiger wurde zu langjähriger Gefängnisstrafe verurteilt; der Tierarzt kam billiger weg, erhielt nur zwei Monate Gefängnis. Dsangpo wurde wegen des Mordes an Singar Chani gehenkt. Außerdem aber hob die Polizei in den untersten Räumen des unterirdischen Tempels im alten Fort ein ganzes Verbrechernest, alles Schwertbrüder, aus und verhinderte auch ein bereits vorbereitetes Opferfest der Mördersekte der Thugs.
Leider sollte unsere kurze Gefangenschaft in Shamana Drigas Dressurkäfig uns nochmals mit anderen Mitgliedern der Putra Rakisana in einer für uns nicht gerade angenehmen Weise zusammenführen.
Hierüber so einiges in der folgenden Erzählung.
Anmerkungen:
- ↑ In der Vorlage steht „Masta-Mastra-Inserat“.
- ↑ In der Vorlage steht „deken“.
- ↑ In der Vorlage steht „Haupteinang“.
- ↑ In der Vorlage steht „Ofizier“.
- ↑ In der Vorlage steht „Ofizier“.
- ↑ In der Vorlage steht „auch“.
- ↑ In der Vorlage steht „kostbare“.
- ↑ In der Vorlage steht „erlärte“.
- ↑ Hier ist eine Zeile doppelt („würde, daß der berühmteste Detektiv der Welt als Lockmittel“), während die tatsächlich folgende Zeile in der Vorlage um elf Zeilen verrutscht ist.
- ↑ Hier fehlt eine Zeile in der Vorlage, die sinngemäß ergänzt wurde.
- ↑ In der Vorlage steht „fast“.
- ↑ In der Vorlage steht „ebwachen“.
- ↑ „Aud“ / „Aug“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Aud“ geändert.
- ↑ In der Vorlage steht „haben“.
