Hauptmenü
Sie sind hier
Das goldene Gongong

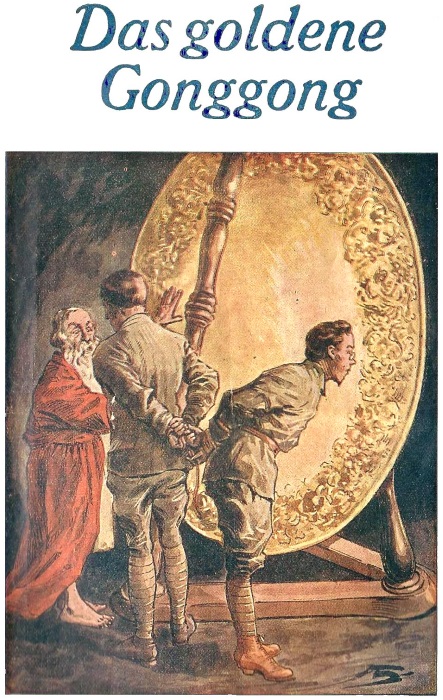
Der Detektiv
Kriminalerzählungen
von
Walther Kabel.
Band: 48
Das goldene Gongong.[1]
1. Kapitel.
Die drückende Hitze eines indischen Sommertages lastete auf Dschaipur, der Residenz des gleichnamigen Vasallenstaates in der britisch-indischen Provinz Radschputana.
Harald Harst und ich lagen bequem ausgestreckt in den hohen Rohrsesseln in unserem Wohnsalon. Wir waren seit Tagen Gäste des Maharadschas von Dschaipur.
Harst studierte ein englisches Buch, das über die Ruinen der uralten Stadt Amber handelte, die im Jahre 1728 auf Befehl des Fürsten Dschai Singh verlassen worden war. Die Ruinen von Amber liegen sieben Kilometer nordöstlich von Dschaipur in den Bergen. –
Ich nickte in meinem Sessel zuweilen ein. In diesem Zustande trägster Ruhe und halben Schlafes hörte ich, wie Harst irgend ein Wort mit ganz besonderer Betonung ausrief.
Ich öffnete schwerfällig die Augen.
„Sagtest Du etwas?“ fragte ich ohne Interesse.
Harst hatte das Buch, das aus der Bibliothek des Maharadschas stammte, jetzt im Schoße liegen und hielt gerade einen Zettel gegen das durch die hohen Fenster einströmende Tageslicht.
„Ja, mein lieber Schraut, ich sagte etwas,“ erwiderte er und drehte das Papier vor den Augen hin und her. „Ich sagte „Merkwürdig!“ Weiter nichts.“
Wenn irgend etwas mich hätte schnell munter machen können, dann waren es diese beiden Tatsachen: Erstens das „Merkwürdig!“ und zweitens der Zettel, dem Harald so große Aufmerksamkeit schenkte.
Ich stand auf und trat neben seinen Rohrsessel.
„Was gibt’s denn eigentlich?“ meinte ich.
Harald reichte mir schweigend das viereckige Stück Papier, das etwa Quartblattgröße hatte und einmal gefaltet gewesen war. Die Falte war sehr fest eingepreßt. Man sah, daß Harst sie offenbar mit dem Fingernagel glatt gestrichen hatte.
Das Papier war fest und hart, aber durchsichtig, – eine Art Pergamentpapier. Ich fand darauf nichts geschrieben, auch keine Zeichnung. Es war auf beiden Seiten leer.
Aber: Harst hatte es gegen das Licht gehalten! – Und als ich nun dasselbe tat und sehr genau hinsah, bemerkte ich mehrere Reihen und Bogenlinien von winzigen Löchern.
Es hatte jemand das Papier mit einer sehr dünnen Nadel unzählige Male durchstochen und so eine Zeichnung hervorgerufen, die auf den ersten Blick nicht zu bemerken war.
Ich drehte das Papier hin und her. Ich wollte festzustellen versuchen, was die Zeichnung darstellte.
„Gib Dir keine Mühe, mein Alter,“ sagte Harst da. „Wenn Du dieses Buch über die Ruinen von Amber nicht gelesen hast, kannst Du das Richtige nicht herausfinden.“
„So hängt die Zeichnung mit der Ruinenstadt zusammen?“ fragte ich.
„Vielleicht! Das Pergamentblatt lag zwischen den letzten Seiten des Buches. Diese beiden Seiten waren an den Rändern leicht zusammengeklebt. Mithin sollte das Blatt nicht gefunden werden. Wenigstens nicht von einem, der das Buch nur flüchtig durchblätterte. Der Klebstoff, mit dem man die beiden Seiten zu einer Art Versteck hergerichtet hat, ist von ganz besonderer Art. Ich habe ein wenig davon abgekratzt und auf der Messerspitze über einem Streichholz heiß gemacht. Dem Geruch nach handelt es sich um keinen Klebstoff, sondern um ein Gemenge aus Gelatine und einer alkoholischen Flüssigkeit, wie es Forschungsreisende dazu benutzen, Pflanzen zu konservieren.“
„Bitte weiter,“ sagte ich interessiert und zog meinen Sessel neben den Haralds.
Er hatte mir das Pergamentblatt abgenommen und fuhr mit den Fingerspitzen der Rechten wie liebkosend darüber hin.
„Wir werden die Hitze jetzt vergessen, mein Alter,“ meinte er lächelnd. „Wir waren seit Tagen ohne unsere geliebte Arbeit. Das tut nie gut. Man wird schlaff dabei. Nun haben wir wieder ein Problem, sogar ein sehr eigenartiges. Wenn Du es nachher wieder schriftstellerisch verwertest, rate ich Dir zu dem Titel: „Das goldene Gongong“. Ein hübscher Titel. Deine Leser werden sich die Köpfe zerbrechen, was Gongong ist, jedenfalls dreiviertel von ihnen. Ein Viertel wird vielleicht wissen, daß „Gongong“ ebenso viel wie Gong bedeutet. Und Gong ist doch ein tellerförmiges, laut dröhnendes Tonwerkzeug!“
Er nahm jetzt das Buch von seinem Schoß und schlug es ganz hinten auf.
„Sieh’,“ sagte er, „dies sind die beiden Seiten, die leicht zusammengeklebt waren. Hier findest Du auf der rechten Seite einige Zeilen mit Bleistift unterstrichen. Sie lauten:
Das goldene Gongong von Amber war in ganz Indien berühmt. Es hatte einen Durchmesser von Manneshöhe und wog mehr als vier Männer. Es hing an einem goldenen Dreifuß, und der Klöppel dazu bestand ebenfalls aus reinem Golde. Niemand weiß, wo es geblieben ist. Als der Fürst Dschai Singh die Stadt Amber räumen ließ, damit das für den Handel günstiger gelegene Dschaipur zu größerer Blüte gelange, verschwand das goldene Gongong spurlos aus dem einzigen Dschaina-Tempel[2], den es in Amber gab.
Du besinnst Dich nun wohl, daß gestern an der Tafel des Maharadschas das Gespräch zufällig auf Forschungsreisende kam und daß Oberst Lincoln, der englische Kommandeur der Streitkräfte des Fürsten, dabei kurz erwähnte, daß Professor Tompsons Verschwinden noch immer nicht aufgeklärt sei. Der Fürst warf dem Oberst dieser Bemerkung wegen einen mißbilligenden Blick zu. Lincoln wechselte denn auch schnell das Thema.“
„Ja – ich erinnere mich sehr gut. Nachher gingst Du mit Lincoln in den Schloßpark.“
„Und – forschte ihn über Tompsons Verschwinden aus. – Die Sache verhält sich so. Professor Reginald Tompson von der Universität in London, ein sehr berühmter Botaniker, war vor fünf Jahren Gast des Maharadschas und sammelte eifrig hier in der Umgegend Pflanzen und Gräser. Er war ein richtiger Gelehrter: weltfremd, fast menschenscheu und sehr unzugänglich. Auf seinen Ausflügen wurde er nur von seinem Hunde, einer englischen Bulldogge, begleitet, die noch unliebenswürdiger als ihr Herr gewesen sein soll. Dann kehrten Herr und Hund eines Tages nicht zurück. Man suchte, man unterließ nichts, sie zu finden. Oberst Lincoln hat selbst durch das Militär die ganze Umgegend durchstreifen lassen. Dem Maharadscha war es sehr unangenehm, daß diese geheimnisvolle Angelegenheit ungeklärt blieb. Er setzte eine hohe Belohnung aus, um auch den Eifer seiner Polizei anzuspornen. Kurz: es wurde nichts versäumt, um über das Schicksal Tompsons Aufschluß zu erhalten. Dann geriet auch dieses Vorkommnis allmählich in Vergessenheit. Nur der Fürst soll noch heute schwer darunter leiden, daß der Professor gerade als sein Gast und hier in der Nähe der Residenz verschwunden ist.“
„Man hat also nicht den kleinsten Anhaltspunkt dafür entdeckt, was mit Tompson geschehen ist?“
„Nein. Der letzte Mensch, der ihn und seine Bulldogge sah, ist ein armer Hindu, der die beiden in der Nähe der Ruinenstätte erblickte. Dieser Hindu besitzt dort eine Gärtnerei, wie Lincoln mir zu berichten wußte, und heißt Mokri.“
„Ah – in der Nähe der Ruinenstätte!“ rief ich. „Weshalb aber,“ fügte ich hinzu, „glaubst Du, daß dieses Pergamentblatt gerade von Tompson in diesem Buche versteckt wurde?“
„Ja, ja – diese Hitze!“ lächelte Harald und schüttelte den Kopf. „Du bist heute geistig nicht auf der Höhe, mein Alter. Gar nicht auf der Höhe. Sonst würdest Du an den Gelatine- Kleister denken.“
„Stimmt! Die Frage war recht unbegabt. – Die nächste ist es hoffentlich nicht: Weshalb hat der Professor das Pergamentblatt in dem Buche versteckt?“
Harald hob die Schultern. „Ich vermute hierüber etwas. Ob es richtig ist, weiß ich nicht – noch nicht. Aber ich werde es wissen. Wir werden eben nach Tompson suchen, werden aber natürlich keinem Menschen hier etwas von diesem unserem Vorhaben mitteilen.“
„Willst Du mir Deine Vermutung nicht anvertrauen?“ bat ich.
„Nein, lieber Alter. Ich unterstütze Deine Gedankenfaulheit niemals. Du könntest bei einigem Nachdenken auch selbst darauf kommen.“
„Gut. Werde mir Mühe geben. – Etwas anderes. Du nimmst an, Tompson hat in den Ruinen nach dem goldenen Gongong gesucht?“
„Ja. Fraglos hat nur er diese Zeilen hier unterstrichen. Ich behaupte auch, daß dieser Professor keineswegs der weltfremde Gelehrte war, als den er sich stets aufspielte. Wer auf solche Ideen wie die mit dem durchstochenen Pergamentblatt kommt, der hat auch noch andere Interessen als nur Pflanzen und Gräser.“
Er hielt das Pergamentblatt wieder gegen das Licht.
„Bitte – verfolge die punktierten Linien recht genau,“ sagte er. „Ich halte das Blatt jetzt so, wie man es halten muß.“
Ich beugte mich vor.
„Ah – das ist ja ein Name – das sind lateinische Buchstaben!“ rief ich. „Nur daß der Name sehr verzerrt ist, da man ihn als Halbkreis geschrieben oder besser gestochen hat. Und der Name lautet – Tompson!“
„Freilich – Tompson. Du hast Dich aber soeben ungenau ausgedrückt. Der Name ist nicht als Halbkreis, sondern als Ellipse geschrieben, und zwar berührt der nach unten herumgezogene Schlußstrich des letzten Buchstabens n die Schleife des Anfangsbuchstaben T.“
„Du hast recht. Die von den Buchstaben eingeschlossene freie Fläche ist eine Ellipse. Das muß etwas zu bedeuten haben.“
„Ganz gewiß. – Wir wollen nun aber von der Theorie zur Praxis übergehen, das heißt, uns zu einem Ausflug fertig machen. Wir nehmen unser gewöhnliches Handwerkszeug mit. Unserem Diener werde ich sagen, daß wir die Ruinenstadt besichtigen wollen und wahrscheinlich erst morgens zurückkehren werden. Dies für alle Fälle, damit man unser Fernbleiben nicht etwa in einer Weise deutet, die dem Maharadscha Aufregungen schafft.“
Er legte das Pergamentblatt in das Buch zurück und schloß dieses in einen unserer Koffer ein.
Nach einer Viertelstunde verließen wir den Palast des Fürsten.
Ein leichter Bambuswagen brachte uns nach den Ruinen von Amber hinauf, denn die ehemalige Hauptstadt des Landes liegt mitten in den Felsenbergen, die sich in weitem Halbkreis um Dschaipur auftürmen.
Unser Kutscher war ein alter, graubärtiger Hindu mit tief durchfurchtem, magerem Gesicht. Er sprach ein wenig englisch und hielt sich wohl für verpflichtet, die weißen Sahibs (Herren) auf diese und jene Merkwürdigkeit aufmerksam zu machen.
Obwohl die Ruinen von Amber in der Luftlinie nur sieben Kilometer von Dschaipur entfernt sind, brauchten wir doch fast anderthalb Stunden, bevor unser Kutscher mit der Hand in ein weites Tal hinabdeutete und dazu erklärte, das sei die einstige Residenz von Dschaipur.
Harst befahl dem Hindu anzuhalten. Wir stiegen aus und bezahlten die Fahrt – anderthalb Mark nach deutschem Gelde.
Der Alte fuhr davon.
Es war jetzt ½9 Uhr abends. Die Sonne war längst hinter den Bergen verschwunden. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die ersten Abendschatten füllten bereits die Seitentäler.
Harst nahm sein Fernglas aus dem Futteral und schaute über das endlose, wohl eine Meile lange Tal und die grüne Wildnis hinweg.
Dann sagte er: „Dort drüben steht eine Hütte. Siehst Du jene Terrasse am Ostabhang? Da wohnt der Mann, den ich sprechen möchte, – der Gärtner Mokri.“
„Wir müssen also das ganze Tal umrunden. Dürfte das bei der schnell zunehmenden Dunkelheit nicht gefährlich sein?“
„Du meinst, weil der Kutscher uns bestätigte, daß die Ruinenstadt von Giftschlangen wimmelt? – Wir werden eben vorsichtig sein, mein Alter. Übrigens: fällt Dir hier nichts auf?“
Ich blickte Harst fragend an.
„Ich wüßte nicht, was –“
„Schon gut,“ unterbrach er mich. „Gehen wir. Wir wollen uns jeder einen langen, starken Stock zurechtschneiden. Damit halten wir uns das Gewürm am besten vom Leibe.“
2. Kapitel.
Sehr bald fand Harald dann einen breiten Pfad, der sich durch das Trümmerfeld hindurchwand und der den Weg zu des Gärtners kleinem Anwesen darstellte.
Unangefochten gelangten wir so nach kaum zwanzig Minuten bis an den Dornenwall, der den Garten und das Haus Mokris umgab. Der Eingang zu dem Grundstück, eine drei Meter hohe Bambusgittertür mit eisernen, auswärts gebogenen Spitzen, war durch starke Holzriegel von innen verschlossen. Die Hütte selbst lag hinter einem Palmenhain wohl fünfzig Meter von der Pforte ab. Wir versuchten die Riegel zu öffnen. Es gelang uns nicht. Wir hatten vorher schon laut nach Mokri gerufen. Niemand erschien.
„Vorwärts – klettern wir hinüber,“ meinte Harald.
Dies war der eisernen Spitzen wegen nicht ganz einfach. Dann schritten wir der Hütte zu. Als wir den Palmenhain hinter uns hatten, sahen wir sofort, daß Mokris Häuschen fraglos recht alt war. Nur das Holzdach war neu. Das niedrige Gebäude bestand aus Sandstein und hatte reiche Verzierungen von schwarzem Marmor. Die Fenster und die Tür waren ebenfalls moderne Arbeit.
Wir pochten eine ganze Weile. Endlich rief jemand hinter der Tür ein paar indische Worte.
Harst rief zurück, daß wir Mokri nur um einen Imbiß bäten.
Ein Schloßriegel kreischte, und die Tür tat sich auf.
Vor uns stand ein Greis mit langem, weißem Bart. Um den Hals trug er die weiße Brahmanenschnur. Mokri gehörte also zur vornehmen Hindukaste. – Nicht alle Brahmanen sind Priester, wie man in Europa vielfach glaubt. Es gibt unter ihnen Kaufleute, Bauern und sehr viele Bettler sogar.
Der lange, hagere Greis mit dem hellen Turban und dem sauberen Leinengewand musterte uns schweigend mehrere Minuten, bevor er widerwillig erklärte:
„Ihr seid mir willkommen.“
Daß dies nur eine Redensart war, merkte ich sofort. Der Greis wünschte uns in Wirklichkeit dorthin, wo der Pfeffer wächst.
Dann saßen wir in einem kleinen Gemach auf Holzschemeln an einem ebenso einfachen Tische.
Mokri blieb stumm. Gewiß – wenn Harald ihn ansprach, antwortete er in ganz geläufigem Englisch. Aber er selbst gab sich keine Mühe, die Unterhaltung in Gang zu halten.
Er hatte uns kaltes gebratenes Fleisch, Ziegenmilch, Früchte und Hirsebrot vorgesetzt. Wir aßen nur zum Schein ein wenig. Mokri hatte am Fenster in einem mit Leder überzogenen hochlehnigen Stuhl Platz genommen.
Es wurde schnell dunkel. Der Greis stand auf und zündete eine altertümliche Öllampe an.
„Setze Dich zu uns, Mokri,“ sagte Harald. „Es hat keinen Zweck, daß wir länger gegenseitig uns zu täuschen suchen. Wir sind Dir als Gäste unangenehm. Weswegen?“
„Sahib, ich gebe Euch gern, was ich einsamer Mann Euch zu bieten vermag.“
Der Greis rückte seinen Stuhl an den Tisch. Er tat es so wie alles, was er bisher getan: mit Widerwillen, mit Zwang.
„Hast Du gehört, wer wir sind?“ fragte Harst nun. „Du kommst häufig nach der Stadt. Vielleicht erzählte man Dir, daß bei dem Maharadscha jetzt zwei Europäer wohnen, die endlich die Diebe entlarvten, durch die der Fürst lange Zeit bestohlen worden ist.“
„Ich habe es gehört, Sahib,“ erklärte Mokri mit derselben Ruhe und demselben ablehnenden Ton.
„Gut. Du bist ehrlich. Sei es auch weiter. Ich warne dich vor jeder Lüge. Ich würde sofort merken, wenn Du die Unwahrheit sprichst.“
Der Greis blickte Harald gelassen an. Es war weder Feindseligkeit noch Abneigung in diesem Blick. Es war etwas wie stilles Bedauern und – Angst darin.
Wer wie ich jahrelang mit Harst von Abenteuer zu Abenteuer geeilt ist, wird Menschenkenner, lernt auch, den Ausdruck des Auges richtig zu ergründen. –
Mokri schwieg zu dieser halben Drohung Harsts. Und dieser sprach weiter.
„Du ahnst, weshalb wir Dich aufgesucht haben. Und darum bist Du so verschlossen uns gegenüber. Ist es nicht so?“
„Es ist so, Sahib –“
„Erzähle uns also, was Du über Professor Tompson weißt.“
Mokri schaute in das flackernde Licht der Öllampe. Seine Hände fuhren unruhig hin und her. Dann erwiderte er:
„Ich war es, der ihn an jenem Tage sah, als er verschwand. Ich kam mit meinem Lastkamel aus Dschaipur zurück. Es war gegen Abend. Er ging mit seinem Hunde den Hauptweg nach Norden zu entlang, der in die Ruinenstadt führt. Ich habe dies auch denen erzählt, die nach dem gelehrten Sahib suchten. Mehr weiß ich nicht.“
Harald hatte sich eine Zigarette angezündet und auch mir sein Etui hingehalten.
Er blies ein paar Rauchringe, blickte ihnen nach und fragte ganz unvermittelt:
„Wie lange wohnst Du hier bereits?“
„Seit meiner Geburt. Mein Vater wohnte hier, mein Großvater ebenso –“
„Hast Du ein Weib und Kinder, Mokri?“
„Nein, Sahib. Ich war stets allein.“
Dieser Alte wurde mir allmählich doch etwas unheimlich. Hinter seiner starren Ruhe, hinter diesen großen, dunklen, klaren Augen konnte sich ganz anderes verbergen, als man annehmen durfte. Mokri war ohne Zweifel weit gebildeter als der Durchschnitt der Inder. Seine Ausdrucksweise verriet dies deutlich. Und – dieser Mann war auch klug und vorsichtig. Als Gegner konnte er sehr gefährlich werden. – Das schoß mir so durch den Kopf, als ich ihn jetzt still beobachtete, nein, – belauerte. Ich hoffte, er würde sich irgendwie durch sein Mienenspiel verraten.
Harald ließ jetzt eine längere Pause in diesem Verhör eintreten, dessen Zweck mir nicht ganz klar war. Was sollte dieser Greis noch über das Schicksal Tompsons angeben können, falls er nicht – selbst zu denen gehört hatte, die den Professor aus irgend welchen Gründen beseitigt hatten.
Harst nahm die zweite Zigarette. Dann beugte er sich vor, stützte die Arme auf den Tisch und fragte, jedes Wort scharf betonend:
„Wie oft hast Du den Professor hier in der Nähe der Ruinen oder in den Ruinen selbst gesehen?“
„Sehr oft, Sahib. Jeden Tag fast.“
„Ah – ich ahnte es!“ Harald wandte sich mir zu und sagte auf deutsch: „Und Oberst Lincoln erklärte mir, der Professor hätte für die Ruinenstadt Amber keinerlei Interesse gehabt und sei meist in den Bergen nördlich von Dschaipur gewesen. Tompson hat also verheimlichen wollen, daß er die Ruinen täglich besuchte. Sehr wichtig, mein Alter.“
Dann richtete er das Wort wieder an den alten Brahmanen.
„Du hast nach dem Verschwinden Tompsons diese Tatsache, daß er jeden Tag sich hier eingefunden hatte, verschwiegen, hast nur gesagt, Du hättest ihn an jenem Tage hier bemerkt. Weshalb verheimlichtest Du dies?“
„Weil ich es Sahib Tompson versprochen hatte.“
„Wann?“
„Nachdem er einige Male bei mir gewesen war. Er kam stets von Westen her durch die Berge zu mir. Es sollte ihn niemand sehen. Ich habe ihn oft gewarnt, nicht in den Ruinen umherzuklettern. Er sagte mir, er suche dort eine ganz seltene Pflanze.“
„Weshalb und wovor warntest Du ihn?“
Der Greis wurde wieder unruhig. Seine Augen glitten hin und her. Dann antwortete er auffallend leise:
„Vor etwas, das ich selbst nicht kenne, Sahib.“
„Und was ist das?“
Der Brahmane flüsterte noch leiser:
„Vor der Seele der toten Stadt, Sahib –“
Auch ich hatte mich jetzt unwillkürlich vorgebeugt. Es war da ein Etwas in dem Ton und dem Verhalten des Greises, das mir einen Eiseshauch über den Rücken trieb.
Harst formte wieder Rauchringe.
„Oberst Lincoln erwähnte auch dies,“ sagte er nun gleichmütig. „Kein Eingeborener wagt sich nachts in die Ruinen, nicht mal in dieses Tal. Man soll hier oft seltsame Töne gehört haben. – Nennst Du diese Töne die Seele der toten Stadt, Mokri?“
„Ja, Sahib. Die Töne und –“ Er machte eine kurze Pause, ließ seine Stimme wieder zum Flüstern herabsinken: „– die Töne und die Menschen, die man nie sieht –“
„Wie meinst Du das? Man sieht diese Menschen nie?!“
„Nein, Sahib. Und doch sind sie da. Sie waren stets da. Mein Großvater wußte es, mein Vater wußte es. Aber – sie wußten es nur. Mit den Augen haben sie sie nie geschaut, ebensowenig wie ich.“
„Und die Anzeichen, daß Menschen in den Ruinen hausen?“
„Die Beweise sind die Felder und die Fruchtbäume des Dorfes Galpor dort drüben in dem Nachbartale, die immer wieder geplündert werden. Die Leute verdächtigen stets die falschen. Sie ahnen nicht, daß die tote Stadt noch lebt.“
„Diese Beweise sind nicht gerade sehr überzeugend, Mokri. – Doch – ich werde das alles selbst untersuchen. – Weißt Du noch etwas über den Professor?“
Der Greis nickte fast schwermütig.
„Sein Hund meldet sich jede Nacht, Sahib. Ich kenne sein Bellen.“
„Und Du hast dies der Polizei nicht mitgeteilt, Mokri?“
„Ich tat es ja. Man hat mich ausgelacht. Es gibt hier in den Bergen verwilderte Hunde, Sahib. Und der Polizeichef meinte, ein Hund bellt wie der andere.“
„Wann hörtest Du die Bulldogge zum ersten Mal?“
„Etwa drei Monate nach dem Verschwinden Tompsons.“
Harald lehnte sich wieder zurück und schloß halb die Augen. Wohl fünf Minuten verhielt er sich völlig regungslos. Dann fragte er wieder:
„Du glaubst, daß der Professor noch lebt?“
„Ja, Sahib.“
„Er wird also Deiner Ansicht nach von den unsichtbaren Bewohnern der Ruinen gefangen gehalten, nicht wahr?“
„Ja, Sahib.“
Dieses monotone „Ja, Sahib“ wirkte im Zusammenhang mit dem bisherigen Inhalt dieser seltsamen Unterredung wie ein düsteres, drohendes Rätsel.
Ich blickte Harald an. Unsere Augen begegneten sich. Sein Gesicht war ernst und nachdenklich.
„Sind die Töne jede Nacht vernehmbar?“ fragte Harald den Alten, nachdem er die dritte Zigarette genommen hatte.
„Jede Nacht. Kurz nach Mitternacht, stets um dieselbe Zeit.“
„Kannst Du uns mit Kleidungsstücken aushelfen, Mokri? Wir wollen als Inder um Mitternacht in die Ruinen schleichen. Ich muß diese Geheimnisse aufklären – um jeden Preis.“
„Sahib, ich warne Dich!“ sagte der Alte hastig. „Professor Tompson hat es bitter büßen müssen, daß er immer wieder in den Trümmern umherkletterte.“
Harald lächelte. „Diesmal werden andere bitter büßen, Mokri. Mein Freund und ich haben schon andere Dinge erlebt als dies. – Bringe uns die Anzüge und auch Kopftücher.“
Der Alte verließ den Raum.
Harst drehte sich halb um, so daß er mich voll ansehen konnte.
„Na – was sagst Du zu alledem?!“
Ich sagte gar nichts. Ich hätte des Brahmanen Warnung beherzigt und wäre die Nacht über hier in der Hütte geblieben.
Harald flüsterte jetzt: „Mokri weiß mehr, als er zugibt. Er muß ganz besondere Gründe haben, daß er so einiges verschweigt. Vielleicht fürchtet er die – Seele der toten Stadt! Übrigens ganz poetisch: Seele der toten Stadt! – Wir werden trotzdem dieser Seele so ein wenig auf den Leib rücken.“
Mokri kehrte mit den Kleidungsstücken zurück. Nochmals sprach er dieselbe Warnung aus, während wir den Anzug wechselten. Harst tat, als hörte er die Worte nicht. Er legte nur seine neunschüssige Clementpistole[3] auf den Tisch und die Taschenlampe dicht daneben. Ich sah, wie des Brahmanen Augen einen Moment auf der Waffe ruhten. Ich sah noch mehr: ein trübes Lächeln glitt über sein braunes, faltiges Greisengesicht hin. Es war ein Lächeln, in dem etwas wie Mitleid für uns lag.
Harst übergab dem Alten unsere Brieftaschen. „Bewahre sie uns auf,“ sagte er. „Ich vertraue Dir. – Noch eine Frage, Mokri. Der Dornenwall um Dein Gehöft ist sehr hoch. Du hast Dich gut gesichert. Du fürchtest die Panther, nicht wahr? Oder noch etwas anderes?“
„Am Tage fürchte ich nichts, Sahib. Nachts erwacht die tote Stadt. Und – mein Vater und mein Großvater haben nach Dunkelwerden das Haus nie verlassen.“
Mokri saß wieder in seinem hohen Lederstuhl. Harald trat jetzt dicht an ihn heran, meinte eindringlich:
„Seit wann wohnt Deine Familie hier?“
„Schon immer, Sahib. Seit Jahrhunderten.“
„Auch schon vor dem Jahre 1728, als Fürst Dschai Singh die Stadt Amber durch ein Machtwort entvölkerte?“
Mokris Augen suchten den Boden. Das nervöse Spiel der Hände begann wieder.
„Seit diesem Jahre leben wir hier,“ erklärte er dann leise. „Mehr darf ich nicht sagen.“
Harst forschte nicht weiter.
„Laß uns hinaus,“ meinte er. „Die Mitternachtsstunde ist nahe.“ – Er stand jetzt am Fenster und blickte in den mondhellen Garten hinaus. „Sollten wir bis zum Morgen nicht wieder hier sein, so eile zu Oberst Lincoln und berichte ihm, daß wir in den Ruinen verschwunden sind.“
Er hatte sich nach Mokri umgedreht. Dieser saß ein paar Sekunden wie erstarrt da. Dann sprang er auf. Seine Hände streckten sich wie flehend Harst entgegen.
„Sahib – geht nicht in die Ruinen! Oder – geht am Tage! Ich – ich –“
Seine Arme sanken herab. Auch sein Kopf senkte sich. Ein hilfloser Ausdruck zeigte sich in seinem Gesicht.
„Ich verstehe, Mokri. Du – würdest nicht zu Oberst Lincoln gehen! Du fürchtest Dich vor denen, die Professor Tompson gefangen halten, weil er zu tief in die Geheimnisse des toten Amber eingedrungen ist. – Gut – ich verlange nichts von Dir. Ich werde auch ohne fremde Hilfe die Seele der toten Stadt besiegen –“
Mokri erwiderte nichts.
Er brachte uns dann bis an die Bambusgitterpforte. Nach einem kurzen Abschiedsgruß schritten wir den Pfad hinab, der von der Terrasse in das Tal führte. Kaum waren wir hinter den ersten Büschen verschwunden, als Harald stehen blieb. Er faßte in seinen Leinenkittel hinein und holte aus der Tasche seines bastseidenen Sporthemdes, das er anbehalten hatte, ein Blatt Papier hervor.
Der Vollmond gab genügend Licht. Ich erkannte zu meinem Erstaunen das Pergamentblatt, das Harst jetzt nochmals geknifft hatte.
„Du dachtest, es läge in dem Buche,“ meinte er. „Es war ein kleiner Taschenspielerkniff. Ich erwartete nämlich, Du würdest mich auffordern, das Blatt mitzunehmen. Lieber Alter, die Hitze hatte Dir sehr geschadet. Du warst geistig wirklich nicht auf der Höhe. Du hättest Dir sonst selbst sagen müssen, daß Tompson kaum aus Spielerei den Namen so merkwürdig gebogen in das Papier eingestochen hätte. Dieser Professor ist kein einseitiger Gelehrter. Das Pergamentblatt enthält nichts anderes als eine Skizze dieses Tales. Als wir vorhin oben auf der Bergstraße standen und den vollen Überblick über die Ruinen hatten, machte ich eine Bemerkung, die Du nicht recht begriffst. Sie sollte Dich nur auf die Form dieses Tales hinweisen, auf die Ellipsenform. Die so unregelmäßig eingestochenen Buchstaben des Namens „Tompson“ sind fraglos die noch passierbaren Straßen der Ruinenstätte, und zwar gerade die Straßen, die zu all diesen Geheimnissen in irgend einer Beziehung stehen. Mag sein, daß nicht jeder Strich eines jeden Buchstabens diese Bedeutung hat. Aber die Mehrzahl ohne Zweifel.“
Er hielt das Blatt gegen den Mond. Man erkannte auch jetzt die feinen Löcherreihen in dem Papier ganz deutlich.
„Bitte – dieser Strich des Anfangsbuchstabens T ist der Pfad, der von der Hauptstraße zu dem Gehöft Mokris führt. Die Schleife des lateinischen T aber ist das Gehöft. Siehst Du in der Schleife das aus 8 Löchern bestehende kleine Kreuz? – Es gibt ein solches Kreuz noch anderswo auf dieser Skizze. Schau’ auf das kleine p in der Mitte des Namens. Der Hauptstrich dieses Buchstabens ist sehr lang ausgezogen und endet in einem Schnörkel. In diesem Schnörkel steht das zweite Kreuz. Wir werden nun den Ort suchen, den dieses Kreuz hervorhebt. Er muß dort im Nordosten liegen, und es kann der Skizze nach nicht allzu weit bis dorthin sein. Hier in der Nähe muß ein Pfad abbiegen. Der Buchstabe o ist mit Absicht so hoch gesetzt, daß er in der Mitte des senkrechten Striches des Anfangs-T’s beginnt. – Vorwärts, verlieren wir keine Zeit –“
Er steckte das Blatt wieder ein.
Ich konnte Harald nur wieder bewundern und schweigen. War es schon schwer gewesen, aus diesen punktierten Linien einen Namen herauszulesen, so war es geradezu eine glänzende Leistung selbst für einen noch so scharfsinnigen Kopf, diese wirren Linien als Wege zu deuten.
Daß diese seine Vermutung zutraf, bewies ja der Pfad nach Mokris Hütte und das Kreuz in der Schleife des Anfangs-T’s.
3. Kapitel.
Harald schritt langsam voran. Wir hatten dann gerade eine Anhöhe erreicht und befanden uns dicht vor der Grenze der Ruinenstätte, als wir beide mit einem Male wie angewurzelt stehen blieben.
Von irgendwoher drang durch die schweigende, mondhelle Nacht ein seltsam dumpfer und doch auch wieder voll und rein klingender Ton bis an unser Ohr.
Der Ton verhallte, erklang aufs neue, verhallte abermals.
Wir standen dicht nebeneinander. Ich blickte Harald fragend an. Er zählte die Töne leise, wandte den Kopf dabei lauschend hin und her.
„– acht – neun –“
Neun solcher Töne. Dann nichts mehr.
Sie hatten etwas seltsam Unheimliches an sich, diese Schallwellen, von denen man nicht wußte, woher sie kamen.
Wie vorhin in Mokris Hütte lief mir wieder ein Eiseshauch über den Rücken.
Ich wartete atemlos auf den zehnten Ton.
Er blieb aus.
„Das goldene Gongong,“ flüsterte Harald. „Und neunmal ertönte es – neunmal! Die heilige Zahl Neun der Dschainas. So stimmt auch dies –“
Durch eine Lücke in den Büschen konnten wir von der Anhöhe aus einen Teil der Ruinenwildnis überschauen. Nur vereinzelte Mauerreste ragten aus dem grünen Pflanzenteppich hervor, der aus den eingestürzten Gebäuden flache Hügel und Gestrüpphaufen gemacht hatte.
„Das Gongong schweigt,“ sagte Harald nach einer Weile leise. „Jetzt fehlt nur noch die Bulldogge. – Warten wir hier. Man hört hier alles recht gut.“
Er setzte sich auf einen flachen Stein. Ich blieb stehen. Eine unerklärliche Unruhe hatte mich befallen. Es war nicht Angst, – es war jenes Prickeln in allen Nervensträngen, das uns schlimmer zu peinigen vermag als die tollsten Schmerzen.
Ich faßte unwillkürlich in die Tasche. Ich wußte, daß das kühle Metall der Clementpistole diesen Zustand bessern würde. Ich nahm die Waffe in die Hand, zog sie aus der Tasche, schob mit dem Daumen die Sicherung herum.
Es half wirklich. Die peinvolle Unruhe ließ nach. Ich spähte über die Ruinenstadt hinweg. Ich dachte an Haralds Worte: „Die Seele der toten Stadt – ganz poetisch!“
Nein – poetisch war nichts in dieser Nacht trotz des bläulichen Mondlichts und der Stille um uns her. Nein – man fühlte es förmlich, daß hier irgendwo das Verderben lauerte, in irgend einer Gestalt.
Und Harst?! – Harst hatte ganz leise sein Feuerzeug angerieben und rauchte eine seiner Mirakulum-Zigaretten.
Als er meinen Blick spürte, sagte er gleichmütig:
„Es genügt, wenn einer schußfertig ist, mein Alter. Ich glaube aber, Du verkennst die Seele der toten Stadt. Du wirst kaum Veranlassung haben, auch nur einmal abzudrücken.“
Diese gutmütige Ironie reizte mich.
„So sage mir, was Du über diese Seele vermutest,“ meinte ich unliebenswürdig. „Dann werde ich die Pistole wieder wegstecken. Die heilige Zahl Neun hättest Du mir –“
Mir stockte der Laut in der Kehle.
Ein Hund hatte gebellt! – Es war ein rauhes, tiefes Bellen, dazwischen wieder ein kurzes Aufheulen.
Harald sprang empor, trat dicht an die Lücke in den Sträuchern heran.
Wir verhielten uns regungslos. Wir hatten die Köpfe vorgereckt.
Ein paar Minuten nichts.
Nun wieder dieses häßliche, rauhe Bellen.
„Es ist eine Bulldogge,“ flüsterte Harst. „Die englischen Bulldoggen bellen selten und nur vor Freude, manche auch gar nicht. Nur vor Freude! Darauf kommt es an, mein Alter. Wenn ein Hund 24 Stunden lang eingesperrt ist und sich dann in Gegenwart seines Herrn im Freien bewegen darf, ist das schon ein Anlaß zur Freude –“
Das Gebell verstummte. Wir hörten nur noch zweimal ein langgezogenes Aufheulen.
„Die Richtung stimmt,“ flüsterte Harald wieder. „Los denn. Packen wir den Stier bei den Hörnern.“
Er setzte sich in Trab. Er fand auch wirklich einen Pfad, der nach rechts abzweigte. Wir liefen nun in einer der ehemaligen Straßen der toten Stadt Amber dahin. Der Pfad war schmal und wurde offenbar wenig benutzt. Harst hatte die eingeschaltete Taschenlampe in der Linken. Ich wußte, warum. Der Schlangen wegen. Der Lichtkegel tanzte vor ihm her. Dreimal prallte er zurück, raffte einen Stein auf und schleuderte ihn in das Gras.
Der Pfad teilte sich des öfteren. Harald zögerte an diesen Kreuzungen nicht einen Moment. Er mußte die Skizze Tompsons völlig im Kopf haben.
Lautlos liefen wir über die grasbewachsenen Steine, lautlos näherten wir uns einem Hügel, auf dessen grünem Pflanzenüberwurf die Reste zweier Türme phantastisch hervorwuchsen.
Dann blieb Harald stehen. Eine Wand von Schlinggewächsen, Dornen und einzelnen Büschen versperrte uns den Weg.
Etwas weiter nach links stand hier eine einzelne Zypresse, die ein Sturm einst halb entwurzelt und mit dem Stamm gegen den oberen Rand einer der Turmruinen gelehnt hatte.
Harald betrachtete diesen Baum, drängte sich dann vorsichtig durch die Büsche bis an die Zypresse heran, winkte mir und flüsterte: „Ich werde hinaufklettern. Hilf mir etwas –“
„Umgekehrt!“ verlangte ich in demselben vorsichtigen Ton. „Hilf Du mir hinauf. Dann helfe ich Dir von oben. Ich bleibe nicht zurück. Nicht aus Angst. Aber – diese ganze Sache hier erscheint mir mehr als verfänglich.“
Harald war einverstanden. Ganz ohne Geräusch ging diese Kletterpartie nicht von statten. Es strich jedoch ein schwacher Wind über die Ruinenstätte hin, und das Rauschen der Blätter der Zypresse mußte, wie ich annahm, die anderen Geräusche übertönen.
Bis zur Spitze des Turmrestes waren[4] es vielleicht fünfzehn Meter, also eine ganz ansehnliche Höhe. Die Mauer oben war sehr breit. Man konnte sich ganz sorglos und bequem darauf niederlassen. Die Zweige des Baumes verbargen uns jedem, selbst dem besten Auge.
Wir saßen nebeneinander. Wenn wir das Geäst etwas auseinanderbogen, konnten wir in einen quadratischen Tempelhof hinabblicken. Daß es der Innenhof eines Tempels war, bewiesen uns nicht nur mehrere steinerne Götzenbilder, sondern auch das Badebassin und daneben der Zugbrunnen.
Auffallenderweise war dieser Tempelhof von der überall in der Ruinenstadt bemerkbaren Zerstörung und von der Überwucherung durch Unkraut leidlich verschont geblieben. Die Steinplatten, mit denen er ausgelegt war, standen größtenteils an einer Seite hoch. Unkrautpflanzen hatten sie aus ihrer Lage gedrängt. Auch sonst hatten sich stellenweise Dornen, Disteln und andere mit dem bescheidensten Boden zufriedene Gewächse angesiedelt. Doch – diese Zeichen des Verfalls und der Zerstörung waren zu gering für die Zeitspanne von fast zweihundert Jahren seit Aufgabe dieser einst so blühenden Stadt.
Harald machte mich flüsternd darauf aufmerksam.
„Die Tempelgebäude, die den Hof einschlossen,“ fügte er flüsternd hinzu, „müssen sehr stattlich gewesen sein. Sie umgeben diesen quadratischen Raum wie ein grüner Wall. Wer nicht diese Zypresse als Leiter benutzt, wird wohl kaum Einblick in diesen Hof gewinnen. Ich wette, daß auch Professor Tompson denselben Weg einst benutzt hat, auf dem wir soeben hier nach oben gelangt sind. Und ich behaupte weiter, daß der Schlüssel zu dem Geheimnis der toten Stadt in diesem etwa zwanzig Meter langen und breiten Hofe zu finden ist. Wenn eine halbe Stunde –“
Er schwieg, drückte meinen Arm.
„Dort, Schraut, – dort neben dem Brunnen,“ hauchte er.
Das Mondlicht lag voll auf diesem merkwürdigen Platze. Jede Einzelheit war dort unten zu erkennen.
Hinter ein paar hohen Dornbüschen neben dem Brunnen stand ein Mann mit langem schneeweißen Bart und Haupthaar. Er trug keine Kopfbedeckung. Er war klein und hager, wie wir nun weiter feststellen konnten, als er langsam über den Hof schritt. Er hatte ein helles, mantelartiges Gewand an, das noch ein Stück nachschleppte.
Dicht hinter ihm aber trottete schwerfälligen, wiegenden Ganges eine gefleckte Bulldogge einher.
„Tompson!“ flüsterte ich. „Wirklich Tompson!“
Er mußte es sein. Der Mond beschien hell sein bleiches Gesicht. Es war ein Europäer. Und die Bulldogge bewies, daß wir den verschwundenen Gelehrten wirklich gefunden hatten.
Ich starrte wie gebannt auf die seltsame Erscheinung. Ja – seltsam genug wirkte sie.
Ruhigen, abgemessenen Schrittes ging Tompson hin und her, blieb zuweilen stehen und gestikulierte wild mit den Händen. Dann machte stets auch die Bulldogge halt und hob etwas den Kopf. Es sah genau so aus, als ob der Hund seinen Herrn trösten wollte.
„Was tun wir?“ fragte ich leise. „Sollen wir Tompson anrufen? – Ich sehe nirgends irgend einen Wächter –“
Harst schwieg.
Der Professor hatte sich jetzt auf den Brunnenrand gesetzt. Die Bulldogge tat einen Sprung und nahm neben ihm Platz.
Ich gab mir die größte Mühe, irgendwo noch ein lebendes Wesen zu entdecken. Ich bemerkte nichts. – Ich begriff Harald nicht. Weshalb zögerte er? Wenn wir Tompson anriefen, wenn dann vielleicht ein paar Leute auftauchten, – eben die, deren Gefangener er war, dann war es uns doch ein leichtes, sie mit unseren Pistolen zu verscheuchen.
„Harald, vorwärts doch!“ munterte ich ihn auf.
Er gab keine Antwort.
Ich wurde ungeduldig. „Ich verstehe Dich nicht,“ sagte ich gereizt. „Was soll dieses Warten?! Unsere Pistolen halten jeden in Schach, der –“
Haralds Hand preßte meinen Unterarm.
„Still – still. Hörst Du nicht?!“
Ja – die Dogge knurrte dumpf und röchelnd, knurrte so laut, daß wir es bis in unser Versteck hinauf vernahmen.
Tompson war aufgestanden. Der Hund stierte unverwandt zu uns empor. Er hatte uns gewittert.
„So rufe Tompson doch an,“ sagte ich lauter als beabsichtigt.
Der Hund bellte kurz auf. Es war ein zorniges Aufbellen. Tompson streichelte ihn. Dann trat er hinter die hohen Dornbüsche und – verschwand. Die Bulldogge zögerte. Mit einem Male war auch sie nicht mehr zu sehen. Sie war hinter dieselben Büsche geschlüpft.
„Schnell!“ meinte Harald da. „Schnell! Machen wir, daß wir uns in Sicherheit bringen –“
Er kletterte hastig nach unten, stützte mich, so gut er konnte. Wir gelangten tiefer und tiefer. Der Erdboden war nicht mehr fern.
Harald sprang die letzten zwei Meter. Wenigstens schien es mir so. Ich merkte jedoch sehr bald, daß dieser Sprung ein unfreiwilliger gewesen war. Ich sah nicht, was unter mir geschah. Ich fühlte, wie mich jemand an den Füßen packte, wie ich zur Seite abwärtsglitt. Ich schlug hart auf, kam auf den Bauch zu liegen. Irgend jemand riß mir die Hände auf den Rücken. Gleichzeitig rieselte mir eine Feuchtigkeit über das Gesicht. Ich spürte einen scharfen, widerlichen Geruch. Ich hielt den Atem an. Ich ahnte, daß es ein Betäubungsmittel war. Aber ich hatte doch bereits zweimal Luft geholt. Ein Schwindelgefühl zog mich in einen endlosen Abgrund hinab. Ich verlor das Bewußtsein.
4. Kapitel.
Seltsam?! Hatte ich dieses ganze Abenteuer nur geträumt?!
Ich blickte verwirrt um mich. Über mir der Mond. Und neben mir Harald. Und – wir beide saßen auf den Steinplatten des Hofes, in den wir vorhin hinabgeschaut hatten, und benutzten als Rückenlehne den gemauerten Brunnenkranz.
Ich war nicht gefesselt. Und – ganz in der Nähe sprach jemand, – englische Worte, deren Sinn ich erst langsam begriff.
„– Leben nicht aufs Spiel setzen,“ verstand ich jetzt. „Ich will wissen, wer Sie beide sind.“
Dann Haralds Stimme:
„Sie sind Professor Tompson –“
Ein leises höhnisches Lachen kam hinter den Dornbüschen hervor.
„Wer hat Ihnen dieses Märchen aufgebunden?! Es gibt keinen Professor Tompson –“
Ein paar Minuten Schweigen. Harald drehte den Kopf nach mir hin, flüsterte:
„Begreifst Du jetzt?“
Was sollte ich begreifen? Etwa die Tatsache, daß wir nun ebenfalls Gefangene waren und daß dort hinter den Büschen der Tod lauerte, falls wir einen Fluchtversuch wagten? –
Die heisere, eigenartig rauhe Stimme meldete sich wieder:
„Wer sind Sie beide? Ich muß alles wissen. Sind Sie als Spione hierher geschickt? Wer zeigte Ihnen den Weg auf die Turmruine?“
„Viele Fragen auf einmal,“ meinte Harst. „Wir sind Vergnügungsreisende, sind Deutsche. Den Weg fanden wir zufällig.“
„Deutsche?! Dann sprechen Sie deutsch. Ich beherrsche auch die Sprache.“
„Wie Sie wünschen,“ erwiderte Harst. „Sie hören es mir wohl an, daß ich Deutscher bin –“
„Allerdings. – Und Ihr Name?“
„Harald Harst. Mein Freund heißt Max Schraut. Er ist zugleich mein Privatsekretär.“
„Sie sind also ganz zufällig in die Ruinen von Amber gekommen?“
„Nein, das wohl nicht. Ich fand in einem Buche, das ich der Bibliothek des Maharadschas von Dschaipur entnahm, ein Pergamentblatt, auf dem ich eine Art Zeichnung entdeckte, die sehr geschickt in einem Namen verborgen war. Der Name lautete Tompson –“
Wieder das heisere, rauhe Lachen hinter den Büschen.
„Tompson ist tot. Nur Sadangri lebt.“
Harald sprach ohne Aufforderung weiter:
„Ich nehme an, daß der englische Professor Tompson, der vor Jahren Gast des Maharadschas war, diese Zeichnung nur deshalb in dem Buche versteckt hatte, damit man wüßte, wo man ihn zu suchen hätte, falls ihm mal bei seinen heimlichen Ausflügen nach der Ruinenstadt Amber etwas zustoßen sollte. Oberst Lincoln sagte mir, daß dieses Buch in dem Arbeitszimmer des Professors auf dem Tische gelegen hatte, als man nach Tompsons Verschwinden seine Gastzimmer genau in Augenschein nahm. Es kam jedoch niemand auf den Gedanken, das Buch sorgfältiger durchzusehen. So ist denn der Verbleib dieses berühmten Gelehrten noch heute völlig unaufgeklärt.“
Das Lachen hinter den Büschen erklang jetzt noch lauter als bisher.
„Völlig unaufgeklärt! Völlig unaufgeklärt!“ höhnte der Unsichtbare. „Tompson ist tot. Ich sagte es schon. Und auch Sie beide müssen sterben wie er. Mahavira will es.“
Mein Blick streifte Haralds vom Monde beschienenes Gesicht.
Noch nie habe ich sein Antlitz so verzerrt gesehen wie damals. Es glich einer Maske des Entsetzens. Dicke Schweißperlen rannen ihm von der Stirn über die Wangen.
„Was – was fürchtest Du?“ hauchte ich, völlig außer Fassung gebracht durch den Anblick dieser entstellten Züge.
Er antwortete mir nicht. Er rief ein heiser und unnatürlich klingendes „Halt!“ dem Unsichtbaren zu.
„Halt, Sadangri!“ wiederholte er, und seine Worte überstürzten sich förmlich. „Ich möchte Ihnen und Ihren Freunden einen Vorschlag machen, besser, Ihnen eine Bitte vortragen –“
„Sprechen Sie,“ erklärte der Unsichtbare kurz.
„Wir möchten gern, bevor wir den Tod Dschinas, des Überwinders, erleiden, das heilige goldene Gongong dieses Tempels sehen. Gehört haben wir es bereits. Wir würden seine Pracht und Schönheit ganz anders als nach unserem Tode würdigen können!“ –
Mir kamen diese Worte Haralds wie Wahnwitz vor. – Nach unserem Tode?! Dann würde mir jedes Gongong, und wenn es aus reinen Diamanten bestand, sehr gleichgültig sein.
„Wir werden beraten,“ erwiderte der Mann hinter den Büschen nach kurzer Pause. „Ich warne Sie beide aber nochmals. Ihnen droht der andere Tod, der Ihnen auf ewig die Mokscha verschließt, falls Sie sich zu erheben wagen.“ –
Nun hatte ich Gelegenheit zum Fragen.
„Harald, was bedeutet das alles?“ flüsterte ich.
Seine Hand suchte die meine. Seine Finger krallten sich um mein Handgelenk.
„Wahnsinn!“ hauchte er. „Der Tod Dschinas, des Überwinders, ist – der geistige Tod mit Hilfe eines Giftes, das nur den Oberpriestern der Dschainas bekannt ist –“
Wahnsinn?! – Mir erstarrte das Blut in den Adern. Urplötzlich begriff ich das höhnische Lachen hinter den Büschen.
„Harald, – der Unsichtbare ist Tompson, und Tompson ist – geistig tot,“ quälte ich mühsam über die Lippen.
„Ja. Du wirst jetzt auch die Angst Mokris von der Seele der toten Stadt –“
Da meldete sich Tompson schon wieder:
„Gut, Sie beide sollen das heilige goldene Gongong sehen, müssen sich vorher aber ohne Widerstand fesseln lassen.“
„Wir sind einverstanden,“ erklärte Harst. Und fügte ganz leise für mich hinzu: „Zeit gewonnen, alles gewonnen!“
Hinter den Büschen tauchte Professor Tompson auf, – genau so, wie wir ihn vorhin beobachtet hatten.
Wir erhoben uns. Er hatte zwei lange Riemen in der Hand. Harald legte bereitwilligst die Hände auf den Rücken. Tompson fesselte ihn. Dann tat er dasselbe mit mir. Ich sah sein Gesicht nun aus nächster Nähe; ich sah die glanzlosen Augen mit dem irren Blick, sah sein seltsames Lächeln auf dem fahlen Greisenantlitz. Dieses Lächeln hatte etwas Überirdisch-Verzücktes an sich.
Nur die Hände wurden uns gefesselt. Dann befahl Tompson mit seiner wie geborsten klingenden Stimme:
„Folgen Sie mir! Hüten Sie sich aber: der andere Tod ist hinter Ihnen!“
Er schritt voran, bog um die Dornenbüsche herum, die so regelmäßig in einer Reihe standen, daß man unwillkürlich auf den Gedanken kam, sie seien hier absichtlich gepflanzt worden, um wie eine Kulisse einen Teil des Hofraumes nach der Zypresse hin gegen Sicht zu decken.
Dunkler Schatten lag hier auf den Steinplatten. Noch etwas anderes lag hier und knurrte dumpf: die Bulldogge!
Tompson deutete auf ein großes quadratisches Loch in der Erde. Die Steinplatten waren an dieser Stelle entfernt und neben dem Loche aufgeschichtet. Ich sah, daß in jeder der Platten eiserne Stäbe eingelassen waren, die ihnen nachher den nötigen Halt gaben, wenn sie die Öffnung des Schachtes wieder bedeckten.
Eine plumpe Holzleiter kletterten wir dann hinab. Tompson hatte eine unserer Taschenlampen eingeschaltet. Der Lichtkegel tanzte hin und her. Wir kamen tiefer und tiefer. Bald befanden wir uns in einem hohen Gewölbe, das offenbar durch Menschenhand aus einer natürlichen Höhle herausgemeißelt war.
Die grauen Sandsteinwände zeigten breite Bänder von schwarzem Marmor. An diesen Stellen hatte man aus dem Marmor kunstlose Reliefs hergestellt, die zumeist einen Götzen, umgeben von allerlei Tieren, zeigten.
Das Gewölbe war durch Zwischenwände in mehrere Räume abgeteilt. Einer derselben war als Tempel eingerichtet. Hier brannten in Kupferlampen Dochte, die durch wohlriechendes Öl gespeist wurden. Ein atemberaubender, schwerer Dunst erfüllte diesen Höhlentempel.
Tompson hatte halt gemacht. Er drehte sich nach uns um, deutete auf die gegenüberliegende Wand und sagte mit leicht vibrierender Stimme:
„Da – das goldene Gongong.“
Es stand der Götzenfigur gerade gegenüber, von dieser durch die ganze Breite des Tempelraumes getrennt.
Der Lichtkegel der Taschenlampe ließ das Gold des riesigen Tellers und des Dreifußes matt aufleuchten.
Harst schritt auf das Gongong zu.
„Halt!“ rief Tompson drohend.
„Ich möchte es aus der Nähe betrachten,“ meinte Harald gelassen.
Wir standen dann neben dem kostbaren Tonwerkzeug, dessen Rand mit erhabenen Figuren geschmückt war. Es hing in goldenen, kurzen Ketten an dem Dreifuß. Daneben lag auf einem Marmorblock der Klöppel.
„Eine wundervolle Goldschmiedearbeit!“ sagte Harst scheinbar begeistert, beugte sich tiefer und schaute den Rand des Tellers an. Er hatte mir vorher einen besonderen Blick zugeworfen.
Ich spielte gleichfalls den Kunstverständigen, bückte mich und vernahm auch schon Haralds nur gehauchte Worte:
„Rücken an Rücken. Meine Fesseln lockern. Tompson hat unsere Pistolen in der Tasche. Zeichnen sich dort ab –“
Dann sagte er laut:
„Ein Kunstwerk, das Millionen wert ist! Noch nie sah ich etwas so Schönes!“
Ich hatte sofort begriffen, was Harald beabsichtigte. Ich richtete mich danach. Er trat jetzt hinter mich. Ich blieb gebückt stehen. Ich hörte, wie er Tompson fragte:
„Dieses Gewölbe ist ein Teil eines früheren Dschaina-Tempels, nicht wahr?“
Seine Absicht war klar: er wollte Tompson in ein Gespräch verwickeln.
„Ja – Dschaina-Tempel!“ rief der irrsinnige Professor überlaut. „Der heilige Dschina wohnt hier. Und ich bin einer seiner Priester. Ich heiße Sadangri, der Reine.“
„Die Dschainas sind eine religiöse Sekte, so viel ich weiß,“ sprach Harald hastig weiter.
„Sie sind die einzigen, die die wahre Religion haben,“ erklärte Tompson stolz. „Gott Dschina, der Überwinder, der Sieger über die Welt, ist größer als Brahma und Buddha. Wir Dschainas streben nach der wahren Seligkeit, dem Mokscha –“
Harst fragte weiter dieses und jenes. Man merkte, wie begeistert der Professor Auskunft gab.
Die Dschainas sind in der Tat eine religiöse Sekte, deren geläuterter Brahmanismus ihre Anhänger weit über die anderen Inder in sittlicher und geistiger Beziehung erhebt.
Das, was Tompson als „den Tod Dschinas“ bezeichnete, war ein unter den Dschainas noch vor fünfzig Jahren sehr häufig geübter Brauch. Wer schon bei Lebzeiten den Vorhof des Mokscha, der wahren Seligkeit, betreten wollte, ließ sich durch den Oberpriester der Dschainas vergiften und wurde infolge dieser Vergiftung wahnsinnig. Dieser Irrsinn äußerte sich hauptsächlich darin, daß die Betreffenden für die Dinge der Umwelt alles Interesse verloren und lediglich ihren Geist auf das konzentrierten, was sie schon vorher am lebhaftesten beschäftigt hatte. Die indische Kolonialregierung mußte mit harten Strafen gegen diesen Unfug vorgehen. Gänzlich ausgerottet ist er noch heute nicht. Kennzeichnend für die Sinnesart der Dschainas ist ihre Tierliebe. Ihnen verdankt Indien seine zahlreichen Tierhospitäler und Tierschutzvereine. –
Während Harald so in kluger Ausnutzung der fanatischen Vorliebe des Geistesgestörten für die Dschaina-Sekte diesen durch die verschiedenartigsten Fragen ablenkte, bewunderte ich noch immer das goldene Gongong, machte dabei aber die verzweifeltsten Anstrengungen, mit meinen gefesselten Händen die Riemen um Haralds Handgelenke aufzuknoten.
Zum Glück hatte Tompson diese Fesselung ziemlich oberflächlich vorgenommen.
Gerade als Harst fragte, in welcher Weise man uns denn das Dschaina-Gift beibringen wollte, waren die Schlingen so weit gelockert, daß er die rechte Hand jederzeit herausziehen konnte.
„Durch einen Stich mit einem Messer,“ erwiderte Tompson zerstreut. Für diese Dinge hatte er offenbar weit weniger Interesse. „Oder durch einen Pfeil, den wir Ihnen in den Schenkel geschossen hätten,“ fügte der Professor hinzu. „Mein Bruder Mahavira stand mit dem Bogen hinter den Dornbüschen. Jetzt aber genügt das Messer.“
Er plapperte das völlig gleichgültig vor sich hin. Sein ganzes Denken war nur von dem „einzig wahren“ Dschaina-Glauben und von dem goldenen Gongong erfüllt. Immer wieder hatte er in dieses Gespräch einzelne Bemerkungen über diesen zentnerschweren Teller von reinem Golde eingestreut.
Ich hüstelte jetzt. Harald verstand das Signal. Seine Hände fuhren blitzschnell nach vorn.
Er hatte Tompson bei den Armen gepackt, preßte sie dem schmächtigen Gelehrten an den Leib und hielt Tompson wie einen Schild halb erhoben in der Luft. Gleichzeitig rief er:
„Hinter das Gong, Schraut, – hinter das Gong.“
Ich hatte nur wenige Schritte zu machen. Dann war ich in Sicherheit. Auch Harst langte mit Tompson hinter der goldenen Schutzwand an, ohne daß ihm etwas zugestoßen wäre.
Kaum hatten wir uns hier geborgen, als auch schon von der Götzenstatue her, die auf einem Marmorpostament stand, ein wütender Aufschrei erfolgte. Dann flog irgend etwas gegen das Gong. Ein heller Ton erklang: ein langer, gefiederter Pfeil hatte den unteren Rand des Gongs getroffen.
„Man schießt nach unseren Beinen!“ rief Harst mir leise zu. „Es geht nicht anders. Es handelt sich um unser Leben.“
Er hatte mit der rechten Faust blitzartig zugeschlagen, hatte Tompsons Schläfe getroffen, riß dem Bewußtlosen nun das helle Gewand ab, ließ den Körper zur Erde gleiten und hing das Gewand so über dem Gongong auf, daß es bis auf den Boden reichte.
Diese Vorgänge spielten sich so schnell ab, daß ich gar nicht recht zur Besinnung kam.
Ebenso rasch hatte Harald eine der Pistolen in der Hand, feuerte nun auf gut Glück zwei Warnungsschüsse in die gegenüberliegende Wand.
„So – nun werden sie uns wohl in Ruhe lassen,“ meinte er, knotete meine Riemen auf und deutete auf den Professor.
„Binden!“ befahl er. „Es muß sein. Jede Rücksicht wäre hier ein Fehler –“
Die qualmenden Öllampen erhellten den Höhlentempel nur notdürftig. Die elektrische Taschenlampe, die Tompson in der Hand gehabt hatte, lag vor dem Gongong auf dem Boden und zog einen breiten, weißen Strich über das Steinmosaik hin.
Wir konnten hinter den Falten des Gewandes hervor alles beobachten, was in dem vorderen Teile des Raumes sich abspielte.
Auf den Wutschrei und den einen Pfeilschuß war bisher nichts weiter erfolgt. Jetzt aber vernahmen wir drüben hinter dem Postament ein wütendes Knurren.
„Man hat die Bulldogge geholt. Man wird sie auf uns hetzen. Es ist schade, das prächtige Tier zu erschießen –“
Harald raunte mir die Worte zu, warf sich gleichzeitig lang hin und hatte mit schnellem Griff den goldenen Klöppel erfaßt, dessen Kugel mit Leder mehrfach überzogen war.
Wie gut der Feind drüben aufpaßte, zeigte sich jetzt so recht. Kaum war Haralds Arm hinter dem Gongong aufgetaucht, als auch schon ein Pfeil haarscharf über seine Hand hinwegflog und gegen die Mauer prallte.
Jetzt hatte ich auch den Schützen gesehen. Er war hinter dem Götzen verborgen und hatte für einen Moment sein fahlbraunes Gesicht sehen lassen. Es war ein Greis mit langen verwilderten Bartzotteln.
Abermals knurrte die Dogge drohend. Man hörte drüben auch Flüstern und halblaute Rufe.
Dann schoß die so schwerfällig erscheinende, gedrungene Bulldogge in langen Sätzen heran.
Harald wartete mit zum Schlage erhobenem Klöppel.
Kurz aufheulend tauchte der Hund von links her auf, wollte Harst anspringen.
Ein einziger Schlag, der den breiten Schädel des Tieres traf, genügte.
„Binden!“ sagte Harst.
In demselben Augenblick kam Tompson zu sich, richtete sich halb auf.
Ein gurgelnder Schrei drang über seine Lippen. In seinen Augen loderte die Wut des Irrsinns. Er versuchte aufzustehen, aber Harald rief ihm drohend zu:
„Sitzen Sie still! Ich schieße sonst –“
Ich kniete neben der Dogge, schlang ihr den Riemen um die Beine.
Tompson beobachtete mich.
„Ist – ist Charlie tot?“ fragte er.
„Er lebt,“ erklärte Harald. „Man hetzte ihn auf uns.“
Tompsons Gesichtsausdruck änderte sich. Man merkte, wie sehr er den Hund liebte.
„Töten Sie ihn nicht,“ bat er fast weich. „Dschina liebt die Tiere –“
„Er wird am Leben bleiben. Er ist nur betäubt,“ sagte Harst.
Tompson lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und verhielt sich still.
5. Kapitel.
Auch drüben hinter dem Götzen und dem Postament regte sich nichts mehr.
„Eine ganz verwünschte Lage!“ flüsterte Harst mir zu. „Ich bin neugierig, was die Dschainas anstellen werden, um uns unschädlich zu machen.“
„Wie viele mögen es sein? Weshalb hast Du Tompson nicht danach gefragt?“
„Weil ein Irrsinniger doppelt leicht argwöhnisch wird. Hätte ich nach der Zahl seiner Brüder hier geforscht, wäre sicherlich in seinem kranken Hirn der Verdacht aufgezuckt, daß wir Arges im Schilde führen könnten.“
„Und was nun weiter? Wir stecken hier in einer bösen Patsche. Da hast Du ganz recht. Sobald wir uns hinter diesem goldenen Schild hervorwagen, haben wir mit einem der Giftpfeile zu rechnen.“
„Ja. Aber –“ Harst führte den Satz nicht zu Ende.
Ich hörte ein verdächtiges Rascheln. Ein Blick genügte dann, die Absichten der Leute drüben zu durchschauen.
Hinter dem Postament hervor war ein Bündel trockenes Reisig bis in die Mitte des Tempelraumes geflogen.
Ein zweites, ein drittes folgte.
„Ah – ausräuchern wollen sie uns!“ rief Harald.
Reisigbund auf Reisigbund folgte.
Ich hatte die Pistole in der Rechten.
„Schießen wir!“ meinte ich, nur um etwas zu sagen. Und ich dachte dabei an die dumpfe Ahnung irgend eines uns bedrohenden Unheils, die ich bereits in allen Nerven gespürt hatte, als wir noch in Mokris Hütte saßen. –
„Schießen? Worauf?!“ Harald zuckte die Achseln. „Ich weiß etwas Besseres, mein Alter. Wenn wir beide genug Kraft haben, den Dreifuß samt dem Gongong auf dem glatten Mosaikboden vorwärts zu schieben, dann werden wir den Dschaina-Brüdern den Spaß versalzen. – Versuchen wir’s mal.“
Ja – wir versuchten es. Wir gaben unser Letztes an Kraft her. Es war umsonst.
Mir lief der Schweiß in die Augen. Und von drüben flogen weitere Reisigbündel auf den bereits ziemlich hohen Haufen. –
Harst atmete keuchend. Seine Augen flogen hin und her.
„Es muß gelingen!“ preßte er zwischen den Zähnen hervor.
Dann:
„Ich hab’s!“ – Und er reckte sich an der Mauer hoch. Dort standen auf einem Sims zwei der kupfernen Öllampen.
Ein Pfeil klatschte gegen die Mauer. Harald goß das Öl der Lampen bereits auf den Boden, indem er das darüber hängende Gewand etwas lüftete. Die Ölflecke reichten fast bis zu dem Reisighaufen.
So schuf er eine schlüpfrige Gleitbahn für das zentnerschwere Gongong. –
Wir wiederholten den Versuch. Und – jetzt gelang es uns, den goldenen Schild vorwärtszuschieben, Schritt für Schritt.
Ein Wutgeschrei kam hinter dem Postament hervor. Wir hatten den Reisighaufen erreicht.
Da – eine Harzfackel flog brennend in das dürre Strauchwerk. Ein unheilverkündendes Knistern ertönte sofort.
Harald hatte sich schon gebückt, hatte zwei der Reisigbündel aufgerafft, hielt sie sich vor den Leib, war mit zwei Sätzen auf dem Postament und dicht vor dem Götzen.
Seiner Pistole blecherner, harter Knall dröhnte wie Gewitterrollen in dem Gewölbe wider. Dreimal feuerte er. Drei gellende Aufschreie waren der beste Beweis, daß er getroffen hatte.
„Ersticke das Feuer!“ rief er mir zu.
Ich riß das Gewand von dem Gongong, warf es über die züngelnde Glut, trat mit den Füßen die Flammen aus, die noch gierig emporlecken wollten.
Schwarzer Qualm schwamm unter der Decke des Höhlentempels. Brenzlicher Geruch erfüllte den Raum, in dem das heilige Gongong der Dschainas sein Versteck gefunden hatte. –
Harald stand neben mir.
„Hinter dem Postament führt eine Treppe in die Tiefe!“ sagte er. „Drei Dschainas sah ich, zwei Männer und ein Weib. Ich zielte auf ihre rechten Ellbogen. Getroffen habe ich – aber vielleicht nicht nur die Ellbogen. Die drei stürzten die Treppe hinab. Warte hier. Ich werde sehen, ob sie uns noch gefährlich werden können.“
Er nahm die elektrische Taschenlampe und verschwand hinter dem Postament.
Ich löschte auch noch die letzten glimmenden Reisigzweige aus und schaute mich nach Tompson um. Er war zu seinem Hunde hingekrochen, kniete neben der Bulldogge und – versuchte mit den Zähnen die Fesseln des Tieres zu lösen.
Als ich dicht vor ihm auftauchte, traf mich ein Blick, in dem eine ungeheure Wut flackerte. Er sagte jedoch nichts, sondern schob sich wieder bis an die Mauer hin und setzte sich.
Die Bulldogge machte verzweifelte Anstrengungen freizukommen. Der Schlag hatte ihr nicht viel anhaben können. Ich überzeugte mich, daß der Riemen noch unversehrt war. Dann folgte ich Harst, indem ich die Harzfackel an einer der Lampen anzündete.
Die Steintreppe machte drei Biegungen. Sie lief in einem gemauerten Schacht in die Tiefe. Ich bemerkte auf einzelnen Stufen Blutspuren.
So gelangte ich in die große Höhle, in der, wie wir nachher feststellten, seit der Preisgabe der alten Stadt Amber eine Anzahl Dschainapriester mit Weib und Kind in der Verborgenheit als Hüter des heiligen Gongong gehaust hatten.
Und Harst? – Ihn fand ich als Arzt am Lager des Greises, dessen Gesicht ich hinter dem Götzen einen Moment flüchtig gesehen hatte.
Der Greis war ohnmächtig. Die Kugel war in die Hüfte eingedrungen. – Auf zwei anderen Fellagern aber ruhten mit leicht gefesselten Armen ein jüngerer Mann und ein Weib, – alle drei mit denselben fahlbraunen Gesichtern. –
Morgens sechs Uhr war es jetzt.
„Geh’, mein Alter, schlage das goldene Gongong,“ sagte Harald. „Mokri wird es hören. Und die Töne, die nun plötzlich am Tage durch den Schacht an die Oberwelt dringen, werden ihm beweisen, daß wir die Seele der toten Stadt besiegt haben.“ –
Das heilige Gong der Dschainas dröhnte. Und den Klöppel führte ein Ungläubiger.
Es dröhnte, daß mir das Trommelfell zu bersten drohte. Die Dogge heulte. Professor Tompson kam herbeigekrochen. Seine Augen strahlten in religiöser Verzückung.
Dann erschien Harald. Wir schafften Tompson und den Hund oben in den Hof. Die Sonne beleuchtete mit ihren ersten Strahlen das kittgraue Gesicht des irrsinnigen Gelehrten.
Wir setzten uns auf den Brunnenrand und warteten.
„Mokri wird zu Lincoln eilen,“ meinte Harst. „Es ist klar: er kannte all diese Geheimnisse hier. Er verschwieg sie aus Angst vor dem Dschaina-Gift. Diese Furcht ist verständlich.“
Wir warteten drei volle Stunden. Dann sah Harald ein, daß er sich geirrt hatte. Mokri hatte das Gongong nicht gehört und war auch nicht zu Lincoln nach Dschaipur geeilt.
Wir fanden dann in der Turmruine ganz verdeckt von Schlingpflanzen, die Reste einer Treppe. Als wir die Höhe der Mauer erklommen hatten, sahen wir Mokri, den alten Brahmanen, unten am Fuße der Zypresse stehen. Harald winkte. Er kletterte zu uns nach oben.
„Sahib,“ sagte er ernst, „Du hast das goldene Gongong gefunden. Ich brauche nun nicht mehr zu schweigen. Der Dschaina-Tempel im alten Amber war der berühmteste Indiens. Ebenso berühmt war der Brahma-Tempel, dessen letzte Reste die Hütte sind, in der ich wohne. Genau wie die Dschainas das goldene Gongong hüteten, ebenso hüteten meine Eltern und Voreltern die Brahma-Statue, die ich in meiner Hütte verborgen halte. Fürst Dschai Singh, der die Bewohner Ambers nach Dschaipur schickte und die Stadt mordete, war heimlich ein Anbeter Buddhas geworden. Deshalb ließen die Dschainapriester das heilige Gongong verschwinden, deshalb wurde auch die Brahma-Statue von meinen Voreltern versteckt. – Sahib Tompson war mein Freund geworden. Ich habe ihn immer wieder gewarnt, genau wie ich Euch gewarnt habe. Aber die Goldgier hatte ihn verblendet. Er müsse das Gongong finden, koste es, was es wolle, sagte er stets zu mir. Dann ereilte ihn der Tod Dschinas, dann traf ihn einer der vergifteten Pfeile. Ich ahnte sein Schicksal. Zweimal in den letzten Jahren sah ich ihn, wie er dort unten im Hof hin und her ging. – Wozu sollte ich der Polizei mitteilen, wo er sich befand, Sahib? Er ist krank am Geiste. Er war glücklich in Gesellschaft seiner Brüder. Man hätte ihn doch nur in ein Irrenhaus eingesperrt.“
Die letzten Sätze klangen wie ein versteckter Vorwurf, daß wir es gewesen, die den Frieden der toten Stadt gestört hätten.
Harald schwieg dazu. Er schickte Mokri nach Dschaipur. Als der Alte verschwunden war, sagte er nachdenklich: „Wenn ich all dies vorher gewußt hätte, würde ich vielleicht nie diesen Geheimnissen nachgespürt haben. Daß hier Dschainas in der Verborgenheit lebten, ahnte ich schon in Mokris Hütte. Aber ich glaubte nur, daß Tompson von ihnen gefangen gehalten würde.“
Anderthalb Stunden später trafen Oberst Lincoln und mehrere Polizeibeamten ein. Man schaffte Tompson, den Hund und die drei verwundeten Dschainas nach Dschaipur. Der Maharadscha überwies das goldene Gongong dem großen Dschaina-Tempel in seiner Residenz. Dort steht es noch heute.
Die drei Dschainas genasen. Was aus Tompson und der Bulldogge wurde, berichte ich in der folgenden Erzählung.
Der Mann mit dem Papageien.
1. Kapitel.
Die schwarzen Perlen der Lady Blackmoore.
Oberst Lincoln warf sich ärgerlich in den Rohrsessel.
„Es ist eine ganz verdammte Geschichte, Master Harst,“ sagte er. „Entschuldigen Sie meine Aufregung. Aber natürlich bin ich nun daran schuld, daß Tompson mir ausgekniffen ist. Der Maharadscha machte ein Gesicht – ein Gesicht!“
„Erzählen Sie,“ meinte Harald.
„Die Geschichte ist mit ein paar Sätzen erledigt!“ begann der Oberst. „Sie wissen, ich sollte Tompson nach Agra in die Nervenklinik bringen. Dort, so hoffte der Maharadscha, würden die Herren Ärzte den alten Gelehrten geistig wieder zurechtflicken. Sie wissen weiter, daß wir heute früh mit dem 7-Uhr-Zuge abreisten, – 1. Klasse, reserviertes Abteil: der Professor, der aus Agra eingetroffene Assistenzarzt Doktor Blooce und ich. – Tompson war wieder ganz vernünftig, das heißt, er befand sich in jenem Zustand völliger Apathie, die ihn seit seiner Befreiung dauernd beherrscht hat. Wenn man mit ihm über das goldene Gongong oder die Dschainas sprach, lebte er etwas auf. Als wir in Bandikri anlangten, wo die Bahnlinie nach Alwar und Dehli abzweigt, schlenderte ich vor dem Zuge auf dem Bahnsteig auf und ab. Doktor Blooce stand am offenen Fenster unseres Abteils. Mit einem Male rief er mir zu:
„Der Professor ist verschwunden!“
Wir suchten den ganzen Zug ab, fragten alle Bahnbeamten. Ein Schaffner hatte Tompson wirklich bemerkt, wie er nach der anderen Seite hin den Zug verließ. Dort hatte ein Güterzug gestanden, war aber inzwischen nach Alwar zu abgedampft. Blooce und ich fuhren dem Güterzuge mit einer Motordraisine nach. Aber – Tompson war auch in diesem Zuge nicht. Wir waren mit unserer Kunst zu Ende. Blooce reiste weiter nach Dehli, und ich kehrte hier nach Dschaipur zurück. Vor einer Stunde bin ich eingetroffen. Das ist alles, Master Harst. Tompson ist uns regelrecht ausgerückt.“
„Und die Bulldogge?“
„Ach – an den Hund habe ich gar nicht gedacht. Der ist im Hundeabteil geblieben und daher längst in Agra – ohne seinen Herrn.“
„Wünscht der Maharadscha, daß wir Tompson suchen?“ fragte Harald.
„Wünschen? Nein. Er meinte nur, Sie würden es vielleicht von selbst tun, falls der Professor nicht irgendwo inzwischen aufgestöbert wird, was man hoffen kann.“
„Geistesgestörte sind häufig geradezu raffiniert schlau,“ erklärte Harst achselzuckend. „Ich fürchte, man wird Tompson nicht finden. – Übrigens – wo sind die sechs zahmen Papageien, die ihm der Maharadscha hier als Spielzeug aus seinen Tierhäusern überlassen hatte?“
„Richtig – die Papageien!“ rief Lincoln und schlug mit der Faust auf die Sessellehne. „Auch von diesen Viechern habe ich ganz vergessen. Der Versandkorb mit den Papageien ist ebenfalls weiter nach Agra gedampft. Eine ganz verfl… Geschichte! Ich werde nach Agra depeschieren, daß man den Hund und die Papageien vorläufig verpflegt!“
Er stand auf. „Ich werde die Depesche sofort absenden lassen. Auf Wiedersehen bei der Tafel, meine Herren. Wenn nur recht bald die Nachricht käme, daß man Tompson erwischt hat. Ich bin in dieser Beziehung hoffnungsvoller als Sie, Mr. Harst.“ –
Wir waren allein.
Harald blickte noch immer nach der Tür, durch die der Oberst verschwunden war.
„Ich habe mit dieser Flucht gerechnet,“ meinte er. „Das Dschaina-Gift tötet wohl das Interesse für die Umwelt, nicht aber die Intelligenz und die hervorstechenden Charaktermerkmale. Denke an diese meine Worte, mein Alter. Wir werden uns mit Tompson vielleicht noch mehr beschäftigen müssen, als uns lieb ist.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Warte ab. – Es ist auch Zeit, daß wir uns zum Souper umziehen.“ –
Lord und Lady Blackmoore, die seit gestern im Palast als Gäste wohnten, waren bei Tisch recht einsilbig und zerstreut gewesen. Ich hatte die blendend schöne Aristokratin unauffällig beobachtet. Lincoln war ihr Tischherr. Aber selbst seine glänzende Unterhaltungsgabe vermochte Lady Blackmoore nicht anzuregen. Sie saß meist versonnen da und tat sich offenbar nur Zwang an, wenn sie hin und wieder ein wenig lächelte.
Der Lord hatte mit dem Fürsten und Harst hauptsächlich über Haralds Erlebnisse als Liebhaberdetektiv gesprochen. Jetzt nach Tisch sah ich, wie er im Billardzimmer Harst bei Seite genommen hatte und eifrig mit ihm flüsterte.
Ich stand mit dem Privatsekretär des Lords, einem Master Tousam, in der offenen Tür des Billardzimmers.
Tousam war ein noch junger Mann von umfassender Bildung und angenehmen Umgangsformen. Er erzählte mir, daß Lord Blackmoore der reichste Kohlengrubenbesitzer Englands sei. – Ich wußte das alles bereits. Der Lord und die Lady befanden sich jetzt auf einer Reise um die Welt. Sie waren erst drei Jahre verheiratet, und Lord Percy wollte seiner jungen Frau alles an Schönheiten zeigen, was die Erde nur irgend bot.
Master Tousam sprach gerade von der Jacht „Atlanta“ des Lords, die im Hafen von Madras an der Ostküste Vorderindiens vorläufig vor Anker lag, als Harald mir verstohlen zuwinkte. Ich entschuldigte mich bei Tousam und schritt dann auf die beiden Herren zu, die inzwischen durch die andere Tür den breiten Flur betreten hatten.
„Master Schraut,“ sagte der Lord mit höflicher Verbeugung, „Ihr berühmter Freund Harst will so liebenswürdig sein und sich mit einer kleinen Angelegenheit beschäftigen, die ich als Gast des Maharadschas nicht gern an die Öffentlichkeit bringen möchte. Als meine Frau sich heute für das Souper ankleidete, vermißte sie eine Kette schwarzer Perlen, die bis dahin in ihrem Koffer in einem flachen Etui gelegen hatte. Wir haben sehr genau alles durchsucht. Die Perlenkette ist verschwunden. Ich kann noch immer nicht recht an einen Diebstahl glauben. Immerhin –“
Er zuckte die Achseln und fügte nach kurzer Pause hinzu:
„Schwarze Perlen sind eine Seltenheit. Die Perlenschnur war zwei Millionen wert. Das kann einen Dieb schon reizen. – Master Harst meint nun, es sei am besten, wenn ich Sie beide in aller Stille in den Wohnsalon meiner Frau führe. Sie können dort dann Ihre Nachforschungen ganz ungestört beginnen.“
Wir gingen den Flur entlang. Im ersten Stock öffnete der Lord eine der hohen Flügeltüren und brachte uns dann durch drei Gemächer in den kostbar eingerichteten Damensalon neben dem Schlafzimmer seiner Gattin.
„So, meine Herren,“ erklärte er und deutete auf ein Kofferungetüm, das in einer Ecke stand, „das ist der Koffer, aus dem die Kette verschwand. Meine Frau hat sie gestern morgen noch in der Hand gehabt und dann wieder weggeschlossen. Hier sind die beiden Schlüssel zu den Patentschlössern, hier der zu dem Etui. Dieses liegt ganz oben in dem Koffereinsatz.“
„Danke, Mylord,“ sagte Harald und nahm die Schlüssel in Empfang.
„Wir werden zusehen, was sich machen läßt.“
Der Lord reichte uns die Hand und zog sich zurück.
Wir waren allein. Harald rückte einen der Seidensessel an den Koffer heran, setzte sich und besichtigte die Schlüssel.
„Hm – feinste Patentschlösser, keine Dutzendware,“ meinte er. „Mit Nachschlüsseln ist da nichts zu machen.“
Er schloß den Koffer auf. Das schwarze Lederetui hatte ebenfalls ein Kunstschloß. Es war mit hellblauer Seide ausgefüttert.
Harald stand plötzlich auf und trat mit dem Etui unter die elektrische Krone.
„Merkwürdig!“ meinte er. „Sehr merkwürdig. Bitte – schau’ es Dir an.“
Ich tat es. Aber ich entdeckte nichts Merkwürdiges.
„Na?!“ fragte Harst. „Immerhin eine Spur, mein Alter, nicht wahr?“
Ich schwankte, was ich entgegnen sollte. Ich hätte sagen können: „Allerdings – eine Spur!“ Dann hätte ich gelogen und Harald hätte mir vielleicht schnell bewiesen, daß ich keine Ahnung hatte, um was für eine Spur es sich handelte.
„Ich sehe nichts,“ erklärte ich daher.
Harsts Augen waren ganz klein geworden. Er stierte auf die hellblaue Seide, riß mir plötzlich das Etui aus der Hand, klappte es zu und sagte:
„Vielleicht habe ich ebenfalls nichts gesehen.“
Sein Verhalten war mir unverständlich, zumal er jetzt das Etui wieder in den Koffer legte und diesen abschloß.
„Was soll das?“ fragte ich ein wenig gereizt. „Hast Du nun etwas entdeckt oder nicht?“
Er antwortete nicht. Er hatte seine Uhr hervorgeholt, sah auf das Zifferblatt und murmelte:
„Halb zwölf. Um 1 Uhr morgens geht der Schnellzug ab. – Ja – wir schaffen es noch!“
Er steckte die Uhr wieder weg.
„Lieber Alter, geh auf unsre Zimmer und packe unsre Sachen. Wir reisen nach anderthalb Stunden ab. Du wirst nachher noch Zeit haben, Dich von dem Fürsten und den anderen Herrschaften zu verabschieden. Der Maharadscha wird überrascht sein, daß wir so plötzlich Dschaipur verlassen. Ich werde ihm erklären, es hätte mir jemand einen diskreten Auftrag erteilt. Es stimmt ja auch. Lord Blackmoore tat es. Lege unsere Reiseanzüge zurecht und unser Handwerkzeug. Ich bin in fünfzehn Minuten bei Dir.“ –
Wir hatten in dem Schnellzug durch Oberst Lincolns Vermittlung noch ein Abteil 1. Klasse für uns bekommen. Lincoln hatte uns auf die Bahn begleitet.
„Was wird nun aus der Tompson-Sache, Mr. Harst?“ fragte er auf dem Bahnsteig kurz vor der Abfahrt.
„Das kann ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit vorhersagen,“ erwiderte Harald. „Es kann etwas ganz Großes werden, es kann auch eine Bagatelle bleiben.“
Lincoln schüttelte den Kopf.
„Bester Harst, was heißt das nun wieder?“
„Ich werde es Ihnen schreiben, Oberst,“ lächelte Harald. – Gleich darauf verließ der Zug den Bahnhof von Dschaipur in der Richtung nach Agra.
Wir machten es uns bequem. Harst lehnte den Oberkörper, nur mit einem bastseidenen Sporthemd bekleidet, in der einen Fensterecke.[5] Er hatte bis zuletzt einen in Papier gewickelten Gegenstand in der Hand gehabt, auf den er geradezu ängstlich aufpaßte. Als ich ihn fragte, was er denn so krampfhaft an sich drücke, hatte er gemeint: „Es ist die Spur, mein Alter.“
Jetzt riß er die Umhüllung ab. Darunter kam ein flacher Pappkarton zum Vorschein, und in dem Pappkarton lag das schwarze Lederetui der gestohlenen Perlenkette.
„Ah – also das ist’s!“ rief ich leise.
„Was sonst wohl?! – Da, schließe es in den einen Koffer ein.“
Kaum hatte er das letzte Wort ausgesprochen, als die Tür aufgeschoben wurde und ein Reisender bescheiden fragte, ob er hier noch Platz nehmen dürfe. Die anderen Abteile seien überfüllt.
Es war ein sehr dicker, blondbärtiger Europäer mit einem Handkoffer und einem dünnen Regenmantel über dem Arm, offenbar ein englischer Kaufmann aus einer Nachbarstadt.
„Eigentlich ist dies ein reserviertes Abteil,“ sagte Harald. „Trotzdem – wir haben nichts dagegen, daß Sie unser Abteil benutzen.“
Der Herr dankte und stellte sich als Kaufmann Morris aus Bandikur vor.
Wir sprachen unsere Namen wie immer absichtlich recht undeutlich aus. Morris hatte denn auch statt Harst „Smark“ und statt Schraut „Brout“ verstanden.
Er setzte sich in die eine Ecke an die Tür nach dem Gange zu. Ich hatte bei seinem Eintritt das Etui schnell unter unsere im Gepäcknetz liegenden Mäntel geschoben.
Morris vermutete in uns scheinbar Geschäftsreisende. Er begann eine Unterhaltung über die Abnahme des Opiumhandels in Indien und über die Versuche mit dem Anbau von kautschukliefernden Pflanzen.
Er wußte ganz interessant zu plaudern. Er klärte uns über die Güte des Rohkautschuks auf, zeigte uns aus seinem Handkoffer verschiedene Proben und gab uns darüber Aufschluß, wie man den Kautschuk aufs einfachste auf seine Güte prüfen könne. Von einem hellbraunen Stück schnitt er kleine Stückchen ab, kaute sie und setzte uns auseinander, wie die gekaute Masse nachher aussehen und wie sie schmecken müsse.
Er reichte uns jedem ein solches Stückchen. Die Sache war recht lehrreich. Wir prüften dann gleichfalls durch den Geschmack diesen hellbraunen Kautschuk, der stets der beste sein soll.
Nachher unterhielten wir uns über Agra, das Morris sehr genau kannte. Agra war ja unser Reiseziel.
Als wir müde wurden, streckten wir uns jeder halb auf den Polstern aus, nachdem wir die Lampe verdunkelt hatten, und schliefen auch sehr bald ein.
Mit einem Male rüttelte mich jemand recht kräftig. Es war ein Schaffner.
„Sahib, aussteigen, – Agra!“
Ich ermunterte mich nur sehr schwer. Auch bei Harald dauerte es eine ganze Weile, bevor er völlig wach war.
Wir riefen einen eingeborenen Gepäckträger herbei.
Plötzlich vermißte ich das Lederetui. Ich hatte es, als unser Reisegefährte eingeschlafen war, über mir in das Gepäcknetz gelegt und es in Zeitungen halb eingehüllt.
„Harald, das Etui ist weg!“ sagte ich erschrocken.
Er zog gerade seine Sportjacke über.
„So?! Na, das ist kein großes Unglück,“ meinte er.
„Ob etwa unser Reisegefährte –“
Harald ließ mich den Satz nicht beenden. Er blickte mich ernst an, vollendete:
„– Reisegefährte das Etui gestohlen hat? – Natürlich, lieber Alter. Wer sonst. Denke an die Kautschukprüfung. Der Kerl hat uns fein hineingelegt. Das, was wir kauten, enthielt irgend ein Teufelszeug von Schlafmittel. Wir sind beide kaum zu ermuntern gewesen, und die Glieder sind mir wie Blei.“ –
So begann unser Abenteuer mit dem Papageien-Manne; es begann verhältnismäßig harmlos. Der Ausgang war weniger harmlos.
2. Kapitel.
Wieder in Agra! – Seit zwei Jahren hatten wir diese sauberste aller indischen Großstädte nicht gesehen.
Weshalb wir gerade nach Agra gereist waren?
Ja – ich hatte Harst deshalb natürlich befragt. Ich wollte doch wissen, was eigentlich vorging.
Und er?! Er hatte geantwortet: „Warte ab! Wir stehen vielleicht vor der interessantesten Periode unseres Daseins.“
Unser Gepäck war in einem Mietwagen verstaut.
„Nach dem Hotel Royal!“ rief Harald dem Kutscher zu.
Ah – Royal! Hier hatten Blackmoores auch gewohnt! Harald hoffte wohl, hier in diesem Prachthotel die Spur weiter verfolgen zu können, die er in dem – Lederetui entdeckt hatte.
„Du glaubst, der Dieb ist Blackmoores von hier aus nach Dschaipur nachgereist?“ fragte ich Harald, als wir uns dem Hotel näherten.
„Ja und nein,“ erwiderte er. „So ganz einfach ist die Sache nicht. Ich sehe da selbst noch nicht klar.“
„Aber Du kennst den Dieb?“
„Du auch!“
„Wie – Tompson etwa?“ Ich kam wirklich auf niemand anders.
Der Wagen hielt bereits. So konnte Harald einer Antwort ausweichen.
Wir belegten zwei Zimmer im ersten Stock mit Aussicht auf den Dschamna-Fluß.
Harald telephonierte nach Bandikur an die Polizei und wollte Auskunft haben, ob es dort einen Kaufmann Morris gebe. – Nein, ein Morris existierte in Bandikur nicht.
„Ich wußte es ja,“ meinte Harst gleichmütig. „Dieser Morris war ein Genosse des Perlendiebes. Wir können von Glück sagen, daß der Mensch uns nicht ins Jenseits befördert hat. Ich gebe zu, ich hielt ihn wirklich für einen Kaufmann.“
Wir saßen im Lesesaal des Hotels. Dieser, zugleich Schreibzimmer für die Hotelgäste, war stark besetzt. Wir hatten noch ein Ecksofa leer gefunden und konnten von unseren Plätzen aus den weiten Raum bequem überblicken.
Rechts von uns saß ein dürrer Engländer mit rötlichem Spitzbart und schrieb an einem der kleinen Tische einen Brief. Der Mann interessierte mich, weil er ohne je nachzudenken, Blatt auf Blatt füllte. Er war nach uns erschienen, hinkte ein wenig und hatte einen Mund mit auffallend dünnen Lippen. – Links von uns wieder saßen zwei Amerikaner. Sie benahmen sich sehr ungeniert, unterhielten sich laut und rauchten aus kurzen Pfeifen einen süßlich duftenden Tabak.
Harald bat mich um Feuer für seine Zigarette.
„Wir werden uns noch ein zweites Quartier mieten,“ sagte er dann leise. Und nach kurzer Pause:
„Hm – es ist dieselbe Hand – und sie ist es auch wieder nicht.“
Ich wurde aufmerksam.
„Welche Hand?“ fragte ich.
Der dürre Engländer stand auf und hinkte langsam hinaus. Ich merkte, daß Harst ihm nachschaute.
Dann gewahrte ich noch mehr: Haralds Augen hafteten jetzt auf dem Tisch, den der Engländer soeben verlassen hatte.
Ich sah, daß auf der roten Schreibunterlage ein Brief lag. Und dieser Brief war schräg gegen das Tintenfaß gestützt.
„Es wäre in der Tat eine unglaubliche Frechheit,“ murmelte Harald und erhob sich, ging die drei Schritt bis zu jenem Tische und setzte sich auf den Schreibsessel. Zum Schein nahm er einen Briefbogen und schrieb ein paar Zeilen. Er tat es nur, um unauffällig den Brief zu sich stecken zu können.
Dann saß er wieder neben mir. Niemand hatte auf ihn geachtet. Er zeigte mir den Brief. Auf dem weißen Umschlag, der links oben den Stempel des Hotels trug, stand in einer steilen, schmucklosen Schrift:
Master Harald Harst,
Hotel Royal.
Harst schnitt den Umschlag auf. Einer der gestempelten Hotelbriefbogen befand sich darin. Und auf dem Bogen war folgendes zu lesen:
„Ich möchte Sie bitten, Agra noch heute zu verlassen. Eine Probe meiner Verwandlungsfähigkeit und Großmut haben Sie bereits erhalten. Ich hätte Sie in unserem Abteil erledigen können.
Um 11 Uhr geht ein Zug nach Dschaipur ab. Sie werden ihn benutzen. – Allan Morris.“
Ich hatte die wenigen Zeilen mitgelesen.
„Wahrhaftig – eine Frechheit!“ rief ich. „Eine doppelte Frechheit! Sich so in Deine Nähe zu wagen und einen solchen Wisch Dir auf solche Weise zuzustellen!“
„Die Hand – die Hand!“ meinte Harald sinnend. „Sie kam mir so bekannt vor. Nur daß die, die uns im Abteil des Zuges die Kautschukproben zeigte, so zart und so wenig muskulös war, während –“
Er schwieg. Er hatte den Briefbogen wie zufällig umgedreht. Es war kein gefalteter Briefbogen, sondern nur ein einzelnes Blatt. Und auf der Rückseite sah man oben rechts einen ganz schwachen Abdruck irgendeines Wortes. Es unterlag keinem Zweifel, daß Morris den oberen Teil der Rückseite aus Unachtsamkeit auf irgendeine frische oder doch noch nicht ganz trockene Schrift gedrückt hatte.
Es war kein vollständiges Wort. Selbst als Harald nachher durch allerlei Mittel die fehlenden Buchstaben zu ergründen suchte, gelang es ihm nicht, das Wort vollkommen sichtbar zu machen. Es blieben stets nur dieselben Buchstaben, die man allerdings als ein einziges Wort der Stellung der Buchstaben nach ansehen konnte:
Si om ra
Es fehlten zweifellos zwischen dem Si und om ein Buchstabe und ein zweiter zwischen om und ra.
Wir waren auf unsere Zimmer gegangen. Dort hatte Harald seine chemischen Künste an dem unvollständigen Abdruck versucht. Wir führten zu solchen und ähnlichen Zwecken allerlei Chemikalien und Apparate in unserem Requisitenkoffer mit uns.
„Vielleicht ist dieses „Si om ra“ der Teil einer Adresse,“ meinte Harst. „Ich sah, daß Morris einen Briefumschlag beschrieb und die fünf Bogen, die er vorher so in einem Zuge gefüllt hatte, hineinschob. Nachher schrieb er noch einen Umschlag aus. Und dies war der für mich bestimmte. Hätte ich ahnen können, daß ich ihn erhalten sollte! Gewiß, die schlanken, wohlgeformten Hände dieses Mannes waren mir aufgefallen. Aber trotz einer[6] gewissen Ähnlichkeit mit denen unseres Reisegefährten waren doch so kleine Verschiedenheiten vorhanden, daß ich meiner Sache nicht sicher war, besonders da ja Morris recht korpulent erschien und fast ein Pausbackengesicht hatte. Nun, wir wissen jetzt, daß er sich selbst als Verwandlungskünstler bezeichnet. Wir werden fernerhin auf der Hut vor ihm sein.“
„Und aus dem Si om ra vermagst Du nichts herauszulesen?“ fragte ich interessiert.
„Nein – nichts. – Es kann ja sowohl ein Personen- als auch ein Ortsname sein. Mit diesem unvollständigen Worte läßt sich nichts anfangen.“
Gleich darauf verließen wir das Hotel. In einer Seitenstraße kaufte Harst zwei billige Handkoffer, und in einem anderen Geschäft einige Wäschestücke und anderes, nur um die Koffer zu füllen.
So als neu eingetroffene Reisende ausgerüstet, suchten wir nach einer Privatpension und fanden auch am Flußufer ein in einem Garten stehendes Haus, an dessen Vorgartengitter ein Porzellanschild mit dem Aufdruck „Pension Kartglow“ hing.
Zu unserem Erstaunen lernten wir in der Besitzerin dieses Fremdenheims zweiten Ranges eine Landsmännin kennen. Wir logierten uns bei ihr als Kaufleute aus Kalkutta – Harper und Smith – ein, belegten zwei Zimmer in einem Anbau nach dem Flusse zu, aßen auf unserem gemeinsamen Wohnzimmer zu Abend und ruderten dann in dem zu dem Fremdenheim gehörigen Boot auf den Fluß hinaus.
Es war jetzt zehn Uhr geworden. Ich merkte, daß diese Bootfahrt durchaus kein harmloses Vergnügen sein sollte.
Es war noch nicht ganz dunkel. Ich erkannte jetzt am Ufer einen riesigen Gebäudekomplex, der von einer hohen Ziegelmauer eingeschlossen wurde.
Wir landeten nun an einem in den Fluß hinausgebauten Bootssteg, ketteten unser kleines Fahrzeug an und stiegen aus.
„Wohin geht’s?“ fragte ich, als Harald sich nun an das Holzgeländer lehnte und sein Zigarettenetui hervorholte.
Er deutete nach den Gebäuden hinüber und rieb sein Feuerzeug an.
„Das sieht ja wie ein Gefängnis aus,“ meinte ich.
„Was Ähnliches, mein Alter. Der Dieb ist Gefängniswärter.“
„Gefängniswärter? – Das kann doch nur ein Scherz sein,“ erklärte ich.
„Ein halber Scherz. Du wirst ja sehen, wo der Scherz aufhört und der Ernst beginnt. Es ist jetzt noch zu hell. Ich habe mich vorhin im Lesesaale des Royal in dem Reklameheft über Agras Sehenswürdigkeiten genau darüber orientiert, welche Bestimmung die einzelnen Gebäude dort haben. In dem Hefte war ein Lageplan dieses berühmten Gefängnisses enthalten. Unser Mann wohnt im Hochparterre des Hauses für die lebenslänglich Verurteilten, – für die hoffnungslosen Fälle, wenn ich mich genauer ausdrücken will.“
„Unser Mann? Der Dieb also?“
„Ja.“
„Und der Dieb hat Morris, seinen Helfershelfer, nach dem Hotel geschickt? – Übrigens – weshalb ließ der Dieb denn durch Morris das Etui stehlen?“
„Du fragst sehr viel auf einmal. Ob es sich wirklich um einen Helfershelfer handelt, ist sehr fraglich. Ich habe mir das wieder anders überlegt, da die Hände des Briefschreibers im Lesesaal nun als die des kautschukkundigen Reisegefährten einwandfrei festgestellt sind. Diese braunen, muskulösen Hände des dürren, rotbärtigen Morris waren genau die einer anderen Person, – das heißt, eines Mannes, dem wir anderswo begegnet sind. – Doch, wir wollen jetzt lieber beginnen. Es ist fast 11 Uhr.“
Er warf seinen Zigarettenrest ins Wasser. Nach zehn Minuten standen wir an der Nordseite der Ziegelmauer. Ich mußte mich an diese anlehnen. Harald kletterte mir auf die Schultern. Als er auf der Mauerkrone saß, half er mir hinauf.
Es war jetzt ganz dunkel geworden. Der Mond mußte aber sehr bald erscheinen. Wir schlichen dann durch die Wege eines sehr sauber gehaltenen Parkes. Die roten Ziegelbauten lagen in dem Parke verstreut. Nur das Hauptgebäude erhob sich dicht an der Westseite der Mauer.
Harald fand sich sehr gut zurecht. Vor einem langen zweistöckigen Hause machte er halt. An der einen Schmalseite hatte es eine Veranda mit Glasdach. Eine Treppe führte zu der Veranda hinauf. Von den unter dem Glasdach liegenden vier Fenstern waren zwei erleuchtet.
„Dort wohnt unser Mann,“ flüsterte Harst. „Wir wollen ihn besuchen. Vorläufig aber kein Geräusch! Ich möchte ihn beobachten –“
Wir hatten graue Leinenschuhe an. Wir gelangten auch lautlos an das eine Fenster. Erst jetzt sah ich, daß zwischen den Fenstern sich eine Tür befand und daß die Fenster selbst vergittert waren. Vom Parke aus war das der gestreiften Vorhänge wegen nicht zu erkennen gewesen.
Die Vorhänge schlossen nicht ganz. Wir konnten einen Teil des behaglich möblierten Zimmers bequem überblicken.
„Ah!“ murmelte Harald überrascht.
Allerdings: dieser Ausruf des Staunens war berechtigt. – Dort rechts neben einem mit Zeitschriften bedeckten Tische saß in einem Rohrsessel kein anderer als – Professor Tompson! Und dicht vor ihm stand ein großes, viereckiges Vogelbauer, in dem auf einer Stange sechs Papageien saßen, – dieselben Papageien, die der Maharadscha von Dschaipur dem Geisteskranken geschenkt hatte. Es waren Halsbandsittiche mit grasgrünem, bläulich, schwarz und rosenrot gestreiftem Gefieder. Sie gehörten also zu der in Indien am weitesten verbreiteten Papageienart. Aber sie waren sämtlich Sprechkünstler. Und, was sie dem armen Geisteskranken am wertvollsten machte, das waren die Worte, die sie zu plappern wußten, alles Worte, die irgendwie auf die Dschaina-Religion Bezug hatten. Der Wärter des Tierhauses des Maharadschas war ein Dschaina, und er hatte den Papageien diese besonderen Worte beigebracht.
„Das habe ich nicht erwartet,“ flüsterte Harald. „Nein – das nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll –“
Er hatte das letzte Wort kaum über die Lippen gebracht, als uns auf recht peinliche Weise klar gemacht wurde, was diese Überraschung für uns bedeutete.
Wir knieten vor dem Fenster und hatten infolge des Anblicks, der sich uns dort im Zimmer bot, kaum auf das geachtet, was in unserem Rücken sich abspielte.
Plötzlich flogen uns schwere, dicke Wolldecken über den Kopf. Gleichzeitig riß man uns nach hinten über. Es mußten mehrere Leute sein, die uns dann im Nu fesselten und fortschleppten. Doch nicht allzu weit brachte man uns. Man entfernte die Decken. Wir waren in einem Raume, den es in jeder Irrenanstalt gibt, in einer gepolsterten Zelle, in einer sogenannten Gummizelle.
Vor uns standen vier Männer. Drei davon waren Inder; der vierte war Dr. Daniel Blooce, der Assistenzarzt des Irrenhauses in Agra, gleichzeitig Assistent an der dortigen Nervenklinik.
Blooce winkte. Die drei Inder, die eine Art Uniform trugen, verschwanden und drückten die ebenfalls gepolsterte Tür hinter sich ins Schloß.
3. Kapitel.
Wir waren an Händen und Füßen gefesselt und dadurch wehrlos.
Nun begriff ich Haralds Andeutungen. Das, was er Gefängnis genannt hatte, war ein Irrenhaus. Und der Gefängniswärter war der Assistenzarzt Blooce, war – unser Mann, also der Dieb! –
Blooce hatte ein fahles, längliches Gesicht und trug eine Hornbrille mit etwas dunklen Gläsern. So, wie wir ihn jetzt sahen, hatten wir ihn in Dschaipur im Palast des Maharadschas kennen gelernt, wo er durch seine Bescheidenheit und seine Zurückhaltung angenehm aufgefallen war. Ich hatte mich häufiger mit ihm unterhalten. Er war stets liebenswürdig und voller Bewunderung für Harst gewesen. Gerade über Harald hatten wir sehr oft gesprochen. –
Daniel Blooce lächelte.
„Master Harst, Sie hätten auf meine Warnung hören sollen. Sie sind nicht um 11 Uhr abends abgereist, wie ich wünschte.“ Er sagte das in durchaus höflicher Weise. „Es tut mir leid, Ihnen nun einige Ungelegenheiten bereiten zu müssen. Dieses Gebäude untersteht nur meiner Aufsicht. Hier sind die gefährlichsten Geisteskranken untergebracht. In dieser Zelle wird Sie beide niemand finden. Ich kann Sie hier eingesperrt lassen, so lange ich will.“
Er machte eine Pause und lächelte stärker.
„Ich hätte Sie für klüger gehalten, Master Harst.“
Harald nickte völlig ernsthaft.
„Sie haben ganz recht, Master Blooce. Ich habe Fehler begangen. Ich ließ mich täuschen. Als ich das leere Etui der Perlenkette besichtigte und den feinen Lysolgeruch spürte, der dem Kästchen anhaftete, da dachte ich sofort an die Fingerwunde, die Sie der Zofe Lady Blackmoores verbunden hatten. Sie waren dieserhalb in dem Damensalon der Lady gewesen und konnten dabei Gelegenheit gehabt haben, Wachsabdrücke von den Patentschlüsseln zu nehmen. Außerdem sah ich auf der hellblauen Seide des Etuis auch eine ganz kleine Papageienflaumfeder, die an den Rändern grünlich gefärbt war. Die Feder konnte an Ihrem Anzug gehaftet haben und in das Kästchen gefallen sein. Sie waren ja Professor Tompsons Zimmergenosse!“
„Genau so sollten Sie kombinieren, Master Harst,“ erklärte Blooce mit gewissem Stolz.
„Weshalb sollte ich so kombinieren? Weshalb machten Sie es mir so leicht, gerade gegen Sie Verdacht zu schöpfen?“
„Um Ihnen zu beweisen, daß die Intelligenz eines harmlosen Irrenarztes über die des berühmten Verbrecherjägers zu triumphieren vermag.“
„Hm – ein etwas eigenartiges Spiel, Master Blooce. Jedenfalls: Sie haben die Perlenschnur gestohlen. Weshalb stahlen Sie nachher auch das Etui?“
Der Doktor lächelte wieder ironisch. „Aus demselben Grunde,“ erwiderte er.
„Und weshalb jetzt diese Überrumpelung, diese Freiheitsberaubung?“
„Auch aus demselben Grunde. Ich habe Sie beide hier erwartet. Ich wußte, daß Sie kommen würden. Tompson war ein gutes Mittel, Ihre Aufmerksamkeit abzulenken.“
„So haben Sie also Tompson absichtlich entkommen lassen?“
„Ja. Ich hatte mit ihm alles genau vereinbart. Wer ihn richtig zu nehmen weiß, erreicht alles von ihm.“
„Und das Ende dieses höchst merkwürdigen Geniestreichs, den Sie sich geleistet haben, Master Blooce?“
„Hängt von Ihnen ab, Master Harst.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Ich habe seit langem Ihre Kampfmethoden studiert – aus den Zeitungsberichten, Master Harst. Sie sind jetzt wieder bereits monatelang in Indien und haben recht bemerkenswerte Erfolge gehabt. Ich wollte Ihnen zeigen, daß Sie einem ebenbürtigen Gegner schnell unterliegen. Ich will das, was Sie Geniestreich nennen, bis zum letzten Akt, bis zur letzten Szene fortführen. Wenn Sie dann eingesehen haben, daß Sie der Besiegte sind, sollen Sie wieder frei sein. Die Welt wird Daniel Blooce als den preisen, der den großen Harst hineingelegt hat. Mehr will ich nicht. – Gewiß, ich werde wegen Freiheitsberaubung bestraft werden. Das nehme ich gern auf mich.“
„Und die Perlenschnur, Master Blooce?“
„Erhält Lady Blackmoore an demselben Tage zurück, an dem Sie beide erklären, daß Sie die Waffen strecken.“ –
Ich lauschte dieser Unterhaltung mit atemloser Spannung. Ich gewann schließlich die Überzeugung, daß dieser Daniel Blooce, den ich auf etwa dreißig Jahre schätzte, geistig nicht ganz normal sein müsse. –
„Sie wollen uns also vorläufig hier eingesperrt lassen?“ fragte Harst nun.
„Gewiß. Sie sind ja so oft Ihren Widersachern entflohen. Bitte – versuchen Sie es doch, von hier zu entweichen.“
Er höhnte. Er kam sich sehr schlau vor, dieser seltsame Arzt.
„In welcher Form sollen wir denn unsere Niederlage einräumen?“ meinte Harald.
„Hm, das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Jedenfalls so, daß alle Welt daran glauben muß, daß ich der Sieger bin. Zum Beispiel folgendes: Sie beide müßten mir ehrenwörtlich erklären, Indien in aller Stille zu verlassen und nach Ihrer Heimatstadt Berlin zurückzukehren. In Berlin aber müßten Sie eine Notiz über dieses Ihr Abenteuer mit einem Gentleman-Diebe, der gar kein Dieb ist, in die Zeitungen bringen.“
„So – so!“ meinte Harald. „Also das wäre so ungefähr die Bedingung, unter der wir freikämen. Eine große Blamage, Master Blooce, – eine sehr große Blamage!“
Der Doktor lachte laut auf. „Allerdings – die Blamage für Sie wird nicht klein sein! – Wann darf ich wieder mal anfragen, ob Sie die Niederlage zugeben wollen?“
„Eilt es so sehr damit? Haben Sie nur etwas Geduld, bester Blooce. Ein Harst ist doch nicht so leicht zu überzeugen, daß es für ihn kein Mauseloch zum Entschlüpfen gibt.“
Daniel Blooce hatte sein Gesicht schlecht in der Gewalt. Ich sah ihm die Enttäuschung deutlich an. Trotzdem lächelte er, freilich recht gezwungen.
„Na, langweilen Sie sich hier nicht!“ meinte er, machte kehrt und verließ die kleine Zelle. Er stieß die Tür jedoch sofort wieder auf und rief: „Halt – da hätte ich jetzt beinahe eine Dummheit gemacht,“ und begann unsere Taschen zu entleeren. Unsere Pistolen, Taschenlampen, Messer und Feuerzeuge nahm er mit.
Er betastete aber unsere Anzüge sehr sorgfältig, ob wir nicht irgendwo eine Waffe oder dergleichen versteckt hatten. Dann erst ging er wieder.
Die Zelle war vollständig leer. Auch der Fußboden war gepolstert. An der Decke brannte eine Glühbirne. Auch nicht ein Möbelstück befand sich hier.
Da – die Glühbirne erlosch. Wir waren im Finstern.
„Gut – knoten wir uns gegenseitig die Stricke auf,“ meinte Harst. „Damit rechnet Blooce wohl sicher. Dann legen wir uns hin und schlafen.“
„Wirklich eine nette Blamage für uns!“ sagte ich ärgerlich. „Dieser Doktor ist doch fraglos selbst geistesgestört. So handelt doch kein vernünftiger Mensch.“
Harald flüsterte zu meinem Erstaunen:
„Du irrst. Die Blamage ist nicht auf unserer Seite, mein Alter. Ich sprach vorhin nur im allgemeinen von einer großen Blamage. Daß Blooce das auf mich bezog, war ebenfalls ein Fehler. Ebenfalls! Er hatte nämlich mehrere gemacht. Geistesgestört ist er nicht. Aber auch kein Genie. Der Anfang der Komödie war gut. Er hat mich wirklich getäuscht. Er wollte uns nach Agra locken und hier in seine Gewalt bekommen. Das ist ihm auch gelungen. Aber nun werde ich Dir die Stricke lösen. Rücken an Rücken, lieber Alter. Blooce wird sich wundern!“
Das war eine Drohung, dieser letzte Satz. Und Harald hat sie dann auch zur Tat werden lassen. –
Blooce und die drei Inder betraten nach wenigen Stunden die Zelle. Die Glühbirne an der Decke war vorher wieder aufgeflammt.
Wir ermunterten uns schnell, blieben sitzen und freuten uns, mit welch ängstlichem Mißtrauen Blooce und seine Leibgarde uns betrachteten. Sie fürchteten wohl von unserer Seite irgend eine Teufelei. – Blooce fragte, ob wir uns schon überlegt hätten, wie wir aus der Zelle herauskommen könnten.
„Daß es aus einem solchen Raum zu entweichen recht schwer ist, darüber sind wir uns klar,“ erwiderte Harald. „Wir wollen dieser Geschichte ein Ende machen, Master Blooce. Lassen Sie uns in Ruhe einen Vertrag entwerfen. Unser Wort darauf, daß wir in diese Zelle zurückkehren, falls wir nicht einig werden. Ich habe Appetit auf eine Zigarette und eine Tasse Kaffee.“
Der Doktor fragte erst noch dies und jenes, um ja nicht überlistet zu werden. Dann gingen wir in sein Studierzimmer hinüber. Es lag auf demselben Flur und es war dasselbe, in dem wir Professor Tompson und die Papageien erblickt hatten. Beide waren jetzt nicht mehr da, weder der geistesgestörte Gelehrte noch der Käfig.
Wir setzten uns an den Tisch. Blooce brachte Papier, Tinte und Feder. Die drei Inder, offenbar die Irrenwärter dieses Hauses, standen als Wache dabei.
Harald rauchte und schrieb, nachdem er mit Blooce sich mündlich geeinigt hatte. Dann las er den „Vertrag“ vor. Es war eine merkwürdige Urkunde. Sie wurde in zwei Exemplaren, eins für jede Partei, ausgestellt. – Ich habe beide Exemplare in unserer Raritätensammlung. – Der Vertrag lautete:
„Harald Harst und Max Schraut verpflichten sich, Indien zu verlassen, nachdem sie noch eine Angelegenheit erledigt haben, die mit dem Diebstahl des Perlenhalsbandes nichts zu tun hat, wie Harald Harst hiermit versichert. Sie verlassen Indien dann auf kürzestem Wege, ohne den Diebstahl und die Freiheitsberaubung zur Anzeige zu bringen und ohne mit dem Maharadscha von Dschaipur oder dem Ehepaare Blackmoore noch zusammenzutreffen, in einer Verkleidung, reisen nach Berlin und veröffentlichen hier in den Zeitungen ihr Erlebnis mit Doktor Daniel Blooce. Dieser wieder verpflichtet sich, das Perlenhalsband Lady Blackmoore an demselben Tage zuzustellen, an dem Harald Harst ihm telegraphisch von dem Abreisehafen seine Abfahrt aus Indien mitteilt.“
Der Vertrag enthielt also verschiedene kleine Änderungen, die auf Harsts Wunsch hineingebracht waren.
Nachdem der Vertrag unterschrieben war, bewirtete Blooce uns noch mit Kaffee. Wir unterhielten uns ganz zwanglos.
Um 7 Uhr morgens verließen wir die Irrenanstalt. Blooce begleitete uns bis zu einer Nebenpforte der Mauer und ließ uns hinaus. Er streckte Harald die Hand zum Abschied hin. Doch der übersah sie, meinte sehr förmlich: „Ihre Scherze sind nicht nach meinem Geschmack, Master Blooce.“ –
4. Kapitel.
Als wir uns eine Strecke entfernt hatten, konnte ich meine Neugier nicht länger bezähmen.
„Du hast Blooce mit dem Vertrag hineingelegt, nicht wahr?“ fragte ich. „Weshalb nahmst Du aber noch den Kaffee an, wenn Du Blooce –“
Harald unterbrach mich. „Nachdenken, mein Alter, nachdenken! Blooce hatte es sehr eilig, mit uns den Vertrag abzuschließen. Der Mensch dünkt sich klug und ist ungeheuer dumm. Nach dem Vertrage ist uns ganz allgemein gestattet, vor unserer Abreise noch etwas zu erledigen. Blooce ahnt nicht, daß es mir gerade auf diesen Zusatz ankam. Du wirst sehen, wie wichtig er ist.“
„Handelt es sich bei dieser „Erledigung“ um den Professor?“ meinte ich unsicher.
„Das wird sich erst herausstellen. – Wir wollen aber schneller gehen. Hoffentlich ist unser Boot noch da.“
Wir fanden es an dem Holzstege so vor, wie wir es zurückgelassen hatten, stiegen ein und ruderten flußaufwärts der Stadt zu. Nachher beglichen wir unsere Rechnung in dem Fremdenheim. Mit unseren neuen Handkoffern fuhren wir zum Bahnhof und gaben sie dort an der Handgepäckaufbewahrungsstelle ab. Um ½9 vormittags waren wir wieder im Hotel Royal. Harst verlangte unsere Rechnung. Dann begab er sich allein in die Stadt. Er wollte ein Auto mieten, wie er mir erklärte. „Blooce läßt uns von zwei Kerlen beobachten,“ sagte er. „Diese Aufpasser müssen wir loswerden. Das können wir am besten mit Hilfe eines Kraftwagens. Ich werde diesen nach dem Bahnhof bestellen. Wir begeben uns dorthin, und Blooces Spione werden denken, wir wollen einen Zug benutzen. Dann steigen wir schnell ein und entwischen mit dem Auto.“ –
Alles klappte vorzüglich. Mit einem Wagen fuhren wir zum Bahnhof. Der Chauffeur und der Wagenführer waren genau instruiert. Wir gingen in den Wartesaal. Inzwischen wurden unsere Koffer auf das Auto verladen. Die beiden Spione, zwei besser gekleidete Inder, betraten gleich nach uns den Wartesaal. Sie benahmen sich im ganzen recht geschickt. Wir aßen eine Kleinigkeit, verließen das Bahnhofsgebäude wieder und stiegen ohne Hast in den Kraftwagen, der sofort davonrollte. Wir schauten uns nicht um. Erst vor der über die Dschamna führenden Brücke suchten wir festzustellen, ob ein anderes Auto uns folgte. Es war nicht der Fall. Der Chauffeur war allerdings auch zuerst absichtlich kreuz und quer durch die Stadt gefahren.
Als wir die Brücke passiert hatten, bog das Auto von der Hauptstraße ab. Auf Umwegen kamen wir so nach dem Dorfe Sikandra.
Das Auto hielt außerhalb des Dorfes vor dem Bungalow eines Engländers namens Pawell, der früher Polizeidirektor in Agra gewesen war. – Wir trafen Mr. Pawell beim Frühstück an. Er war ebenso überrascht wie erfreut, Harald Harst in seinem Heim begrüßen zu dürfen. Harst erklärte, daß wir um Unterkunft für ein paar Tage bäten. „Wir sind hinter Verbrechern her, Mr. Pawell. Daß Sie hier wohnen, erfuhr ich von dem Autoverleiher. Ich nahm an, Sie würden uns gern unterstützen. Wir müssen hier aber als alte Bekannte von Ihnen gelten.“ –
Harald begann nun unser Abenteuer mit Doktor Blooce zu erzählen.
Pawell war sprachlos.
„Dieser Blooce ist verrückt,“ meinte er. „Ein normaler Mensch kommt nicht auf solche Streiche. Man stelle sich vor: nur um von sich reden zu machen, begeht er zum Schein einen Diebstahl und sperrt zwei Leute wie Sie und Ihren Freund ein! Das sind die Taten eines Wahnsinnigen.“
Harald schüttelte lächelnd den Kopf. „Sie irren, Master Pawell. Das sind die Taten eines raffinierten Verbrechers! Gestatten Sie, daß ich Ihnen meine Ansicht über Blooce entwickle. – Blooce stiehlt die Perlenschnur. Er bringt es fertig, einen Koffer mit zwei Patentschlössern zu öffnen. Wie er das gemacht hat, ist gleichgültig. Jedenfalls: es gelingt ihm! Und es gelingt ihm weiter, mich dorthin zu locken, wo er mich haben wollte: auf die zu seiner Wohnung gehörige Veranda! Jeden Schachzug in diesem Spiel hat er genau berechnet. Er will mir scheinbar seine geistige Überlegenheit beweisen. Er spielt den Amateurverbrecher, den Verwandlungskünstler. Er reist mit uns im selben Abteil, verschwindet mit dem Etui. Er setzt sich in unsere Nähe in den Lesesaal und läßt eine Art Drohbrief zurück. All das soll mir zeigen: er hat es darauf abgesehen, durch die spätere Veröffentlichung dieser Einzelheiten mich[7] zu blamieren! – Fraglos, er operierte sehr geschickt. Erst in der Zelle der Irrenanstalt begannen seine Fehler. Der erste Fehler war, daß er verlangte, wir sollten als Besiegte Indien verlassen und erst in Berlin unsere für uns so „beschämenden“ Abenteuer veröffentlichen. Als er diese Bedingungen uns nannte, wurde ich stutzig. Das, was mir schon vorher aufgefallen war und meinen Verdacht erregt hatte, nämlich Daniel Blooces verbrecherische Fähigkeiten, das heißt der Diebstahl der Perlenkette und seine Fertigkeit im Verwandeln seines Äußeren, schätzte ich nun ganz anders ein. Sekunden genügten mir, seine wahren Absichten zu durchschauen. Daß ich mit dieser neuen Vermutung recht hatte, bewies mir sein frühzeitiges Erscheinen in unserer Zelle. Ihm lag daran, uns sozusagen auszuschalten. Mit einem Wort: Blooce ist in der Tat ein großer Verbrecher! Ihm kam es darauf an, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er stahl die Perlen und wollte uns beide gleichzeitig zwingen, Indien zu verlassen, weil er eben hier in Agra in allernächster Zeit ein – zweites Verbrechen vorhat. Und diesen neuen Coup wollte und will er nicht durch uns gefährdet sehen. Er ahnt nicht, daß ich seine geheimsten Gedanken erraten habe. Er war einverstanden, daß ich hier noch vor meiner Abreise „etwas“ erledigen durfte, nur sollte dies nicht mit dem Perlendiebstahl zusammenhängen. Er glaubt, uns völlig eingewickelt zu haben. Er triumphiert und hofft, ganz ungestört den zweiten Coup in Angriff nehmen zu können. Und dieser neue Coup ist eben das „etwas“, das ich hier noch besorgen darf. Ich werde es gründlich besorgen.“
Polizeidirektor Pawell wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. „Lieber Master Harst, wenn Sie sich da nur nicht auf dem Holzwege befinden! Blooce, ein geriebener Verbrecher?! Nein, das kann ich nicht annehmen. Wozu hat er denn zum Beispiel den Professor laufen lassen? Wie erklären Sie sich dies?“
„Das kann ich noch nicht erklären, Master Pawell. Noch nicht. Aber ich werde auch das feststellen. Jedenfalls: Blooce will den Professor irgendwie mit bei seinen dunklen Plänen benutzen.“
Harald holte jetzt Doktor Blooces Drohbrief hervor und zeigte Pawell den Tintenabdruck auf der Rückseite.
„Dieses Si om ra,“ sagte er, „konnte ich zunächst nicht deuten. In der verflossenen Nacht habe ich über dieses Wort angestrengt nachgedacht. Und ich gelangte auch zu einer Lösung. Das om ist nur infolge flüchtiger Schrift als om zu lesen. Es soll richtig „an“ heißen. Also Si an ra. Und das ergibt, wenn man k und d einfügt, Sikandra.“
„Ah – sehr richtig!“ rief Pawell. „Das leuchtet mir ein. Und dieses Sikandra wegen sind Sie auch gerade hier zu mir gekommen.“
Harst nickte. „Vielleicht hat Blooce hier Helfershelfer. An einen dieser Leute kann er einen Brief gesandt haben. In Agra hat er ja bestimmt drei zuverlässige Genossen. Es sind dies die Wärter der Abteilung des Irrenhauses, die Blooce unterstellt ist. Das wissen wir mit aller Bestimmtheit. – Bedenken Sie, Master Pawell: diese drei Leute hätten sich doch auf diesen „Scherz“ kaum eingelassen, wenn sie nicht mit dem Doktor schon seit langem sehr vertraut wären. Und – bedenken Sie weiter. Seit einem Jahr sind in Agra etwa acht größere Hoteldiebstähle ausgeführt worden, wie mir der Direktor des Royal zu erzählen wußte. – Zweifeln Sie noch immer, daß Blooce das ist, wofür ich ihn halte?“
Pawell war aufgesprungen.
„Sie verstehen es, einen zu überzeugen, Master Harst. Sie rücken allmählich mit Ihrem Belastungsmaterial heraus. Mir ist soeben auch eingefallen, daß ich Blooce hier häufiger gesehen habe. Ich kenne ihn persönlich. Alle Europäer in Agra und Umgegend kennen sich. Was ihn jedoch hierher geführt hat, weiß ich nicht. Mein Diener Tomar ist jedoch im ganzen Dorfe bekannt. Er ist verschwiegen. Auch meine übrigen Leute plaudern nichts aus. – Kommen Sie, wir werden Tomar fragen.“
Der Inder Tomar war ein alter Mann wie sein Herr. Auch er hatte Blooce in Sikandra sehr oft bemerkt. Er sann eine Weile nach und behauptete dann, Blooce verkehre hier in Sikandra lediglich mit einem einzigen Manne, mit dem Chinesen Tschi Song, der am anderen Ufer des Sees eine kleine Mohnplantage besitze und Opiumhändler sei.
Harald fragte Tomar sehr genau nach diesem Tschi Song aus. Der Chinese sollte nur Landsleute, also ebenfalls Chinesen, als Diener und Arbeiter beschäftigen.
Mittlerweile war es 11 Uhr vormittags geworden. Harst wollte sich des Chinesen Besitzung aus der Nähe ansehen. Wir verließen den Bungalow Powells um 12 Uhr als ärmliche Inder und schritten dem Dorfe zu. Sikandra hat eine kleine Villenvorstadt. Der ganze Ort ist sauber und liegt landschaftlich sehr schön. Wir gingen dann um den See herum und näherten uns durch die Felder dem Hause des Chinesen, das recht stattlich wirkte.
Harald meinte, wir müßten unbedingt diesen Tschi Song von Angesicht zu Angesicht vor uns haben. „Wir werden von vorn den Garten betreten und fragen, ob wir nicht Arbeit erhalten könnten. Ich will wissen, was mit diesem Gelben los ist.“
Ein dicker Chinese trat uns im Vorgarten entgegen. Harald fragte nach Tschi Song. Der Dicke musterte uns mißtrauisch.
„Mein Herr ist verreist,“ erklärte er in genau so miserablem Englisch, wie Harst es hier angewandt hatte.
„Ich bringe eine wichtige Nachricht,“ flüsterte Harald darauf.
Der Dicke war offenbar überzeugt, echte Inder vor sich zu haben.
„Ich bin Tschi Songs Vertrauter,“ flüsterte er. „Sage mir alles. Mein Herr kommt erst morgen wieder hierher.“
„Ist er bei dem Doktor?“
Der Dicke fiel auch hierauf hinein.
„Ja. – Wer bist Du aber? So sprich doch.“
Der Chinese winkte und watschelte uns voran ins Haus, führte uns rechts von der großen Diele in seines Herrn Arbeitszimmer und deutete auf ein paar Stühle.
Wir setzten uns. Das Zimmer war ganz europäisch eingerichtet. Rechts vor dem einen Fenster stand ein großer Diplomatenschreibtisch.
„Nun?“ fragte der Dicke.
Harst zeigte hier wieder einmal, wie fein er Leute aushorchen konnte.
„Die beiden sind in einem Auto davongefahren,“ sagte er leise.
Der Dicke nickte. „Ja. Deshalb ist auch Tschi Song nach Agra geeilt. Der Doktor telefonierte uns vor zwei Stunden. – Wer schickt Euch? So rede doch endlich.“
„Ich weiß nicht, ob ich Dir gegenüber offen sein darf. Wir sind aus Dschaipur.“
„Dann hat Euch Dschei Meng geschickt. Ihr seht, ich weiß Bescheid.“
„Die Polizei hat Tompsons Fährte bis Agra verfolgt. Ihr sollt vorsichtig sein. Das andere werde ich nur Deinem Herrn mitteilen. Es ist zu gefährlich.“
Der Chinese grinste. „Tompson wird niemand finden. Er ist hier versteckt. Die Papageien sind auch hier. Abends um 8 Uhr reist er ab, falls wir wieder Glück haben.“
„Gut. Dann werden wir Deinen Herrn in Agra suchen. Dschei Meng läßt noch sagen, daß Ihr nicht mehr das Telephon benutzen sollt. Es wird jetzt jedes Gespräch überwacht. Soll ich Tschi Song noch etwas von Dir ausrichten?“
„Nein. Nur, daß der eine Papagei gestorben ist. Ich habe aber schon einen anderen besorgt. Ich werde um 8 Uhr pünktlich auf dem Bahnhof sein. Tompson ist ruhig und gehorsam wie bisher.“
Dann verabschiedeten wir uns. Draußen auf dem Wege zum Dorfe sagte Harst:
„Dieser Dicke hat das Pulver nicht erfunden. Zum Glück. Der Kerl hat mehr verraten, als ich je zu hoffen wagte. Wir müssen schleunigst nach Agra. Dort geht etwas vor. Du hörtest ja, wie dieser gelbe Halunke erklärte, daß Tompson diesen Abend abreisen soll, falls „wir wieder Glück haben,“ und das kann doch nur bedeuten: es wird noch heute in Agra der zweite Coup ausgeführt!“ –
Polizeidirektor Pawells Ponywagen brachte uns dann sofort bis zur Eisenbahnbrücke dicht vor Agra. Von hier setzten wir den Weg zu Fuß fort. Wir begaben uns in das Polizeigebäude, wo wir nach einigen Schwierigkeiten den Detektivinspektor Plomber allein sprechen konnten.
Harst teilte Plomber lediglich mit, daß wir Doktor Blooce für einen Verbrecher hielten und daß wir genau wüßten, es solle heute hier in Agra ein Diebstahl oder dergleichen verübt werden. – „Einzelheiten darf ich vorläufig nicht erwähnen,“ fügte Harald hinzu. „Es liegen besondere Umstände vor, die mich zum Schweigen zwingen. Ich wollte Sie nur bitten, Doktor Blooce beobachten zu lassen. Verwenden Sie aber dazu Ihre geschicktesten Leute. Es handelt sich hier um eine weitverzweigte Verbrecherbande.“
Plomber versprach alles zu tun, was er nur irgend könnte. Harald traf mit ihm noch allerlei Verabredungen für gewisse Fälle. Dann verließen die beiden ärmlichen Inder wieder das Polizeigebäude. –
Schweigend schritten wir durch die jetzt um 4 Uhr nachmittags schon recht belebten Straßen. Das eigentliche Verkehrsleben erwacht in den Städten Indiens zumeist erst um 6 Uhr. Ich war gespannt, was Harald tun würde. – Wir langten vor dem Hotel Royal an, umschritten das freistehende, von einem Park umgebene Gebäude und betraten es durch den Seiteneingang für das Personal.
Harald schickte einen Kellner zu dem Hoteldirektor. Wir hätten dem Direktor eine wichtige Bestellung auszurichten. Der elegante Direktor kam und schnauzte uns grob an. Er vermutete irgend eine freche Bettelei. Harald flüsterte ihm zu: „Verraten Sie uns nicht. Ich bin Harald Harst –“
Der Name genügte. Der Direktor benahm sich sehr gewandt. Wir saßen dann in seinem Zimmer im Seitenanbau, wo er seine Wohnung hatte.
Harald fragte, ob im Royal zur Zeit reiche Leute logierten. – Der Direktor nannte zwei amerikanische Multimillionäre namens Hamborn und Knox. – Ob in einem der anderen Hotels gleichfalls so wohlhabende Ausländer abgestiegen seien, wollte Harst weiter wissen. – Nein, das reiche Reisepublikum bevorzuge stets das Royal.
„Es sind bei Ihnen im letzten Jahre mehrere Diebstähle vorgekommen,“ sagte Harst darauf.
„Ja. Leider. Wir haben den Schaden stets ersetzt, um den Ruf des Hotels nicht zu schädigen. Im ganzen waren es fünf Diebstähle, die hier bei uns ausgeführt wurden. Der Täter konnte nicht ermittelt werden.“
„Etwas anderes, Herr Direktor. – Verkehrt Doktor Daniel Blooce viel bei Ihnen?“
Der Hoteldirektor lächelte. „Sehr viel, Master Harst. Doktor Blooce hat wie jeder Mensch seine Schrullen. Er spielt hier bei uns gelegentlich den Detektiv. Wir sind befreundet. Er hat bereits drei Diebstähle verhütet und die Diebe verjagt. Jetzt, wo Frau Hamborn mit ihrem berühmten Brillantenarmband hier wohnt, macht er Ihnen als Liebhaberdetektiv wieder Konkurrenz, Master Harst.“
„So – so! Ganz interessant. Seit wann hat der Doktor denn diese Schrulle?“
„Hm – so ungefähr seit einem Jahr.“
„Merkwürdig!“ sagte Harald und lächelte nun seinerseits ironisch.
Der Direktor wurde stutzig. „Master Harst, trauen Sie Blooce nicht?“ fragte er schnell.
„Nicht ganz. – Ich möchte Sie bitten, Blooce gegenüber sich nichts anmerken zu lassen. Kommt er heute hierher?“
„Ja. Gewöhnlich speist er um 6 Uhr im großen Speisesaal. Zuweilen erscheint er verkleidet. Er versteht es tadellos, sich zu verändern. Ich erkenne ihn niemals, wenn er eine Maske angelegt hat. Er ist dick, dünn, groß, klein, bucklig, lahm – ganz wie er will.“
„Wollen Sie bitte eine zuverlässige Person nach Sikandra zu Polizeidirektor Pawell schicken. Hier ist ein Zettel für Pawell. Ich möchte unseren Koffer Nr. 2 sofort zur Verfügung haben. Wenn der Bote ein Auto benutzt, kann er in einer Stunde zurück sein. Die Kosten trage ich. – Dürfen wir hier bei Ihnen bis dahin bleiben und uns nachher hier auch umziehen?“
„Gewiß, Master Harst. Wenn Sie sich nebenan in mein Schlafzimmer setzen wollen. Dort werden Sie nicht gestört. – Es wäre ja geradezu toll, wenn etwa Doktor Blooce diese fünf Diebstähle verübt hätte. Jetzt, wo Sie mich auf Blooce aufmerksam gemacht haben, will mir so manches –“
„Unser Koffer!“ rief Harald mahnend.
Der Direktor eilte davon. Wir riegelten uns in seinem Schlafzimmer ein. Gleich daneben befand sich eine kleine Badestube. Wir wuschen uns die braune Farbe ab und saßen dann als „weiße“ Inder in den schmierigen Leinenkitteln auf dem Rohrsofa gegenüber dem Fußende des Bettes.
„Dieser Blooce!“ meinte Harald. „Ein netter Konkurrent von uns! Jedenfalls ein geriebener Schurke. Natürlich hat er es auf das Brillantarmband abgesehen. Es ist wirklich berühmt. Es besteht aus 12 sehr großen wasserklaren Brillanten. Hamborn soll dafür einem Pariser Juwelier rund eine Million bezahlt haben. Der Fischzug lohnt also für Blooce. Ich bin nur gespannt, wie er es stehlen wird. Wir werden ihn es ruhig stehlen lassen. Ich möchte eben auch diese Perlenkette Lady Blackmoores zurückhaben. So ungefähr ahne ich auch schon, wer sie verbirgt: der Mann mit den Papageien, also Professor Tompson.“
5. Kapitel.
Unser Koffer kam erst um ½6 an. Inzwischen hatte der Hoteldirektor uns einige Erfrischungen gebracht und sich gleichzeitig entschuldigt, daß er sich jetzt nicht mehr um uns kümmern könne. Das Diner beginne bald, und da sei er unabkömmlich.
Wir kleideten uns um, wurden zwei ältere, graubärtige Herren vom Typ der reisenden Amerikaner.
Genau um 6 Uhr waren wir mit dieser bis ins kleinste sorgfältig durchgeführten Maske fertig. Wir steckten unsere Pistolen zu uns, ebenso unser sonstiges Handwerkzeug. Als „echte“ Amerikaner stopften wir uns zwei kurze Holzpfeifen. Harst hatte seine Pfeife gerade in Brand gesetzt, als es klopfte. Ich fragte, wer draußen sei.
„Blenkock!“ – Das war der Name des Direktors.
Ich schob den Riegel zurück.
Es war nicht Blenkock, sondern eine schlanke, blonde Dame in weißem Leinenkleid. Sie trat schnell ein, drückte die Tür zu.
Plötzlich hob sie beide Arme. Und in jeder Hand funkelte ein kleiner Revolver.
„Hände hoch!“ befahl sie so energisch, daß ich unwillkürlich gehorchte.
Harst zögerte wohl. Da – ein dünner Knall, und Haralds Tabakspfeife, die er in der herunterhängenden Linken gehalten hatte, wurde ihm aus den Fingern gerissen.
Auch er sah nun ein, daß diese Blondine nicht mit sich spaßen ließ; auch er stand genau so wehrlos da wie ich, die Arme artig hochgereckt.
Die Dame, die stark gepudert war und ein ganz interessantes Gesicht hatte, lachte leise auf.
„Mir gegenüber ist alles zwecklos, Master Harst,“ sagte sie mit heller Stimme, die wirklich frauenhaft klang. „Ich habe sowohl von der Bewachung der Anstalt durch die Polizei als auch von Ihrem Erscheinen als Inder rechtzeitig Kenntnis erhalten. Ich habe gute Augen. Als ich die Anstalt verließ, ahnten die Beamten nicht, daß Doktor Blooce so nett als Miß aussehen kann. Um ½6 war ich bereits hier im Hotel, gerade als Ihr Koffer kam. Der gute Blenkock flüsterte so geheimnisvoll mit dem Hoteldiener und dem Chauffeur des Autos. Da witterte ich – dicke Luft! – So, nun bin ich doch Sieger, Master Harst, wenn Sie mich auch mit dem Vertrag überlistet haben. Sie werden jetzt Ihren Freund Schraut fesseln. Reißen Sie Streifen von der Decke dort ab. Ich warne Sie aber. Ich schieße nie vorbei. Genau so gut wie ich den Pfeifenkopf vorhin traf, werde ich auch Ihren Kopf treffen. – Also vorwärts –“
Harald mußte gehorchen. Ihm blieb nichts anderes übrig. Dann mußte er Blooce ein paar Streifen der Decke zuwerfen. Der Doktor fertigte daraus mit einer Hand eine Schlinge und legte sie mir über den Kopf. Auch Harald mußte den seinen hineinstecken. Blooce zog die Schlinge so scharf zu, daß wir ihm beide nun nicht mehr gefährlich werden konnten. Gleich darauf hatte Blooce uns noch fester umschnürt. Er befahl Harald nun, mich in das kleine Badezimmer zu zerren. Dicht daneben befand sich der Elektromotor, der die Ventilatoren des Hotels in Bewegung setzte und der so viel Lärm machte, daß unsere Hilferufe umsonst sein mußten. Blooce drehte dann noch die Brause und die Wasserleitungshähne auf schloß die Tür von außen ab und ließ uns allein.
Er hatte uns sehr raffiniert aneinander gefesselt. Die Streifen der starken Leinendecke waren außerordentlich haltbar. Harald hatte nur die Beine frei. All unsere Anstrengungen, uns frei zu machen, scheiterten daran, daß wir Rücken an Rücken standen und daß uns die Hände auf der Brust festgeschnürt waren.
Harald hatte mich wieder bis an die Tür des Badezimmers gezerrt und versucht, die untere Türfüllung mit dem Fuß einzutreten. Dann wollten wir in das Schlafzimmer kriechen und von da durch ein Fenster ins Freie.
Die Tür war zu stark. Sie widerstand. Inzwischen war das Wasser bereits etwa handhoch gestiegen.
„Warten wir,“ meinte Harst. „Ich werde mich ausruhen. Dann soll die Tür doch daran glauben.“
Ich mußte mich nach einer Weile bücken, so daß Harald halb auf meinem Rücken lag. So konnte er nun mit beiden Füßen zugleich die Tür bearbeiten. Er nahm jetzt die obere, größere Füllung in Angriff. Schon der dritte Stoß ließ sie herausfliegen.
„Sieg!“ rief Harald. „Nun ins Schlafzimmer!“
Wir gelangten auch hinein, ebenso in des Direktors Arbeitszimmer. Hier lag auf einem Rauchtischchen ein indischer Dolch. Harst bekam ihn zwischen die Finger. Noch ein paar Minuten und wir waren frei.
„So,“ meinte Harst, „jetzt in den Speisesaal! Dort wird –“
Die Tür flog auf. Der Direktor stürmte herein.
„Master Harst, – das Armband ist gestohlen!“ keuchte er ganz verzweifelt. „Ein unerhört frecher Streich! Frau Hamborn hatte sich allein auf ihre Zimmer begeben. Als sie den Fahrstuhl benutzen wollte und oben wartete, kam eine andere Dame, warf ihr blitzschnell Schnupftabak in die Augen und entriß ihr das Armband, die Ohrringe und den Brillantanhänger –“ –
Zehn Minuten später waren wir in Doktor Blooces Wohnung. Inspektor Plomber begleitete uns. Auf dem Schreibtisch lag ein Zettel:
„Master Harst! Sie werden weder die Perlen noch die Brillanten je wiederfinden! – Ich grüße Sie als – Sieger und als Ihr Konkurrent Doktor Daniel Blooce.“
Es war jetzt genau ½8 Uhr.
„Nach dem Bahnhof!“ befahl Harst. – Wir bestiegen das Polizeiauto. In einer Seitenstraße vor dem Bahnhof hielt der geschlossene Kraftwagen an. Plomber mußte hier warten. Wir gingen und lösten am Schalter zwei Fahrkarten nach Dschaipur. Nur zum Schein. Um 8 Uhr 10 Minuten sollte ein Zug in dieser Richtung abgehen. Wir trugen noch unsere Verkleidung. Auf dem Bahnsteig waren bereits eine große Menge Reisende versammelt. Wir schritten hastig auf und ab, ohne uns – scheinbar! – um irgend jemand zu kümmern Auf Haralds Geheiß sprachen wir sehr lebhaft miteinander, taten ganz so, als ob uns der Diebstahl des Armbandes sehr erregte.
Wir suchten auf diese Weise nach dem dicken Chinesen und nach Professor Tompson.
„Keine Spur von den beiden,“ sagte ich jetzt zu Harald, als wir am Ende des Bahnsteigs wieder kehrt machten.
„Ein Irrtum, mein Alter,“ erwiderte er. „Sie sind beide da –“
„Wo denn? Tompson ist doch nicht zu übersehen.“
„Vielleicht doch –“ –
Der Zug lief ein. Es erhob sich das übliche Geschrei und Gedränge vor den Wagen dritter Klasse.
Wir stellten uns vor ein Abteil 1. Klasse und warteten.
„Sie sind eingestiegen,“ sagte Harald nach einer Weile. „Sie fühlen sich ganz sicher. So – jetzt blüht unser Weizen.“
Harald winkte zwei Indern in Schaffneruniform. Es waren Polizeibeamte. Sie schritten hinter uns her. Vor einem Abteil 3ter ließ Harald seine Zigarette fallen. Wir gingen noch ein Stück weiter.
„Alles aussteigen!“ befahl der eine Beamte den in jenem Abteil Sitzenden. „Dieser Wagen bleibt hier. Hinten wird ein anderer angehängt.“
Die farbigen Reisenden beeilten sich, das Abteil zu verlassen. Als letzte stiegen ein alter Inder und eine verschleierte Inderin aus. Der Alte trug einen großen, viereckigen Korb, der mit einer Decke behängt war.
Harst war mit einem Sprung neben der Frau, riß ihr den Schleier weg. Ein braunes Gesicht kam zum Vorschein. Aber – es war Doktor Blooces Gesicht!
Die Polizeibeamten packten den Doktor. Handschellen schnappten zu. Dann wandte Harst sich an den alten Inder, sagte plötzlich:
„Herr Professor, Sie werden mir gutwillig folgen. Doktor Blooce ist ein Verbrecher. Sie haben doch die Brillanten bei sich, nicht wahr?“
Tompson stieß plötzlich ein tierisches Wutgebrüll aus und wollte sich auf Harst stürzen. Inzwischen war Inspektor Plomber mit drei weiteren Beamten erschienen. Tompson wurde festgehalten.
Blooce in seinen Weiberkleidern stand hohnlächelnd dabei.
„Suchen Sie nur recht sorgfältig nach der Beute,“ meinte er zu Harald. „Sie werden sie nie entdecken, so wahr ich Daniel Blooce heiße!“
Harst nahm das Tuch von dem großen Korbe weg. Es zeigte sich, daß der Korb ein Papageienbauer aus Weidengeflecht war. In dem Korbe saßen 18 Halsbandsittiche. – „Es ist gut,“ sagte Harald. „Im Bahnbureau wird sich das weitere finden – nämlich die Beute.“
Blooce behielt seine hohnvolle Siegesgewißheit bei. Man durchsuchte ihn und Tompson mit aller Geduld. Inspektor Plomber beteiligte sich daran. Dann erklärte er enttäuscht: „Nichts, Master Harst, – nichts! Vielleicht haben die beiden aber die Perlen und Diamanten verschluckt.“
„Nein, das glaube ich nicht,“ meinte Harst. „Ich wette, die Perlen wurden aus Dschaipur mit Hilfe von Tieren hinausgeschafft. Halsbandsittiche haben kropfartige Erweiterungen in der Speiseröhre. Diese Kropfsäcke kann man wie beim Geflügel aufschneiden und wieder zunähen. Man kann also in einem Papageienkopf ganz gut kleine Beutelchen mit Perlen unterbringen.“
Er öffnete das Bauer und holte einen Halsbandsittich heraus, befühlte dessen Hals und fügte hinzu: „Master Plomber, dieses Versteck hat den Vorzug der Neuheit. Ich wäre vielleicht nicht darauf gekommen, wenn der dicke Chinese heute nicht erzählt hätte, einer der Papageien sei eingegangen, und er hätte dafür sofort einen anderen besorgt. Dieser selbe Chinese hat den Professor und den Käfig hier nach Agra gebracht. Es sind jetzt 18 Papageien. Sechs dürften die Perlen tragen, die übrigen die Brillanten. – Nun, Daniel Blooce, wie steht es mit Ihrem Siege?“
Blooce schwieg und starrte zu Boden. – Die Perlen und Brillanten wurden so wieder herbeigeschafft. Die Untersuchung gegen den Doktor, den Chinesen Tschi Song und die anderen mittlerweile gleichfalls verhafteten Helfershelfer der beiden ergab das Bestehen einer wohlorganisierten Diebesbande, die weit über Agra hinaus ihre Raubzüge ausgedehnt hatte.
Professor Tompson wurde nach einem Jahre durch Hypnose völlig geheilt. Er ist jetzt kein begeisterter Dschaina mehr, nur noch begeisterter Botaniker.
Daniel Blooce brach zwei Tage nach seiner Verhaftung aus dem Gefängnis aus. Und wieder zwei Tage später war Detektivinspektor Plomber jenem rätselhaften Morde zum Opfer gefallen, den ich im nächsten Band unter dem Titel schildern will:
Verlagswerbung:
|
Wir gestatten uns, alle Freunde der Harald Harst-Erzählungen darauf hinzuweisen, daß weitere Harst-Abenteuer in Kabels Kriminalbücher erschienen sind. Sie tragen die Titel: |
||
|
Harst-Bände aus der Serie |
||
|
Band |
13: |
Der Klub der Toten. |
|
In den vorstehenden Bänden werden eine Anzahl der besten und spannendsten Abenteuer Harald Harsts veröffentlicht. Wir können die Freunde unserer „Detektiv“-Erzählungen nur raten, sich diese Bände zu besorgen. Preis des 96 Seiten starken Bandes nur 40 Pfennige. Die vorstehenden Bände aus „Kabels Kriminalbücher“ sind durch jede Buchhandlung zu beziehen, bei Voreinsendung des Betrages (zuzüglich 5 Pfg. für Porto) liefert dieselben auch der Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26, Elisabethufer 44. |
||
Anmerkungen:
- ↑ Hefttitel auf der Umschlagseite: „Das goldene Gonggong“.
- ↑ „Dschainatempel“ / „Dschaina-Tempel“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Dschaina-Tempel“ geändert.
- ↑ In der Vorlage steht „Klementpistole“. Zwei Vorkommen geändert.
- ↑ In der Vorlage steht: „werden“.
- ↑ Der Satz ergibt so keinen richtigen Sinn. Entweder: „Harst lehnte mit dem Oberkörper, nur mit einem bastseidenen Sporthemd bekleidet, in der einen Fensterecke.“ Oder: „Harst lehnte den Oberkörper, nur mit einem bastseidenen Sporthemd bekleidet, in die eine Fensterecke.“
- ↑ In der Vorlage steht: „eier“.
- ↑ In der Vorlage steht: „dich“.
