Hauptmenü
Sie sind hier
Der Tote im Fahrstuhl
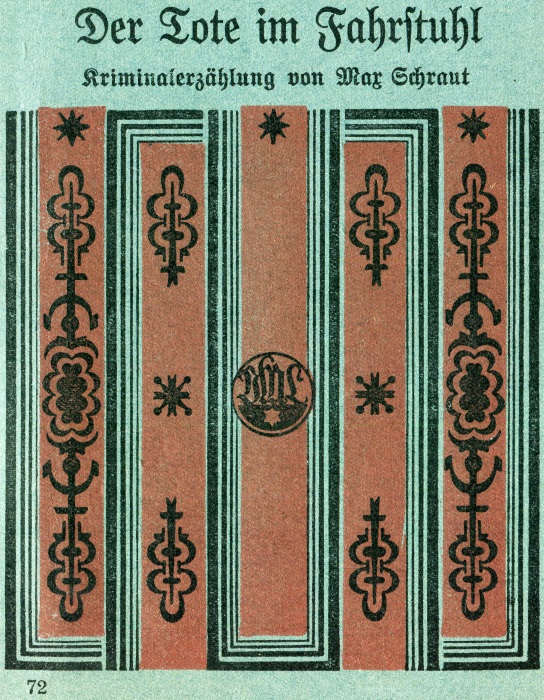

Harald Harst
Aus meinem Leben
Band: 72
Der Tote im Fahrstuhl
Erzählt von
Max Schraut
Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.
Berlin SO 36, Elisabethufer 44
Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26. – 1922.
Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin
1. Kapitel.
Graf Balder Baltholm schrieb an Harald Harst am 8. September folgendes:
Malmö in Schweden, 8. Sept. 19…
Kungsgatan 12.
Mein lieber und sehr verehrter Herr Harst!
Sie werden sich wundern, daß heute bereits ein Schreiben von mir eintrifft, nachdem ich erst vorgestern Ihnen über unser Leben und Ergehen ausführlich berichtet habe.
Es muß also schon eine besondere Veranlassung sein, die mich so schnell wieder an den Schreibtisch zwingt. Diese Veranlassung ist ein Brief meines Freundes Toornward aus Berlin. Baron Hilmar Toornward, seines Zeichens Arzt, weilt jetzt in Berlin. Er ist sonst in Stockholm ansässig und Assistent an der Stockholmer Universitätsklinik, dabei ein sehr lebenslustiger, frischer Junggeselle, der vielleicht zu sehr den Spruch beherzigt: „Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.“ Dies – eben die Beherzigung der launigen Verse, wird ihm um so leichter, als er ein hübscher, liebenswürdiger Mensch und sehr reich ist.
In seinem letzten Briefe schrieb er mir:
„Man erlebt hier in Berlin manchmal Dinge, besonders wenn man, wie ich letztens, etwas angeheitert nachts heimkehrt.
Ich muß Dir diese Geschichte erzählen. So sonderbar sie ist: den größten Teil davon muß ich mir wohl eingebildet haben! Nur der kleinere Teil ließ sich als Tatsache oder Tatsachen nachkontrollieren.
Höre also. – Ich kam am 22. August nachts gegen ein Uhr heim, nachdem ich in angenehmer Gesellschaft sieben Flaschen Sekt und diverse Liköre mir geleistet hatte. Von den sieben Flaschen Schampus habe ich selbst vielleicht drei getrunken. – Ich kam per Auto heim. Ich wohne hier im Berliner Westen, allerfeinste Gegend, Berlin WW nennt man das. Die Straße heißt sehr bescheiden Neue Bleibtreustraße. Ich habe hier im dritten Stock Vorderhaus von einer Witwe, die den Sommer über im Gebirge weilt, deren Fünfzimmerwohnung gemietet, die recht elegant eingerichtet ist. Mein alter Diener Braek – Du kennst ihn ja! – betreut mich.
Ich kam also heim. Es war eine regnerische Nacht, außerdem ziemlich kühl. Mir bereitete es einige Schwierigkeiten, das Schlüsselloch der Haustür zu finden. Dieselbe Sache wiederholte sich bei der bronzierten Gittertür des Fahrstuhls.
So – und nun geht es los, lieber Balder, nämlich der Teufelsspuk, den die Geister des Schampus mir vorzauberten.
Der Fahrstuhl hatte sich oben befunden. Ich hatte auf den Knopf gedrückt. Er kam herunter – so hübsch langsam, mit Sausen und Brummen. Ich stieg ein, schloß die Türen, fuhr zum dritten Stock empor, stieg aus, landete glücklich in meinem Schlafzimmer, wo ich auf den Diwan sank.
Ob ich hier nun eingeschlafen bin, weiß ich nicht genau.
Jedenfalls: ich glaubte wach zu sein, saß auf dem Diwan und vermißte meinen Stock mit der dicken goldenen Krücke, jenes Erbstück, das stets der älteste Baron Toornward zu tragen pflegt.
Ich stand also wieder auf (oder ich träumte es) und ging wieder in das Treppenhaus, denn ich sagte mir, der Stock sei im Fahrstuhl geblieben.
Der Fahrstuhl war unten. Ich drückte den Knopf, und er kam empor.
Als ich hörte, wie er sich in Bewegung setzte, hörte ich noch etwas anderes, oder, wie gesagt, ich habe all das nur geträumt. Ich hörte also von unten durchs das Treppenhaus das Zuschlagen einer schweren Tür, dann einen Aufschrei. Nun hielt der Fahrstuhl. Ich öffnete die Gittertür, öffnete die inneren Flügeltüren und taumelte zurück. (Das heißt: ich mag auch auf dem Diwan gelegen und mein Hirn mag mir das vorgegaukelt haben!)
Ich taumelte zurück, denn – auf der Fahrstuhlbank lag in der Ecke mit herabhängenden Armen und einem Strick um den Hals ein gutgekleideter bartloser Mann ohne Hut – mit blaurotem, aufgedunsenem Gesicht – scheußlich mit einem Wort!
Du kennst ja nun die Einrichtung der Fahrstühle. Bei dem, um den es sich hier handelt, haben die Türen starke Federn, so daß sowohl die Außengittertür als auch die Innenflügeltür von selbst zuschlagen.
So geschah es auch hier.
Und – so wurde mir der Anblick des Toten (denn der Mann war tot dem ganzen Aussehen nach) wieder entzogen.
Ich hatte mich vor Schreck auf eine Treppenstufe gesetzt.
Da – der Fahrstuhl glitt nach unten.
„Merkwürdig!“ dachte ich und horchte, wo er wohl halt machen würde. Man kann das ja der Dauer des Sausens und Brummens nach ungefähr feststellen.
Nun, meines Erachtens fuhr er bis ins Erdgeschoß.
Dann (glaubte ich?!) wurde unten die Fahrstuhltür geöffnet. So ein Treppenhaus leitet bei nächtlicher Stille die Geräusche wie ein Rohr weiter.
Ich hörte auch noch das Zufallen einer anderen Tür – unten irgendwo.
Mit einem Male rüttelte mich jemand. Es war eine verschleierte Dame, die mir mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Ich sah sie nur ganz undeutlich. Ich saß oder besser ich lag halb vor meiner Flurtür, mit dem Rücken an die Treppenstufen gestützt.
Die Dame schaltete die Lampe aus und eilte die Treppen hinab. Es war dunkel ringsum. Ich schämte mich, erhob mich, betrat meine Wohnung, deren Tür weit offenstand, und setzte mich wieder auf den Diwan. –
Dann rüttelte mich abermals jemand. Ich lag auf dem Diwan, und Braek sagte:
„Herr Baron, ich werde Ihnen helfen. Sie können hier doch nicht im Mantel und angezogen die ganze Nacht liegen!“
Er half mir also beim Ausziehen. Ich schämte mich vor Braek, der mich so vorwurfsvoll ansah.
Als ich im Bett lag, sagte ich:
„Braek, ich habe meinen Stock im Fahrstuhl liegen lassen.“ (Und dies ist alles Tatsache, von dem Moment an, wo Braek mich schlafend auf dem Diwan fand.)
Er ging hinaus und kam sehr bald zurück. Mein Erlebnis (oder Traum), wie ich den Toten im Fahrstuhl vor mir gesehen, war so lebendig in mir, daß ich Braek entgegenrief:
„War der Mann noch im Fahrstuhl?“
„Nein, Herr Baron. Aber der Stock und Ihr Hut waren dort.“
Und er legte beides auf den Diwan und fügte brummend hinzu: „Was für ein Mann, Herr Baron?!“
Da schämte ich mich noch mehr.
„Ich habe das geträumt, Braek. Gute Nacht.“
Er zog sich zurück. Meine Müdigkeit war wie weggeblasen. Ich stand wieder auf, kleidete mich notdürftig an und ging in das Treppenhaus.
Der Morgen graute. Ich hatte mir meine kleine Taschenlampe eingesteckt. Ich wollte feststellen, ob ich nicht im Fahrstuhl irgend etwas finden könnte, das mir Gewißheit gäbe, ob der Tote ein Traumgebilde gewesen.
Der Fahrstuhl war oben im vierten Stock. Ich drückte. Er kam und machte vor mir halt. Dann betrat ich den Fahrstuhlkasten, leuchtete unter die Bank, hob den kleinen Teppich auf.
Nichts – nichts! – Aber ich war hartnäckig.
Ich schüttelte den Teppich. Da fiel etwas auf den Boden.
Rate was? – Du rätst es nie. Du wirst an einen Kragenknopf, eine Lockenadel, eine Stecknadel oder dergleichen denken.
Es war ein Glasstückchen, und zwar ein Stück eines Kneiferglases, wie mir nachher der eine Rand und der Schliff verrieten, – ein etwa sichelförmiges Stückchen, zwei Zentimeter lang, mit etwa ein halb Zentimeter größter Breite.
Das war alles, was ich fand. Mir fiel ein, daß der Tote (in meinem Traume?) einen Kneifer auf der Nase gehabt hatte – einen Kneifer ohne Fassung mit Goldsteg.
Ich starrte sinnend auf das Stückchen Glas in meiner flachen Hand. Die Bruchfläche glitzerte im Lichte der Glühbirne des Fahrstuhls. Und – meine Blicke, die bisher mehr in mein Inneres geschaut und mitgeholfen hatten, in mir selbst nach der Wahrheit zu forschen, – diese Blicke waren unbewußt über die Hand hinweggeglitten und hafteten nun ebenso unbewußt auf einem winzigen Gegenstand, der etwa in der Mitte der Polsterbank nach der Wand zu auf dem roten Plüschbezug lag.
Ein winziger Gegenstand – etwas Weißes, wie eine kleine Bohne.
Da erwachte abermals mit aller Stärke der Wunsch nach Klarheit in mir. Ich beugte mich hinab, hob das winzige Etwas auf. Es war keine Bohne. Nein – es war ein abgesprungener Fingernagel, die Spitze eines langen, wohlgepflegten, lackierten Fingernagels!
Der Nagel war so zierlich, daß mein nächster Gedanke ihn an eine zart parfümierte Frauenhand zauberte.
Zart parfümiert! – Ja, lieber Balder, man hat mitunter so Einfälle. – Zart parfümiert?! „Vielleicht,“ dachte ich, „vielleicht gehört der abgebrochene Fingernagel jenem verschleierten Weibe, das ich auf dem Treppenabsatz meines Stockwerks gesehen hatte, nein, – zu sehen geglaubt hatte, – nein, das ist Unsinn: ein Traumgebilde[1] läßt keinen Fingernagel im Fahrstuhl zurück, wenn man es im Treppenhause gesehen hat! –“ –“
Der Schluß des Briefes meines Freundes ist für Sie, verehrtester Herr Harst, und für die Beurteilung dieser meines Erachtens etwas merkwürdigen Geschichte ohne Bedeutung.
Ich weiß nicht, ob Sie meiner Meinung sind, Herr Harst, und ob Sie, lediglich aus dem Inhalt von Hilmars Brief, wie ich annehmen, daß der Baron damals tatsächlich einen Toten gesehen hat, den man heimlich aus dem Hause wegschaffen wollte oder besser weggeschafft hat.
Ich verbleibe mit Gruß Ihr dankbarer
Balder Baltholm.
2. Kapitel.
Harald hatte mir in seinem Studierzimmer diesen Brief am 12. September abends sieben Uhr vorgelesen, legte ihn nun weg, griff nach einer seiner Mirakulum-Zigaretten und blickte dabei durch das offene Fenster auf die stille Blücherstraße hinaus, in der das Harstsche altehrwürdige Familienhaus liegt.
Seine Stirn, hinter der vielleicht jetzt schon der schärfste Geist an dem Fall Toornward arbeitete, den je ein Detektiv besessen, – diese hohe, kluge Stirn begann sich in jene drei Falten zu legen, die für Haralds Zustand angestrengtester Denkfähigkeit so charakteristisch sind.
Dann wandte er den Kopf, schaute mich an und sagte:
„Wenn es wirklich ein Wink wäre, wo jener Mann, den die Zeitungsschreiber auf der Flucht ins Ausland vermuten, geblieben, dann – dann könnte man hier von einem seltenen Zufall sprechen!“
Ich verstand seine Andeutung sofort. „Meinst Du etwa den Kommerzienrat Niendorf?“ fragte ich.
Er kramte in den auf dem Tische liegenden Zeitungen und erwiderte: „Ja, den meine ich! – Ah – hier ist das Blatt vom 28. August. Ich hatte es hier in die Mappe gelegt. Hier kann man lesen:
Der Kommerzienrat Peter Niendorf, der bekanntlich seine chemische Fabrik letztens an einen Ausländer verkauft hat und den Staat dabei gehörig betrogen haben soll, indem er die Kaufsumme viel zu gering angab, wird seit dem 20. August vermißt. An diesem Tage entfernte er sich früh morgens aus seiner Villa zu dem gewöhnlichen Morgenspaziergang. Seitdem ist er verschwunden. Der letzte, der ihn am 20. sah, war wie bereits festgestellt, ein Bankangestellter namens Pittner, der ihn um 9 Uhr vormittags in der Musketierstraße, bekanntlich einer der verrufensten Gassen von Berlin NO, vor einer Kellertür bemerkt haben will, aus der Niendorf, scheu sich umblickend, auf der Straße erschien –“
Harald legte die Zeitung weg.
„Am 22. August erlebt der Baron Toornward seinen Traum,“ sagte er und nickte mir bedeutungsvoll zu. „Zwei Tage vorher wird der Kommerzienrat vor einem Gemüsekeller in der Musketierstraße erkannt – vor einem Kellerladen, der, wie in der Zeitung weiter zu lesen ist, einem Händler namens Willberg gehörte, der – nun ebenfalls spurlos verduftet ist. – Ich denke, dies genügt, mein Alter, uns zu veranlassen, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Fahren wir zu Baron Toornward.“ –
Ein Auto brachte uns in zehn Minuten nach der Neuen Bleibtreustraße Nummer 9.
Wir läuteten im dritten Stock rechts an, wo unter dem Messingschild „M. Mewes“ des Barons Karte befestigt war.
Der Diener Braek, ganz der Typ des langjährigen Bedienten eines Feudalgeschlechts, öffnete.
„Der Herr Baron ist heute früh weggegangen und noch nicht heimgekehrt,“ erklärte er in mäßigem Deutsch, aber mit desto eindrucksvollerer Unruhe. „Ich bin bereits in Sorge um den Herrn Baron. Er hat nämlich gestern einen Brief erhalten, der von einem recht fragwürdigen Menschen, der mehr wie ein Strolch aussah, überbracht wurde. Nach Durchsicht dieses Briefes geriet mein Herr in große Aufregung. – Ich würde den Herren dies nicht mitteilen, wenn Sie nicht Herr Harst wären. Der Herr Baron sagte gestern abend neun Uhr zu mir, als er den Brief zu sich steckte: „Ich werde morgen früh den berühmten Liebhaberdetektiv Harst aufsuchen. Mein damaliger Traum, lieber Braek, hat jetzt ein seltsames Nachspiel bekommen.“ – Mehr kann ich Ihnen leider nicht mitteilen, Herr Harst, denn der Herr Baron schickte mich dann zu Bett. Was jener Brief enthalten haben kann, ahne ich nicht einmal.“
Braek hatte uns in des Barons Herrenzimmer geführt.
„Hatte der Baron gestern abend eine Hausjacke an?“ fragte Harald nun.
„Ja, Herr Harst.“
„Steckte er den Brief in eine Tasche dieser Jacke?“
„Jawohl, in die rechte Außentasche.“
„Holen Sie die Jacke, Braek. Es muß sein. Vielleicht finden wir den Brief noch darin. Ich fürchte, der Baron ist hier in ein keineswegs harmloses Abenteuer mit hinein verwickelt worden.“
Der alte Braek verbeugte sich. „Weil Sie es sind, Herr Harst!“ –
Wir fanden den Brief. Er lautete – ohne Anrede:
Sollten Sie über Ihren Traum in jener Nacht irgend jemandem gegenüber auch nur Andeutungen fallen lassen, so werden wir Sie ohne Erbarmen der Staatsanwaltschaft wegen „des Mannes mit dem Herzen auf der rechten Seite“ anzeigen. – Verbrennen Sie diesen Brief.
Auch eine Unterschrift fehlte. – Harald schob Brief und Umschlag in die Tasche.
„Braek,“ sagte er sehr ernst, „Sie dürfen niemandem verraten, daß der Baron damals im Rausch so merkwürdig geträumt hat. Oder – erwähnten Sie es irgend jemandem gegenüber? Besinnen Sie sich genau –“
Braek zögerte etwas. „Ich bin viel allein, Herr Harst,“ erklärte er dann. „Ich habe mich zuweilen mit einem Herrn aus dem Nebenhause unterhalten, der wie ich eine Vorliebe für Blumen hat. Dort draußen auf unserem Balkon habe ich die Blumenkästen hübsch bepflanzt. Und der Herr, der nebenan in Nr. 10 ebenfalls im dritten Stock einen Balkon hat, liebt Blumen genau so. Wir kamen erst beim Begießen unserer Lieblinge von Balkon zu Balkon ins Gespräch. Dann trafen wir uns auf der Straße, und nun gehen wir Tag für Tag zusammen eine Stunde spazieren. Der Herr war früher Kaufmann und ist jetzt Rentner, ist zehn Jahre jünger als ich, so gegen fünfzig, und heißt Eduard Allin. Ihm erzählte ich, wie mein Herr hier in Berlin recht, ja recht unsolide geworden ist und was in jener Nacht vorfiel.“
„Wann erzählten Sie es ihm?“
„Das kann ich nicht mehr genau sagen. Vielleicht vor fünf bis sechs Tagen. Es mag auch länger her sein.“
„Begannen Ihre Spaziergänge mit Herrn Allin vor oder nach dem 22. August?“
„Gesprochen hatten wir miteinander von Balkon zu Balkon schon vorher. Zum ersten Male gingen wir dann am 22. August zusammen spazieren.“
„So – so! – Braek, nun frischen Sie Ihr Gedächtnis mal recht tüchtig auf: Hat Herr Allin Sie etwa ausgehorcht? Kam er etwa auf die Verführungen der Weltstädte zu sprechen und fragte er Sie vielleicht, wie Ihr Herr lebe?“
Braek schaute Harald plötzlich mit traurigem Blicke an.
„Oh – wie schlecht die Menschen doch sind, Herr Harst!“ rief er empört. „Jetzt, wo Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, daß Herr Allin vielleicht mich nur ausforschen wollte, wird mir manches in seinen Reden klar. Ja, ja, – Sie haben recht, Herr Harst: er hat über die Sündhaftigkeit der Großstädter gesprochen; er hat auch über den Herrn Baron Bemerkungen gemacht, die – wie blind war ich nur! – darauf abzielten, meinen Unwillen über des Herrn Barons lockeren Lebenswandel zu erregen. Ich diene dem Hause Toornward nun bereits fünfundzwanzig Jahre. Da verschmelzen die Interessen der Herrschaft mit denen des Dieners, Herr Harst. Ich meinte es nur gut, es war nur Sorge um des Herrn Barons Gesundheit, als ich über den Alkoholmißbrauch im allgemeinen und die Neigung des Herrn Barons für schwere Weine im besonderen mich ausließ. Dabei erwähnte ich eben, daß der Herr Baron damals nachts von einem Manne im Fahrstuhl gesprochen hätte und vorher in Kleidern auf dem Diwan eingeschlafen war und Hut und Stock im Fahrstuhl vergessen hatte. Ich werde Herrn Allin fortan nicht mehr kennen. Ich –“
„Das werden Sie nicht, Braek!“ meinte Harald schnell. „Im Gegenteil: Sie werden so tun, als ob Sie Herrn Allin nach wie vor als Zufallsbekanntschaft sehr angenehm fänden. – Braek, im Vertrauen: Ihr Herr hat damals nicht geträumt! Er sah einen Toten im Fahrstuhl sitzen, einen Erwürgten!“
„Um Gott!“ rief der Alte entsetzt.
„Braek, es heißt schlau sein. Also – sich Allin gegenüber nichts merken lassen, nicht das Geringste! – Sollte der Baron bis morgen früh nicht zurückgekehrt sein, so geben Sie mir telephonisch Bescheid.“
Wir verabschiedeten uns. Auf der Straße sagte Harald, indem er sich in meinen Arm einhakte: „Wenn dieser Allin ein weibliches Wesen in seinem Haushalt hat, etwa eine Tochter, Wirtschafterin oder dergleichen, dann sind wir auf der rechten Fährte. Ich wollte Braek nicht zu viel fragen. Er soll nicht kopfscheu werden. Gehen wir zur nächsten Polizeiwache. Dort wird man mir die gewünschte Auskunft nicht verweigern.“ –
Wie richtig Harst doch wieder vermutet hatte! Allin wohnte mit seiner ledigen Tochter Ella, 25 Jahre alt, zusammen! –
Und abermals schritten wir Arm in Arm von der Polizeiwache die Straßen des Berliner Westens entlang.
„Ich dachte zuerst an eine Tochter,“ meinte Harald, „weil der lackierte Fingernagel auf Eitelkeit und verfeinerte Lebensgewohnheiten, auf Jugend und Wohlhabenheit hindeuteten. – Wir werden nun nach der Musketierstraße fahren.“ –
Neben dem Keller des Gemüsehändlers Willberg befand sich ein ähnlicher Laden, der einem Schuhmacher Rehbein gehörte, wie wir auf dem Blechschild dieser Kellertür lasen. Das eine schmale Kellerfenster Meister Rehbeins war noch erleuchtet. Wir hörten den Schuhmacher hämmern und zwischenein auch das Geschmetter eines Kanarienvogels.
Harald klopfte gegen die Scheibe. Das Fenster wurde geöffnet, und der Kopf eines vertrockneten Männchens erschien in der hellen Öffnung.
„Sie wünschen?“ fragte er mißtrauisch.
„Nur eine Auskunft,“ meinte Harald liebenswürdig und reichte dem wunderlichen Alten, der vollkommen an einen der Zwerge aus schönen Kindermärchen erinnerte, seine Legitimation nebst einem Hundertmarkschein.
Der Kopf verschwand. Das Fenster wurde zugeschlagen. Nach einer Weile aber kreischte das Schloß der Kellertür. Rehbein begrüßte uns schweigend mit vielen Bücklingen, die er noch durch einladende Handbewegungen unterstützte. Erst als er die Tür wieder verschlossen und seine kleine Werkstatt betreten hatte, kam die laute Begrüßung. Zunächst warf das Männchen beide Arme wie außer sich vor Entzücken in die Luft. Als diese theatralische Geste beendet war, rief er:
„Gepriesen sei der Tag, an dem Sie, hochverehrter Herr Harst, die acht Stufen zu meiner bescheidenen Behausung hinabzuklimmen die außerordentliche Güte hatten! Ich gehöre zu Ihren allerglühendsten Bewunderern! Da – bitte!“ Er ergriff die Lampe und beleuchtete an der Wand sechs aus illustrierten Zeitschriften ausgeschnittene Bilder Haralds, die er durch eigenhändig gefertigte Rahmen aus Zigarrenkistenholz noch dekorativer gemacht hatte.
Harald gab ihm die Hand. „Meister Rehbein, dann werden Sie mir hoffentlich auch einiges über Ihren Nachbar Willberg erzählen,“ sagte er mit jener zwanglosen Liebenswürdigkeit, die ihm im Fluge jedes Herz erobert.
„Dacht’ ich’s mir doch – dacht’ ich’s mir doch!“ meinte der Zwerg und grinste pfiffig. „Nehmen Sie zunächst mal Platz, meine Herren –“ – Er schleppte zwei Stühle dicht an seinen Arbeitstisch. – „So – bitte – Sessel besitze ich leider nicht. – Hm – Theodor Willberg, hm –“ – Er ließ sich auf seinen Schusterschemel nieder. „Ob ich über den etwas weiß?! Ja, Herr Harst, da muß ich erwidern: Nein, ich weiß nichts – nichts!“ Er streichelte seinen grauen Vollbart. „Nein – nichts! Die Polizei war ja schon bei mir, und diesen Herren erklärte ich dasselbe. Selbstverständlich tat ich es! Hier in der Musketierstraße, wo meine Kundschaft lediglich aus Kaschemmenstammgästen besteht, – hier würde ich mir eher die Zunge abbeißen, als über ein sogenanntes fragwürdiges Subjekt auch nur zu verraten, wann er seine Stiebel zum letzten Male hat versohlen lassen. Ne – nichts zu machen! Die Musketierstraße hat ihren eigenen Komment, was doch so viel heißt wie: ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze! – Allerdings, wenn ein Harald Harst zu mir käme und spräche: „Herr Rehbein, niemand von der Musketierstraßen-Gilde soll irgendwie geschädigt werden, wenn Sie mir alles sagen!“ dann – dann würde sich mein Gedächtnis vielleicht sehr schnell von seiner Schwäche erholen, und ich würde, – doch nein – erst reden Sie, Herr Harst!“
Harald lächelte etwas. „Harst verspricht Ihnen, die Gilde unbedingt zu schonen,“ meinte er, schnell wieder ernst werdend.
„Gut, gut, – dann erkläre ich also, daß Willberg den Laden erst seit zwei Monaten innehatte. Ich betone: innehatte! Nicht bewohnte! Denn meines Erachtens oder besser meinen Beobachtungen nach ist er kaum viermal in der ganzen Zeit dort gewesen. Verkauft hat er nie etwas. Der Gemüseladen war immer geschlossen. Nur am zweiten Tage wurden dort zwei Sack Kartoffeln, ein Sack Kohlrüben und eine Kiste Mohrrüben abgeladen. Das war das einzige Mal, wo ich Willberg bei Tage zu sehen bekam. – Wie er aussah?! Nun – er hatte eine schäbige Kluft an, hatte einen dunkelblonden Vollbart und trug so ’nen Kneifer ohne Fassung mit ’n Goldsteg oben, so ’n modernes Augenglas. Im übrigen, Herr Harst, besuchte er den Laden nur nach Dunkelwerden. Was er dort trieb?!“ – Der Gnom grinste noch pfiffiger. „Wer kann das wissen, Herr Harst?! Die Polizei, die den Laden durchsucht hat, fand nichts als etwas Möbelgerümpel, die Kartoffeln, die Kohlrüben und die Mohrrüben, hat dann festgestellt, daß es einen Theodor Willberg, der vordem in Stettin gelebt haben wollte, nicht gibt, und zog mit langer Nase und kurzen Neuigkeiten ab –“
„Aber Sie wissen es!“ sagte Harald leise.
Rehbein nickte. „Nur für Sie weiß ich’s – und für Ihren Freund, Herrn Schraut. Sonst für niemand!“ – Er begann zu flüstern. Der Kanarienvogel hatte seinen Gesang eingestellt; er sang wohl nur, wenn das Hämmern ihn anregte.
„Die Sache ist die, Herr Harst. – Meine kleine Küche und die des Nebenkellers haben früher mal – das Haus ist sehr alt – eine Verbindungstür gehabt. Sie wurde dann vor langen Jahren nicht zugemauert, sondern nur durch zwei Holzwände verschlossen, die mit Kalk getüncht wurden. Niemand weiß dies mehr. Nur ich, denn ich wohne jetzt hier 32 Jahre, erst mit meiner Frau, dann allein, ganz allein. – Theodor Willbergs Person interessierte mich. Ich lese gern Kriminalromane und Detektivgeschichten. Ich dachte daher mit meiner regen Phantasie: „Halt – mit diesem Willberg stimmt etwas nicht! Du könntest eigentlich mal versuchen, ihm hinter seine Schliche zu kommen!“ – Deshalb, Herr Harst, wuchtete ich eines schönen Tages vor etwa vier Wochen das eine Brett der Holzwand auf meiner Seite los –“ Er machte eine Pause.
„– und dann auch eines der zweiten Wand,“ vollendete Harald ungeduldig.
„Nein, Herr Harst. Das tat ich nicht, denn –“
„– ich fand zwischen den Holzwänden etwas,“ fügte Harald schnell hinzu.
„Ah – man merkt, Harst sitzt mir gegenüber!“ meinte der Gnom mit einer Verbeugung. „Ja – ich fand dort etwas: einen schmalen Koffer, einen eleganten Koupeekoffer, etwa dreiviertel Meter lang und ein halbes Meter hoch. An dem einen Griff war ein Schlüssel angebunden.“
„Sie öffneten den Koffer?“
„Ja, das tat ich. Ich fand darin Papiergeld, bündelweise, alles Tausendmarkscheine und Hundertmarkscheine, schätzungsweise – anderthalb Millionen.“
„Echt?“ warf Harald gespannt ein.
„Unzweifelhaft echt, Herr Harst. – Ich stellte den Koffer an dieselbe Stelle zurück. Die Versuchung war allerdings groß. Ich hätte mit einem Schlage ein reicher Mann werden können. Und doch: das ungeschriebene Gesetz der Musketierstraße warnte mich, lieber nicht mit dem Koffer auszukneifen. Kurz, ich habe das Brett wieder eingefügt, habe die beiden Ritzen dick mit Kalk übertüncht und – bin ehrlich geblieben. – So, mehr weiß ich nicht, Herr Harst! Höchstens noch das eine, daß die Polizei bis vorgestern den Keller Willbergs heimlich beobachten ließ. Jetzt hat sie es aufgegeben und dem Hausbesitzer heute nachmittag, wie mir der Portier erzählte, gestattet, den Keller zum ersten Oktober wieder zu vermieten. Die Schlüssel will die Polizei übermorgen dem Hausbesitzer aushändigen, der noch Duplikatschlüssel zu den Türen gefunden hatte.“
3. Kapitel.
Harald hatte sich eine Zigarette angezündet. Er starrte in die glitzernde Schusterkugel, die der Alte nach anderswo längst entschlafenem Brauch noch benutzte.
Dann sagte er, indem er sich erhob: „Wir werden das Brett losmachen, Herr Rehbein. Vorwärts! Ich muß wissen, ob meine Vermutung zutrifft. Der Koffer wird verschwunden sein. Ist er es nicht, dann – fällt meine Theorie in sich zusammen, was den Mann im Fahrstuhl betrifft.“ Die letzten Sätze galten mir.
Rehbein nahm die Petroleumlampe vom Schustertisch. „Gut – ich bin einverstanden, Herr Harst. Ihr Name deckt mir den Rücken.“ –
Wir hatten das Brett sehr bald gelöst. Der Gnom besaß genügend Werkzeuge.
Der Koffer war – nicht mehr da!
„So,“ meinte Harald, „nun das zweite Brett! Her mit dem Stemmeisen, Herr Rehbein! Ich werde die Nägel gerade biegen –“
Nach einer halben Stunde, in der wir jedes Geräusch vermieden, konnte das Brett nach außen gedrückt und herausgehoben werden.
Harald schob sich durch die schmale Öffnung hindurch, schaltete drüben seine Taschenlampe ein und flüsterte: „Bleiben Sie in Ihrer Küche, Herr Rehbein. Schraut und ich arbeiten nicht gern vor Zuschauern.“
Ich kam mit knapper Not durch das Loch in die Willbergsche Küche. Von dieser ging eine Tür wie bei Rehbein in eine winzige Schlafkammer, und diese war durch eine zweite Tür mit dem größeren Raume verbunden.
Wir hatten ihn kaum betreten, und ich hatte auf Harsts Wink diese Tür kaum ins Schloß gedrückt, als wir draußen auf der Straße das Geräusch eines Autos vernahmen, das vor dem Hause anhielt.
Harst schaltete die Taschenlampe aus, die er ohnedies stets unter der Jacke getragen und von deren Lichtkegel er nur einen winzigen Strahl zur zeitweisen Beleuchtung unseres Weges hindurchgelassen hatte, und flüsterte: „Achtung!“
Wir standen im Dunkeln. „Du meinst, das Auto könnte jemand gebracht haben, der hier –“ – Weiter kam ich mit dieser zweifeldurchwehten Frage nicht.
Ich vernahm Geräusche, die mir bewiesen, daß Harst wieder einmal recht gehabt hatte.
Er packte meinen Arm.
„Schnell – in die Schlafkammer! Unter das Bett!“
Im Moment waren wir nebenan in der Kammer, lagen nun unter dem Fichtenbett auf den staubigen Dielen. Die Tür hatte ich wieder eingeklinkt.
Und abermals hörten wir Geräusche – Schritte, leises Poltern, Knarren des Fußbodens.
Dann wurde die Tür geöffnet. Ein Lichtschein huschte herein.
„Aufs Bett!“ flüsterte eine tiefe Stimme.
Wir sahen nichts als zwei Paar Lackstiefel mit Tucheinsätzen, darüber gebügelte Beinkleider.
Die beiden Männer warfen etwas Schweres, das sie getragen hatten auf das Bett.
Wieder eine Stimme: „Verdammt – spare nicht mit dem Zeug! Sicher ist sicher!“
Sie standen dicht an dem Bett. Von der Tür her flüsterte ein Dritter, der die Lampe hielt: „Beeilt Euch! Ihr wißt, daß wir –“
„Erledigt!“ sagte der mit dem Baß leise.
Und – in demselben Augenblick sah ich, wie Harald, der den Arm ausgestreckt hatte, das Beinkleid des einen Mannes sacht berührte.
Ich lag an der Wand. Ich war starr vor Schreck. Hatte Harst den Menschen etwa an der Hose gezupft?!
Nun – meine Sorge war überflüssig. Die drei entfernten sich. Das Auto fuhr draußen knatternd davon.
Das Ganze hatte keine zwei Minuten gedauert.
Harst kroch hervor, knipste seine Taschenlampe an, richtete sich auf. Ich folgte schnell.
Und erblickte auf dem Bett einen gut gekleideten Herrn mit blondem Spitzbart – gefesselt und mit einem Lappen über dem Gesicht.
Der süßliche Geruch von Chloroform stieg mir in die Nase.
Und Harst riß auch schon den Lappen weg, enthüllte so ein Männerantlitz, dessen Züge durchaus denen des Barons Toornward glichen, von dem der Diener Braek uns eine neuere Photographie mitgegeben hatte.
Der Baron war bewußtlos. Wir nahmen ihm die Fesseln ab.
„Er ist leicht chloroformiert,“ sagte Harst, nachdem er den Puls und die Augen untersucht hatte. „Tragen wir ihn zu Rehbein hinüber.“
Der Gnom taumelte vor Schreck zurück, als wir so zu dreien seine Werkstatt wieder betraten. Wir legten den Baron auf Rehbeins uraltes Glanzledersofa.
„Herr Rehbein,“ meinte Harald, „Sie werden bei diesem Herrn jetzt Krankenpfleger spielen. Reiben Sie ihm die Schläfen mit Essig ein, ebenso die Brust. Wir gehen nochmals hinüber.“ –
Als wir den Ladenraum des Kellers betraten, sahen wir sofort auf dem Fußboden einen sehr großen, aufgeklappten Koffer stehen, der ganz neu war – und völlig leer.
„In diesem Ding hat man den Baron hergeschafft,“ sagte Harald sinnend. „Den Baron haben wir nun. Jetzt fehlt noch der tote Peter Niendorf, mein Alter.“
Ich horchte auf. „Der Mann aus dem Fahrstuhl?“ fragte ich zögernd.
„Ja. Denn der Tote, den der Baron damals erblickte, war bestimmt Niendorf. Dieser trägt einen Kneifer ohne Fassung, ist bartlos und verschwand an demselben Tage, wo Toornward nachts angeheitert heimkehrte. Niendorf ist eine so bekannte Persönlichkeit in Berlin, daß es der Beschreibung seines Äußeren in der Zeitung gar nicht bedurft hätte, um mir klar zu machen, daß des Barons „Traumgesicht“ eben der verschwundene Kommerzienrat sein müsse. Ich sagte mir dies heute abend sofort nach der Lektüre von Baltholms Brief, wie Du weißt.“
„Und – hoffst Du die Leiche etwa hier zu finden?“
„Ja.“
„Nach Rehbeins Angaben könnte Niendorf aber auch hier „Willberg“ gespielt haben. Auch „Willberg“ trug einen Kneifer ohne Fassung.“
„Stimmt.“
„Weshalb Niendorfs Doppelrolle?! Und – was hat es mit dem Koffer mit den anderthalb Millionen auf sich?“
„Durchschaust Du den Zusammenhang wirklich nicht? Es gibt nur eine Lösung. – Lassen wir die Theorie jetzt, halten wir uns an die Praxis. Ich behaupte: Niendorfs Leiche muß hier sein!“
„Weshalb?!“
„Weil faulende Kartoffeln – und jene dort in der Ecke faulen schon, daher der Gestank hier! – den Verwesungsgeruch nicht übertäuben. Hätte die Polizei Baltholms Brief erhalten und wüßte sie, was wir wissen, und röche sie, was ich rieche: auch sie würde dann dasselbe tun.“
Und er bückte sich und begann wie ein Spürhund an den Ritzen der rissigen Dielen zu schnuppern.
Nach kaum drei Minuten erklärte er: „Hier liegt die Leiche! Überzeuge Dich!“
Ich kniete nur widerstrebend nieder und brachte die Nase dicht an die Dielenritze.
Mein Kopf flog wieder empor. Übelkeit würgte mir in der Kehle, so stark war der Pesthauch der Verwesung, der unter den Dielen hervordrang.
„Unsere Aufgabe hier ist erledigt,“ sagte Harald nun. „Sehen wir, wie es dem Baron geht.“ –
Ihm ging es gut. Er war bei Bewußtsein.
Jetzt wurde auch Meister Rehbein von Harst in alles eingeweiht. Rehbein schwor, daß er nichts verraten würde – nichts und niemandem!
Toornward drückte uns dankbar die Hand. „Wenn ich geahnt hätte, welche Folgen mein Brief an Baltholm haben sollte!“ meinte er matt. „Sie haben mir das Leben gerettet, Herr Harst. Ich werde Ihnen kurz mitteilen, was mir heute widerfahren ist.“
Harald hatte den Brief, den der Baron durch den fragwürdigen Menschen heute früh erhalten hatte, noch nicht erwähnt. Jetzt machte er eine kurze Handbewegung, die Toornward schweigen ließ, und fragte, indem er den Baron scharf beobachtete: „Was hat es mit dem Manne „mit dem Herzen auf der rechten Seite“ auf sich?“
Toornward zuckte zusammen. Dann flüsterte er hastig: „Ich möchte hierüber nicht sprechen, Herr Harst. Entschuldigen Sie schon. Aber – man gibt nicht gern zu, daß –“
„– daß man aus Liebe zur Wissenschaft Friedhofsbeamte besticht und eine Leiche aus einem in der Kapelle aufgebahrten Sarge stehlen läßt,“ vollendete Harst ruhig. „Ich begreife es vollkommen, Herr Baron, daß Sie die Aufdeckung dieses Verbrechens des Leichenraubes fürchten, für das es nur eine Entschuldigung gibt: die Wissenschaft, den Forschertrieb! – Ich lese Zeitungen sehr genau. Ich habe ein vorzügliches Gedächtnis. Ich weiß, daß vor etwa drei Wochen jener Ignaz Skrotzki hier in Berlin starb, der den Ärzten insofern hochinteressant war, als bei ihm das Herz rechts in der Brust lag. Man hatte ihm schon bei Lebzeiten große Summen für seine Leiche geboten. Seine Frau schlug auch nach seinem Tode alle derartigen Angebote ab. Und da haben Sie eben als reicher Mann –“
Toornward nickte. „Ja – ich habe es getan. Aber ich ließ die Leiche nicht stehlen. Ich habe sie nur seziert und die inneren Organe photographiert. Immerhin: es bleibt ein Verstoß gegen die Gesetze. – Wie jemand davon etwas erfahren haben kann, ist mir unklar. Die von mir bestochenen beiden Leute werden sich gehütet haben, zu jemandem –“
„Nein – diese Leute schwiegen,“ fiel ihm Harald ins Wort. „Aber – andere Leute gibt es, die Ihnen auf Schritt und Tritt gefolgt sind, seitdem Sie durch einen Zufall Mitwisser des Todes Niendorfs geworden waren. Und diese beobachteten, daß Ignaz Skrotzkis Leiche von Ihnen heimlich seziert wurde. – So, nun erzählen Sie, Herr Baron.“
„Als ich den Drohbrief heute früh erhalten hatte,“ begann Toornward, „begab ich mich sofort zu den beiden Kirchhofsbeamten und hielt ihnen vor, daß nur durch ihre Schwatzhaftigkeit unser gemeinsames Vergehen für uns üble Folgen haben könnte. Sie schworen hoch und heilig, daß sie nicht einmal ihre Frauen eingeweiht hätten. Ich glaubte ihnen. Sie waren nun selbst in der größten Unruhe und flehten mich an, sie nicht zu verraten und nötigenfalls anzugeben, daß ich ohne jemandes Wissen in die Kapelle eingedrungen sei. Ich versprach dies. – Als ich die Straße wieder betrat, drängte sich ein Mensch an mich heran, der mir einen Zettel in die Hand drückte und blitzschnell in einem Hause verschwand. Der Mensch war gut gekleidet und trug Brille und schwarzen Vollbart. Auf dem Zettel stand:
Wenn der mit dem „rechten“ Herzen vergessen werden soll, kommen Sie sofort nach der Lenbachstraße Nr. 16, zwei Treppen, Gartenhaus, rechts.
Was sollte ich tun?! Ich mußte gehorchen. An der Tür der Gartenhauswohnung in der Lenbachstraße hing eine Visitenkarte, die mit der Hand ausgeschrieben war:
Max Müller
Ingenieur.
Ich läutete. Es öffnete mir derselbe Mann, der mir den Zettel in die Hand gedrückt hatte. Er war sehr höflich, bat mich in ein Zimmer linker Hand, das die übliche Einrichtung „möbliertes besseres Zimmer“ hatte und gab mir ein Schriftstück zu lesen, nachdem ich in einem Sessel mit dem Rücken nach dem Fenster hin Platz genommen hatte. In dem Schriftstück sollte ich mich zur Zahlung von 100 000 Mark „Vermittlergebühr“ verpflichten. Es war also eine glatte Erpressung. Während ich noch las, müssen unter dem Sofa, neben dem der Sessel stand, und hinter mir je noch ein Mann dann mitgeholfen haben, mich zu überwältigen. „Müller“ begann mit dem Überfall, indem er mir plötzlich aus einer Flasche Chloroform ins Gesicht goß. Gleichzeitig packte man meine Füße unten und meine Handgelenke von hinten. Ich wollte um Hilfe rufen. „Müller“ – der Kerl wird natürlich ganz anders heißen – warf mir eine schwere Reisedecke über den Kopf und ich verlor das Bewußtsein. Als ich wieder zu mir kam, war ich geknebelt und gefesselt und sitzend auf einem Stuhl festgebunden. Die Decke lag noch über meinem Kopf. Ich sah nichts, hörte nur, daß jemand zuweilen im Zimmer auf und ab ging. Dann betäubte man mich nach Stunden abermals, und ich erwachte hier auf dem Glanzledersofa.“
Harald fragte noch einiges. Der Baron konnte jedoch den Tatbestand seines gefährlichen Abenteuers nicht weiter ergänzen. Harsts letzte Frage lautete, ob der Baron „Müller“ für einen Ausländer der Sprache nach hielte. Der Baron verneinte. „Der Mann beherrschte das Deutsche tadellos, sprach sogar leicht Dialekt, Herr Harst. Ich kann das beurteilen, da ich sehr viel mit Deutschen verkehrt habe und noch verkehre und Ihre Sprache mir völlig geläufig ist.“
„Dann werden wir jetzt die Bretter wieder einfügen,“ bestimmte Harald.
Dies war gegen Mitternacht erledigt. – Der Baron blieb vorläufig bei Meister Rehbein. Wir beide verabschiedeten uns. Der Gnom ließ uns hinaus. Wir schritten die Musketierstraße hinab.
„Jetzt kommt der Rentner Eduard Allin nebst Tochter an die Reihe,“ meinte Harald lebhaft. „Die Geschichte ist nun geklärt bis auf Kleinigkeiten. Das von mir konstruierte Gesamtbild muß stimmen. Du wirst es Dir gleichfalls schon konstruiert haben, mein Alter.“
„Allerdings,“ sagte ich. Und das war die Wahrheit.
Hinter uns kam ein Auto her. Es war ein Taxameterauto. Harald rief den Chauffeur an. Der Mann fuhr langsamer, erklärte: „Mein Dienst ist aus. Ich bin bereits auf dem Wege zur Garage.“
„Hundert Mark extra!“ – Und das genügte. Wir stiegen ein, nachdem Harald die Neue Bleibtreustraße als Ziel genannt hatte.
Das Hinterverdeck des Kraftwagens war herabgeklappt. Als wir dann durch den nächtlich stillen Tiergarten fuhren, setzte der Motor des öfteren aus. Dann gab es einen letzten Knall, und das Auto hielt.
„Panne!“ meinte Harald. „Nun müssen wir doch zu Fuß laufen!“
Der Chauffeur stieg ab und trat an den Wagenschlag heran.
„Wenn die Herren warten wollen. Ich werde mal nachsehen. Es muß an der Zündung liegen.“
Oh – es lag nicht an der Zündung; es lag an etwas ganz anderem! –
Wir blieben arglos sitzen. Harald bot mir eine Zigarette an und sagte mit einem tiefen Atemholen, das wie ein Seufzer klang:
„Es mag von Niendorf nicht gerade sehr ehrenwert gewesen sein, daß er seine Fabrik an Franzosen verkauft hat. Man wird seine Handlungsweise jetzt aber milder beurteilen müssen. Er ist tot. Er hat gebüßt.“
„Seine Mörder sind die Käufer der Fabrik?“ fragte ich, ohne mir diese Frage recht zu überlegen.
Harald schaute mich merkwürdig an. „Nein, lieber Alter, da hast Du wieder mal aus Denkträgheit etwas in den blauen Dunst hinein gefragt. Du weißt doch aus dem Zeitungsartikel, daß man Niendorf vorwirft, den Steuerfiskus betrogen zu haben. Das mag schon stimmen. Die anderthalb Millionen, die Niendorf als Händler Willberg zwischen den Holzwänden verborgen hatte, dürften die Summe sein, die er über den für die Öffentlichkeit angegebenen Kaufpreis ausbezahlt bekam. Er hielt das Versteck dort für ganz sicher. Und doch sind irgendwelche Leute hinter seine Schliche gekommen. Zu diesen Leuten muß der Rentner Eduard Allin gehören.“
Er blies den Rauch der Mirakulum stoßweise von sich und fügte hinzu: „Man kann Leichen über das Dach in ein Nebenhaus schaffen, und zwar deshalb, damit, falls man beim Wegschaffen gestört wird, der Tote in einem anderen Hause gefunden wird.“
Diese Bemerkung erleuchtete blitzartig des Barons Toornward nächtliches Abenteuer.
„Niendorf ist bei Allin ermordet worden?“ meinte ich.
„Ja. Bei Allin. Und die Tochter half, die Leiche durch das Nebenhaus in ein Auto oder einen Wagen bringen mit Hilfe des Fahrstuhls. – Überlege Dir das Erlebnis des Barons. Es spricht durchaus für diese Annahme. Die Verschleierte, die ihn wachrüttelte, war Fräulein Ella Allin. Man fuhr die Leiche dann nach der Musketierstraße in Willberg-Niendorfs Keller, zu dem die Mörder ihrem Opfer eben die Schlüssel abgenommen hatten, falls sie sich nicht schon vorher mit Nachschlüsseln versehen hatten. Dann nahmen sie den Millionenkoffer mit. Und so brauchten sie nicht zu fürchten, daß jemand erführe, weshalb und wo Niendorf den Tod fand.“
Er warf den Zigarettenrest auf die Straße. – Der Chauffeur kniete neben dem Motorkasten und hämmerte.
Und dann – dann erhielten wir den Beweis, daß dieser Chauffeur seine Rolle tadellos gespielt hatte.
4. Kapitel.
Aber noch jemand anders spielte seine Rolle tadellos.
Wir hörten hinter uns einen leisen Hilferuf, sprangen auf und beugten uns nebeneinander zum Auto hinaus.
Eine Frau – eine Dame mit Hut und dichtem Schleier kam die Straße entlanggelaufen, hinter ihr drein zwei Männer.
Die Frau rannte sehr schnell, winkte uns zu. Harald sprang auf die Straße. Die Frau war keine fünf Schritt mehr entfernt. Sie schien von einem wahnsinnigen Entsetzen gepackt zu sein, flog Harald jetzt, scheinbar stolpernd, um den Hals.
All das war Komödie, war einer der raffiniertesten Überfälle, die wir erlebt haben.
Ich erhielt von hinten, natürlich von dem Chauffeur, den ersten Schlag über den Kopf.
Harald schien jetzt Argwohn geschöpft zu haben, wollte das Weib von sich drängen. Sie hielt ihn umklammert.
Ich war bereits bewußtlos umgesunken, als auch Harst brutal zu Boden geschlagen wurde. –
Ich kam zu mir – ganz allmählich, machte wieder einmal alle Stadien des langsamen Erwachens aus einer durch einen Kopfhieb hervorgerufenen Bewußtlosigkeit durch.
Und fand mich auf einem Stuhl sitzend gefesselt vor – mit dünnem Draht gefesselt – selbst die Füße an die Stuhlbeine – selbst den Hals mit Schlingen umlegt, deren Drähte nach oben zu einem Haken in der Decke liefen.
Neben mir saß Harst, genau so wehrlos wie ich, auch mit einem Knebel im Munde.
Der Raum aber, erleuchtet durch eine Küchenlampe mit Messingscheinwerfer, war die zum Willbergschen Keller gehörige Schlafkammer. Ich erkannte sie sofort wieder, denn am Boden vor mir lagen noch die Stricke, mit denen der Baron gefesselt gewesen.
Unsere Holzstühle standen frei mitten in der Kammer. Und auf dem Bettrand saß die Frau, die geholfen hatte, uns im Tiergarten unschädlich zu machen. Sie schaute uns durch die Löcher ihrer schwarzen Seidenmaske nacheinander an. Auch Harald war bereits bei Bewußtsein und schien jetzt eine Kopfbewegung gemacht zu haben, denn die Frau fragte mit einer angenehmen Stimme:
„Was wünschen Sie, Herr Harst? – Ich kann Ihnen den Knebel nicht abnehmen. Sie würden um Hilfe rufen. – Sie schütteln den Kopf? – Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, daß Sie nicht um Hilfe rufen werden? – Ah – gut, Sie sind ein Ehrenmann und halten Ihr Wort –“
Sie kam auf Harald zu und lockerte die Schnur, die den Knebel festhielt, entfernte diesen und fragte: „Nun?“
„Nun genügt es mir,“ erwiderte Harald. „Ihnen fehlt kein Fingernagel –“
„Was soll das, Herr Harst?“ – Ihre Stimme wurde schärfer und plötzlich recht schrill.
„Meine Theorie stimmt eben nicht,“ erklärte er kurz. „Sie können mir den Knebel wieder in den Mund schieben.“
„Nein. Wir haben mit Ihnen ohnedies zu verhandeln. Meine Freunde werden sofort erscheinen. Sie haben nur drüben bei Rehbein noch zu tun.“
Im selben Moment wurde hinter uns eine Tür geöffnet. Jemand rief leise:
„Verdammt – die beiden sind entwischt. Sie müssen den Keller schon vorher verlassen haben. Er ist leer.“
Der Mann trat weiter vor. Wir sahen ihn nun. Es war ein kleiner Mensch mit einer Chauffeurbrille, aber ohne Kragen und schäbig angezogen. Um den Hals trug er ein buntes Seidentuch. Aber seine Sprache war nicht die der Stammgäste der Berliner Kaschemmen, ebenso wie in seiner Körperhaltung und seinen Bewegungen jene gewollt träge Langsamkeit und Nachlässigkeit fehlten, die man mit dem volkstümlichen Ausdruck Schlaksigkeit bezeichnet.
Er musterte uns schweigend. Außer ihm waren offenbar noch zwei andere Männer eingetreten. Ich hörte flüstern und das Knarren der alten Dielen. Dann sagte der Kleine mit starker Gehässigkeit:
„Sie hätten sich in diese Sache nicht einmischen sollen, Herr Harst. Es geht hier um mehr als nur um Geld. Der Schuft von Kommerzienrat ist noch gut weggekommen. Er hätte es verdient, daß man ihm das Fell streifenweise abzog.“
„Mag sein,“ erwiderte Harald. „Weshalb Sie aber dem Baron Toornward ans Leben wollten, begreife ich nicht. Sie machen auf mich nicht den Eindruck eines kaltblütigen Mörders.“
„Danke. Was Sie von mir denken, ist mir gleichgültig. Hier geht es um unsere Köpfe. Und da wäre jede Rücksicht eine Narrheit.“
Harald schwieg.
„Sind Sie gar nicht neugierig,“ fragte der Mann nun, „wie wir erfahren haben, daß Sie bereits hinter uns her sind?“
„Neugierig ist nur der, der eine Sache oder einen Sachverhalt nicht kennt. Sie wußten, daß wir unter jenem Bett lagen. Sie werden das Haus Neue Bleibtreustraße Nr. 9, in dem der Baron wohnt, beobachtet haben, und da ich ohne Maske, ohne Verkleidung leicht zu erkennen bin, dürfte man sofort der Wahrheit auf die Spur gekommen sein, eben daß wir den Baron besuchten und dann längere Zeit bei seinem Diener blieben. Ich behaupte jetzt auch, daß Sie den Baron gar nicht töten wollten. Sie rechneten damit, daß wir ihm das chloroformgetränkte Tuch entfernen würden. Ich beginne die ganzen Dinge anders zu beurteilen.“
„Jedenfalls aber falsch!“ meinte der Kleine spöttisch.
„Sie täuschen sich. – Was werden Sie mit uns beginnen?“
„Wir müssen Sie jetzt, wo der Baron und Rehbein entwichen sind, sofort anderswohin schaffen, falls Sie nicht Ihr Ehrenwort geben, sich nicht weiter um uns zu kümmern.“
„Diese Zusage gebe ich nicht!“
„Dann – los!“ – Und auf diesen über unsere Köpfe hinweg gerichteten Befehl wurden uns von hinten zwei Tücher auf das Gesicht gepreßt. Gegenwehr war unmöglich. Ich hielt es für ratsam, die Luft anzuhalten und dann Bewußtlosigkeit nur vorzutäuschen. Es gelang. Die Leute hatten es eilig, banden mich los und schleppten mich wie einen schwer Trunkenen als ersten in das Auto draußen.
Ich lehnte in der einen Ecke mit geschlossenen Augen. Ich hatte meine volle Bewegungsfreiheit. Im Auto war es dunkel. Und – ich war ohne jede Aufsicht. Mein Hirn arbeitete blitzschnell. Die eine Tür war offen. Ich stieg aus. Ich hatte die Clementpistole so in die rechte Hand genommen, daß ich schnell zuschlagen konnte. Der kleine Kerl stand mit dem Rücken nach mir hin am Kellereingang. Die Straße war nur ganz schwach beleuchtet. Ein hohler Wind pfiff um die Hausgiebel. Es tröpfelte etwas.
Und – ich schlich hinter den Kleinen, schlug zu, fing den Umsinkenden auf und trug ihn ins Auto, nahm ihm die Chauffeurbrille ab, setzte sie auf, ebenso die Mütze, drückte ihm meinen weichen Filzhut ins Gesicht, kletterte auf den Führersitz.
Dann brachte man schon Harst angeschleppt.
Alles spielte sich nun so schnell ab, daß ich selbst kaum begriff, wie der Streich so tadellos hatte glücken können – scheinbar!
Einer der Männer rief mir ahnungslos zu: „Nach der Laube!“ ein anderer warf den Motor an.
Die Tür wurde zugeschlagen.
Ich freute mich, daß der Regen zum Wolkenbruch wurde. Die Scheiben der Autotüren mußten fast undurchsichtig sein.
Und ich steuerte bekannteren Straßen zu, raste die Neue Königstraße dahin, bog links ab, verminderte die Schnelligkeit, sah das breite Einfahrtsportal des Polizeipräsidiums offen, hielt erst auf dem zweiten Hofe an, rief zwei Beamten etwas zu, die in einer Tür standen.
Sie sprangen herbei, rissen die Tür auf.
Und dann die niederschmetternde Überraschung: Das Auto hatte nur einen Fahrgast: Harald Harst, der wirklich bewußtlos war!
Im Fluge klärte ich die Beamten auf. Immer mehr Leute strömten herbei, uniformierte und nicht uniformierte.
Man trug Harald in ein Zimmer. Dann erschien auch schon unser alter Bekannter Kriminalkommissar Lenk, der lange Lenk. Abermals erzählte ich. Lenk war durchaus nicht begierig, gleich alle Einzelheiten zu hören. Er gab Befehle aus. Die Riesenmaschine der Polizei begann zu arbeiten. –
Eine Viertelstunde drauf war Harald wieder zu sich gekommen. Und zehn Minuten später sagte er schon: „Bei mir waren die Leute vorsichtiger! Ich mußte Atem holen. Sie hatten die List durchschaut.“
Der lange Lenk trat ein. „Was nun, bester Harst? Sind Sie wieder aktionsfähig?“ rief er erfreut und drückte Harald die Hand.
„Nach der Neuen Bleibtreustraße zu Allin!“ sagte Harst und richtete sich auf. Ich half ihm. Er stand auf den Beinen, schwankte noch hin und her. –
Das Polizeiauto verließ das Präsidium am Alexanderplatz.
5. Kapitel.
Es war jetzt ein Uhr morgens. Es regnete noch immer. – Vor dem Hause Nr. 10 in der Neuen Bleibtreustraße standen bereits zwei Kriminalbeamte. Als wir drei ausstiegen, kam ein Motorradfahrer angesaust, einer von Lenks Beamten. Er meldete, daß der Baron und Meister Rehbein sich doch in des Schusters Kellerbehausung befunden hätten, freilich in einem Versteck, das Rehbein sich wahrscheinlich für in Not befindliche Kaschemmen-Kunden sehr geschickt angelegt hatte. Beide wurden jetzt auf dem Präsidium vorläufig festgehalten.
Wir klingelten den Portier von Nr. 10 heraus. Er teilte uns auf Harsts Fragen mit, daß der Rentner Allin zwei Vorderzimmer seiner Wohnung an zwei Herren vermietet hatte.
„Das klärt die Sache noch mehr,“ meinte Harald. „Dann hinauf zu Allins!“
Wir mußten sehr lange warten, bis geöffnet wurde. Die, die uns einließ, war ein blondes, schlankes Mädchen mit sympathischem Gesicht. Aber jetzt lag auf diesem Gesicht eine solche Blässe und ein so deutlicher Ausdruck der Verzweiflung und trostloser Ergebung in ein unabwendbares Geschick, daß sogar Lenk als Beamter mit äußerster Höflichkeit die Bitte aussprach, das Mädchen und den Rentner einiges fragen zu dürfen.
Ella Allin führte uns in ein Speisezimmer, dessen Möbel bescheidene Wohlhabenheit verrieten.
„Mein Vater wird sofort erscheinen,“ sagte sie dann, indem ihr Blick immer wieder Haralds Antlitz suchte.
Harald erklärte höflich, daß wir auch ohne Herrn Allin das Nötige besprechen könnten. „Ich möchte Sie um Aufschluß über die Vorgänge jener Nacht bitten,“ fügte er hinzu. „Ich meine jene Nacht, als Sie drüben in Nr. 9 den Toten in den Fahrstuhl geschafft hatten, indem Sie dazu den Weg über das Dach wählten. Sie wissen, Fräulein Allin, wen Sie hier vor sich sehen. Man rühmt mir die Fähigkeit nach, unklare Vorgänge etwas leichter zu durchschauen, als andere dazu imstande sind. Diese Fähigkeit beruht lediglich auf scharf logischem Denken und Phantasie.“
Das junge Mädchen senkte den Kopf und erklärte leise:
„Niendorf hat viele Menschen um Geld betrogen, so auch meinen Vater. Wir waren noch vor einem Jahre reich. Dann verlor mein Vater durch ihn zwei Drittel seines Geldes. Wir mußten unser Leben völlig anders einrichten. Mein Vater strengte gegen Niendorf einen Prozeß an, den er aber gerade zwei Tage vor jener entsetzlichen Nacht auch in letzter Instanz verlor. Damals am 22. August waren wir im Theater gewesen, also am 21. August, genauer ausgedrückt. Wir kehrten gegen halb zwölf heim. Als wir dort das Nebenzimmer betraten, wo mein Vater schläft und seine Agenturgeschäfte gleichzeitig erledigt, fanden wir Niendorf am Türpfosten an einem Haken in der Schlinge hängen. Er war bereits tot. Ich kämpfte bei dem furchtbaren Anblick gegen eine Ohnmacht an. Lediglich die Worte meines Vaters: „Jetzt wird man uns verdächtigen, den verhaßten Menschen ermordet zu haben!“ gaben mir die Kraft, mich aufrecht zu erhalten. Ich war es dann sogar, die den Vorschlag machte, die Leiche in das Nebenhaus zu schaffen. Diese unheimliche Arbeit, den schweren Körper unbemerkt auf das Dach und weiter bis in den Fahrstuhl zu tragen, überstieg fast unsere Kräfte. Nur die Angst, in eine polizeiliche Untersuchung –“
Harald unterbrach hier das junge Mädchen. „Sie sollen sich durch diese Erinnerungen nicht wieder aufregen, Fräulein Allin,“ sagte er mitfühlend. „Alles weitere ist mir bekannt. Sie trugen den Toten also in den Fahrstuhl von der vierten Etage aus, um Niendorfs Ende noch rätselhafter zu gestalten –“
Ella Allin nickte.
„Weshalb aber weckten Sie den Baron auf dem Treppenabsatz?“ fragte er dann und beantwortete die Frage selbst: „Vielleicht, um ihn glauben zu machen, er hätte alles nur geträumt? Ich denke, so wird es sein –“
„Es ist so, Herr Harst. Ich war mit dem Toten im Fahrstuhl bis ins Erdgeschoß gefahren, da mein Vater inzwischen mir erklärt hatte, es sei besser, die Leiche auf die Straße zu bringen –“ – Sie erschauerte. „Oh – wir beide waren damals ja kaum zurechnungsfähig; wir handelten in der Angst und Überstürzung wie Toren; wir zitterten am ganzen Körper. – Als ich mit dem Toten unten war und gerade die Fahrstuhltür geöffnet hatte, während mein Vater zu Fuß die Treppen hinabschlich, um nötigenfalls –“
Wieder fiel Harald ihr ins Wort. „Ich weiß, was dann geschah: es schloß jemand die Haustür auf. Sie standen vor Schreck wie gelähmt, die Fahrstuhltüren schlugen zu und der Fahrstuhl setzte sich mit dem Toten wieder nach oben in Bewegung. Sie hasteten die Treppen empor, und zu derselben Zeit taumelte der Baron beim Anblick der Leiche zurück und sank auf die unterste Treppenstufe, wo er, halb ohnmächtig vor Grauen, in einen schlafähnlichen Zustand verfiel –“
„Ja – ich rüttelte ihn. Und als er mich dann wie einen Geist anstarrte, erlosch die Treppenbeleuchtung wieder. Ich lief nach unten, machte in der ersten Etage halt und wartete. Ich hörte, wie der Baron nach einer Weile in seiner Wohnung verschwand. Dann ließ jemand den Fahrstuhl nach unten gleiten. Es muß dieselbe Person gewesen sein, die die Haustür aufgeschlossen, dann aber sich völlig still verhalten hatte. Nun wurde ich unbemerkt Zeugin, wie mehrere Leute den Toten davontrugen – zum Hause hinaus –“
„Genug davon,“ meinte Harald. „Wir wollen Sie nicht unnötig quälen. – Sie haben natürlich keine Ahnung, wer die Leiche in Ihres Vaters Zimmer geschafft haben kann?“
„Nein, nicht die geringste Ahnung. Wir hatten erst Verdacht auf die Brüder Steiner, die bei uns wohnen. Aber die Herren kamen erst morgens gegen drei Uhr heim. Sie waren verreist gewesen, nach Dresden.“
„Was treiben diese beiden Mieter? Welchen Beruf haben sie?“
„Es sind Kaufleute, Reisende für eine Spitzen- und Schleierfabrik, sehr bescheidene Menschen. Ich traue ihnen nichts Schlechtes zu –“
Der Rentner Allin trat jetzt ein. Nach kurzer Begrüßung bat Harald, das Nebenzimmer sich ansehen zu dürfen.
Allin erklärte uns, wie die Leiche damals an dem Kleiderhaken gehangen hatte. – „Dieser Schreibsessel stand neben dem Toten,“ sagte er. „Es sah so aus, als wäre Niendorf wirklich von dem Stuhl herabgesprungen. Das Schlingenende zwischen Kopf und Haken war sehr kurz. Die Füße hingen nur zwei Handbreit über den Dielen.“
Harald besichtigte jetzt mit merkwürdigem Interesse die Tapete rechts von der Türbekleidung. – „Sind Ihnen diese Kratzer in der Tapete nicht aufgefallen, Herr Allin?“ fragte er dann. „Die Kratzer, hier 4, hier abermals 4, sehen genau so aus, als ob sie durch die Fingernägel eines Menschen hervorgerufen sind, der in letzter Todesangst sich irgendwo festzukrallen suchte.“
Allin nickte eifrig. „Ja, Herr Harst, auf genau dieselbe Vermutung bin auch ich schon gekommen. Jedenfalls waren diese Kratzer vor jener entsetzlichen Nacht nicht vorhanden –“
„Dann hat Niendorf noch gelebt, als man ihn hier aufknüpfte,“ mischte der lange Lenk sich ein.
Harald schüttelte den Kopf. „Er ist nicht aufgeknüpft worden. Er hat sich selbst den Tod gegeben, vielleicht, weil seine dunklen Geschäfte nicht länger zu verheimlichen waren. Und mit dieser meiner Annahme stimmt auch das ganze Verhalten jener Leute überein, die aus Willbergs Keller den Koffer mit den anderthalb Millionen stahlen. Willberg war Niendorf. Jene Leute haben ihn nicht aus den Augen gelassen; jene Leute waren es, die die Leiche aus dem Nebenhause und dem Fahrstuhl in die Kellerwohnung der Musketierstraße brachten. Zwei von ihnen dürften hier als Brüder Steiner bei Ihnen gewohnt haben, Herr Allin –“
Das junge Mädchen machte da eine besondere Handbewegung. „Ich hörte sie vorhin heimkehren, als wir hier in dieses Zimmer hinübergingen,“ flüsterte sie.
„Nun – dann werden wir uns sofort Gewißheit verschaffen,“ sagte Lenk energisch. „Nicht wahr, Herr Harst, wir sehen uns die beiden sofort einmal an.“ –
Lenk klopfte kräftig gegen die Tür des Wohnzimmers der Steiners. Als niemand sich meldete, öffnete er. Die Tür war unverschlossen. Die elektrische Krone brannte. Das Nest war leer. Aber auf dem Tische lag ein Brief, an Harald Harst adressiert.
Das Schreiben lautete:
„Sehr geehrter Herr Harst! Wir sind überzeugt, daß Sie die Wahrheit über den Tod des Schurken Niendorf auch ohne uns ermitteln werden. Er hat sich selbst entleibt. Wir haben nur durch Drohungen etwas nachgeholfen. Wenn wir Sie und Ihren Freund Schraut etwas hart anpackten, so geschah dies lediglich, um unseren Rückzug zu decken. Wir brauchten Zeit, unser spurloses Verschwinden etwas vorzubereiten. Suchen Sie uns nicht. Es wäre zwecklos. Wir vier sind wie die Nebelschwaden, die ein Windstoß in unzählige Teilchen zerstäubt. Gewiß – das, was uns den „Feldzug“ gegen Niendorf eröffnen ließ, ist eine besondere Angelegenheit, die ganz nach Ihrem Geschmack wäre. Sie wird jedoch für alle Zeit Geheimnis bleiben. Wir sagen Ihnen hiermit Lebewohl. – Die vier erbittertsten Gegner des Schuftes Niendorf.“ –
Die Handschrift war verstellt; der Brief mit Bleistift geschrieben.
Als wir nachher die vor Nr. 9 und 10 postierten beiden Kriminalbeamten fragten, wer Nr. 10 betreten hätte, erhielten wir die Antwort: „Ein Herr und eine Dame. Sie kamen sofort wieder auf die Straße, stiegen in ein elegantes Privatauto und fuhren davon.“ –
Lenk, Harst und ich gingen zu Fuß gegen halb drei Uhr morgens die Neue Bleibtreustraße hinunter.
„Ich werde die vier finden,“ sagte Harald zu Lenk, als wir uns von diesem verabschiedeten. „Ein Geheimnis wie das des Toten im Fahrstuhl darf nicht zur Hälfte ungeklärt bleiben. – Gute Nacht, lieber Lenk. Sie hören noch von mir. Lassen Sie aber bitte den Baron und Rehbein sofort frei und verfolgen Sie des Barons Verfehlung hinsichtlich des Mannes mit dem „rechten“ Herzen nicht weiter.“ –
So begann für uns das Abenteuer mit den – vier Nebelgestalten.
Die vier Nebelgestalten
1. Kapitel.
Ich habe diesen Titel für dieses Abenteuer deshalb gewählt, weil der mit Bleistift geschriebene Brief, den wir im Wohnzimmer der Brüder Steiner vorfanden, die Bemerkung enthielt, daß die vier Gegner Peter Niendorfs gleich den Nebelschwaden seien, die ein Windstoß in unzählige Teile zerstäubt, also für immer verschwinden läßt. Der Leser mag nachprüfen, ob unser hier geschildertes Erlebnis diesen Titel rechtfertigt. –
Nach jener Nacht, die uns eine solche Fülle aufregender Zwischenfälle gebracht hatte, schliefen wir in unsern Zimmern in dem alten schönen Familienhause der Harsts in Berlin-Schmargendorf, Blücherstraße 10, bis in den Vormittag hinein.
Beim Frühstück auf der Veranda erzählte Harald seiner Mutter (welch inniges Verhältnis zwischen Mutter und Sohn bestand, habe ich wiederholt erwähnt) die Ereignisse des gestrigen Tages.
Frau Harst, die in ständiger Angst um das Leben ihres einzigen Kindes schwebte und mit dessen Liebhaberei, seltsamen Verbrechen und Vorfällen nachzuspüren, nie so recht einverstanden war, horchte schon bei der Erwähnung des Namens Niendorf auf und sagte nachher:
„Das muß derselbe Kommerzienrat sein, der vor anderthalb Jahren als Fünfziger ein armes adliges, um die Hälfte jüngeres Mädchen heiratete. Ich sah ein Bild des Paares in einer illustrierten Wochenschrift, und meine Freundin, die Frau Konsul Hersfeld, sprach mit mir über diese Ehe gleichfalls, da sie die Komtesse – hm, wie hieß sie doch nur? – ja, die Komtesse van der Bloozen persönlich kannte. Die Konsulin war sehr empört, weil Niendorf sich dieses schöne, geistvolle Mädchen geradezu gekauft hatte. Niemand begriff damals, daß sie ihn genommen hatte, und –“
Die alte Köchin Malwine war auf der Veranda erschienen und meldete uns den Kriminalkommissar Lenk.
„Wenn Lenk persönlich kommt, wo er dienstlich doch so in Anspruch genommen ist,“ sagte Harald, „dann ist auch etwas Besonderes geschehen.“
Wir gingen in Haralds Arbeitszimmer hinüber.
Lenk hatte nicht wie sonst in seinen Stamm-Klubsessel sich niedergelassen – er kam ja häufig zu uns!, sondern schritt erregt auf und ab.
Nachdem wir uns kurz begrüßt hatten, begann er sofort:
„Unsere Nachforschungen nach den vier Leuten, dem Weibe und den drei Männern, von denen einer den Chauffeur spielte, sind ergebnislos geblieben. Das Taxameterauto, mit dem Sie, lieber Schraut, in der verflossenen Nacht so stolz ins Präsidium kamen, bildete die einzige Unterlage für bestimmte Recherchen. Wir haben festgestellt, daß dieses Auto vor einem Hause der Linienstraße spät abends hielt und der Führer die dort im Erdgeschoß befindliche Kneipe betreten hatte. Der Führer, gleichzeitig der Besitzer des Kraftwagens, hat den Diebstahl nicht gemeldet, weil er in der Kneipe einen Brief von einem fragwürdig aussehenden Menschen zugesteckt erhielt und weil in diesem Briefe 10 000 Mark sowie ein Zettel lagen, der besagte, daß ihm das Auto sehr bald wieder zurückgegeben werden würde. Den Zettel hat Herr Emil Damm leider vernichtet. Er hat seinen Wagen nun ja auch wirklich zurückerhalten. – Jedenfalls: auch mit dieser Spur war es nichts! Und sonst haben wir ja keinerlei Anhaltspunkte, wer die vier Leute sein könnten. Ich komme soeben aus der Villa Niendorfs, aus Babelsberg, wo er in der Seestraße dicht am Griebnitz-See ein prachtvolles Grundstück besitzt. Seine Gattin nahm die Nachricht von seinem Tode sehr kühl entgegen und sagte mir ganz offen, daß sie keine Trauer heucheln könne, da ihr Mann sich in der kurzen Ehe als ein herzloser Egoist und Lebemann schlimmster Sorte entpuppt hätte. Sie half mir, Niendorfs Zimmer zu durchsuchen. Ich hoffte in seinem Schreibtisch irgend etwas zu finden, das auf ihm feindlich gesinnte Personen hingedeutet hätte. Als ich Frau Niendorf fragte, ob sie mir nicht in dieser Beziehung einen Wink geben könnte, erwiderte sie: „Und wenn ich es könnte, ich täte es nicht!“ – Jedenfalls muß diese schlanke, dunkelblonde Frau ihn über alle Maßen gehaßt haben. Ich dachte denn auch sofort an die Möglichkeit, daß sie jenes Weib gewesen, das in „Willbergs“ Keller Sie beide zuerst bewachte. Ich verhörte deshalb einzeln die Niendorfsche Dienerschaft. Es sind fünf Dienstboten ohne den Chauffeur im Hause. Der Chauffeur befindet sich seit acht Tagen bei seinen Eltern in Stettin zum Besuch. Die übrigen sagten übereinstimmend aus, daß Frau Niendorf seit drei Tagen die Villa nicht verlassen, sondern nur zuweilen auf dem Griebnitz-See gesegelt hätte. Wir werden Frau Niendorf hier also kaum in Betracht ziehen können. Die vier Leute bleiben mithin für uns leider das, was in jenem Briefe gesagt war, lieber Harst: Nebelschwaden!“
„Fahren wir zu Herrn Emil Damm,“ meinte Harald kurz.
Lenks Dienstauto wartete draußen. – Emil Damm wohnte in der Schlegelstraße. Er war daheim. Unterwegs hatte Lenk gefragt, was Harald denn bei Damm zu erfahren hoffe. Harst hatte nur mit einer Handbewegung geantwortet.
Als der dicke Herr Damm Haralds Namen hörte, wurde er etwas verlegen.
„Herr Damm,“ sagte Harst sehr bestimmt, „Sie haben Herrn Kommissar Lenk belogen. Überlegen Sie sich mal, ob es wirklich glaubwürdig ist, daß Sie gegen eine Sicherheit von nur 10 000 Mark Ihr Auto unbekannten Leuten überlassen werden?!“
„Sie nahmen sich’s ja,“ brummte Damm. „Ich gab es nicht. Fragen Sie doch bei dem Restaurateur Grupp nach, der Linienstraße 68 seine Kneipe hat. Grupp sah den Zettel und das Geld, ebenso auch den kleinen Kerl, der mir den Brief in die Hand drückte und wieder verschwand.“
Wir fuhren zu Grupp, nachdem Harald den maulfaulen Damm noch vergebens weiter ausgeforscht hatte.
Herrn August Grupp trafen wir beim Gläserspülen an. Er war noch dicker als Damm und noch maulfauler. Polizei und Detektive schien er nicht zu lieben.
„Ich kann’s jeder Zeit beschwören,“ sagte er, „daß Emil Damm hier am Schanktisch den Brief öffnete und mir das Geld erst zeigte. Dann las er den Zettel, rannte mit einem Male hinaus und rief: „Sie haben mir das Auto gestohlen!“ Er war erst sehr aufgeregt, beruhigte sich dann aber.“
„Haben Sie den Zettel gelesen, Herr Grupp?“
„Ne, Herr Harst. – Wo der Zettel geblieben ist, weiß ich nicht.“ –
Wir dankten dem Kneipwirt und traten auf die Straße hinaus.
„Was nun?!“ fragte Lenk mißvergnügt. „Sie sehen, lieber Harst, – auch Sie erreichen nichts.“
„Und dennoch hält zum mindesten Damm mit der Wahrheit zurück,“ erklärte Harald. „Ich werde schon dahinter kommen. – Haben Sie sich den Namen des Niendorfschen Chauffeurs und die Adresse seiner Eltern in Stettin angeben lassen?“
„Nein – nur den Namen. Damit ist aber nichts anzufangen. Denn der Mann heißt Fritz Schulze.“
„Es wird ja auch wohl keinen Zweck haben, sich zu erkundigen, ob dieser Schulze wirklich schon acht Tage bei seinen Eltern weilt,“ meinte Harst gleichgültig. „Nur eins könnten wir noch versuchen, Lenk: Lassen Sie Damm, Grupp und Frau Dora Niendorf unausgesetzt beobachten und geben Sie mir nach drei Tagen Bescheid, ob etwas dabei herausgekommen ist.“
„Gut – machen wir!“ nickte Lenk und bestieg das Dienstauto, das langsam hinter uns drein gefahren war. „Auf Wiedersehen!“ rief er noch. Dann rollte der Kraftwagen davon.
Harald sah nach der Uhr. „Halb zwölf. Da können wir der Frau Konsul Hersfeld einen Besuch abstatten –“
Wir fuhren nach dem Wittenbergplatz. – „Du hegst also doch Verdacht gegen Frau Niendorf?“ fragte ich, als wir über die Bellevue-Brücke fuhren.
„Nein. Ich suche nur eine Spur. Und deshalb versuche ich, diese Spur dort zu finden, wo nur irgend etwas vielleicht zu finden ist. Vorläufig sind die vier Leute für uns in der Tat Nebelgestalten – ungreifbar! Das einzige, was als winzige Fährte anzusehen ist, wäre Emil Damms Vorsicht bei seinen Aussagen. Ich bleibe dabei: er lügt; er kennt die Leute, die sein Auto stahlen!“
Die Konsulin, eine sechzigjährige Dame von imponierender Erscheinung, konnte uns über Frau Dora Niendorfs Herkunft und Jugendzeit nur so viel angeben, daß ihr Vater, der Graf van der Bloozen, einem alten holländischen Adelsgeschlecht entstammte und daß die gräfliche Familie in der Nähe von Stralsund ein kleines, überschuldetes Gut besäße, daß die Komtesse hier in Berlin Privatsekretärin der bekannten Schriftstellerin Magda Willbrock gewesen sei und Niendorf dann verhindert hätte, daß das Gut des Grafen unter den Hammer kam.
Wir blieben bei Frau Hersfeld eine Stunde etwa. Sie zeigte uns noch ein Bild, das bei einem Wohltätigkeitsfest[2] aufgenommen war. Frau Dora Niendorf stand ganz im Vordergrund der Gruppenaufnahme. Ihr Gesicht war schlecht zu erkennen. – Harst bat die Konsulin um ein Vergrößerungsglas. Dann betrachtete er mit Hilfe dieses Frau Niendorfs Antlitz sehr lange, fragte dabei:
„Hat sie irgend welche besonderen Kennzeichen, Frau Konsul?“
„Nein.“
„Danke.“ Er reichte Frau Hersfeld Bild und Vergrößerungsglas zurück. –
Als wir das Haus verließen, sagte Harald auf der Treppe:
„Wieder nichts! Man greift stets in die leere Luft. – Nun zu Magda Willbrock nach der Knesebeckstraße 82.“
Die Schriftstellerin war nicht zu Hause. Aber die uns öffnende ältere Frau stellte sich uns als die Haushälterin der Willbrock vor. Auf Harsts liebenswürdige Frage erklärte sie, daß sie bereits fünfzehn Jahre bei Fräulein Willbrock sei, und fügte stolz hinzu: „Ich bin Magdas Vertraute. Ihre Mutter war meine beste Freundin. Ich heiße Langfeld.“
Harst nannte nochmals seinen Namen und betonte seinen Vornamen. Da erst wurde die Langfeld aufmerksam.
„Höre ich richtig? Herr Harst? Der Liebhaberdetektiv Harst?“ meinte sie erfreut. „Kann ich Ihnen mit irgend etwas dienen? – Aber – wollen die Herren nicht näher treten. Bitte, hier herein –“
Wir saßen dann in einem sehr eigenartig eingerichteten Salon.
„Frau Langfeld,“ sagte Harald, „auf Ihre Verschwiegenheit darf ich wohl rechnen. Ich möchte gern einiges über die ehemalige Privatsekretärin Fräulein Willbrocks, über die Komtesse van der Bloozen, erfahren, die in einer etwas dunklen Angelegenheit eine ganz nebensächliche Rolle als Mitleidtragende spielt, ohne dies bisher zu wissen.“
„Ah – die Komtesse,“ meinte die Langfeld bereitwilligst. „Die ist ja längst verheiratet – mit dem Kommerzienrat Niendorf, über den unlängst –“
Harst wehrte ab. „Niendorf interessiert uns nicht. – Wie denken Sie über die Komtesse, Frau Langfeld?“
„Ein Charakter, Herr Harst! Ein Mädchen von ganz vorzüglichen Eigenschaften war sie!“ Das klang ehrlich begeistert. „Ich kann ihr nur das allerbeste Zeugnis ausstellen. Nur – etwas verschlossen war sie. Man redet da über ihre Heirat mit Niendorf so allerlei. Sie weinte damals vor ihrer Verlobung sehr viel. Wir wohnten hier Zimmer an Zimmer. Ich hörte sie jede Nacht schluchzen und herzzerbrechend wimmern. Ich ging dann wiederholt zu ihr. Aber sie blieb stumm. Ich kam so auf den Verdacht, daß sie Niendorf nur gezwungen heiratete, daß sie eine andere Liebe im Herzen trüge und daß wohl noch eine besondere Art von Geheimnis dabei mitspiele.“
„Wie entstand gerade diese letzte Vermutung bei Ihnen, Frau Langfeld?“
Sie wurde etwas verlegen. „Die Komtesse führte ein Tagebuch, Herr Harst,“ erwiderte sie leise.
„Und das Buch lag wohl mal aufgeschlagen da, so daß Sie einiges lesen konnten,“ half Harald ihr über dieses Eingeständnis einer echt weiblichen Neugier hinweg. „Was lasen Sie denn da, Frau Langfeld?“
„Ich besinne mich auf die Sätze noch recht genau. Sie lauteten dem Sinne nach:
Kein Zweifel mehr! Er hat auch ihn in seiner Gewalt, hat mit teuflischem Raffinement auch dieses Opfer in seine Schlingen gelockt. Aber – es gibt eine Vergeltung, wenn nicht hier auf Erden, dann im Jenseits! Es muß einen gerechten Richter über den Wolken geben – muß! Sollen denn solche Schurken ganz ungestraft hier auf Erden ihr Dasein genießen dürfen?! Unser ganzes Leben wäre widersinnig und zwecklos, wenn nur der bloße Zufall hier unsere Geschicke regieren sollte!
Im übrigen, Herr Harst, enthielt das Tagebuch zumeist recht ernste philosophische Betrachtungen.“
„Können Sie sonst über die Komtesse etwas Besonderes mir mitteilen, Frau Langfeld?“
„Da wäre vielleicht etwas sehr Merkwürdiges zu erwähnen, das nur ich weiß, weil ich eben mein Zimmer neben dem ihren hatte. Ich habe mir nie erklären können, weshalb sie nachts so oft den gelben Sonnenvorhang ihres Fensters auf und zu zog. Manchmal hörte ich das Geräusch der über die eiserne Stange hingleitenden Ringe eine volle Stunde.“
Harst blickte vor sich hin und meinte gleichgültig:
„Der Vorhang hatte Zugschnüre?“
„Natürlich. In der Stille der Nacht hört man ja das geringste Geräusch. Und deshalb –“
„Schon gut, Frau Langfeld. – Brannte in der Komtesse Zimmer Licht, wenn sie – vielleicht aus Nervosität – den Vorhang hin und her bewegte?“
„Ja – ihre Nachttischlampe brannte dann stets.“
„Das Zimmer lag wohl nach dem Hofe hinaus?“
„Ganz recht.“
Gleich darauf verabschiedeten wir uns.
2. Kapitel.
„Auch hiermit ist nichts anzufangen,“ meinte Harald, als wir die stille Knesebeckstraße entlanggingen. „Gewiß, das Tagebuch Doras wäre ja bedeutungsvoll, aber nur dann, wenn sie in der verflossenen Nacht nicht daheim gewesen wäre. Lenk sagte, sie sei zu Hause gewesen. Also kann sie nicht die Frau gewesen sein, die uns bewachte und uns vorher im Tiergarten den anderen Leuten in die Hände spielte, indem sie mich wehrlos machte.“
„Wenn sie nun aber nicht zu Hause war?! Die Dienstboten können ihre Herrin doch nicht die ganze Nacht im Auge behalten haben!“
„Stimmt! Und deshalb werden wir jetzt nach Babelsberg hinausfahren und ganz einwandfrei festzustellen suchen, ob Frau Dora sich nicht etwa nur zum Schein gestern abend in ihr Schlafzimmer zurückgezogen hat.“ –
Wir benutzten einen Stadtbahnzug von der Station Savigny-Platz aus. In Babelsberg aßen wir zunächst auf dem Bahnhof Mittag. Der Kellner wurde von Harst vorsichtig ausgefragt. Er war in Babelsberg ansässig und wohnte, wie wir bald erfuhren, drei Häuser von der Niendorfschen Villa entfernt. – So allmählich hörten wir noch mehr von dem gesprächigen Manne: daß Frau Niendorf den Gärtner Muhl noch in der Nacht gegen ein Uhr nach der Apotheke geschickt hätte, da sie an starker Migräne litt. Der Gärtner war ein guter Bekannter des Kellners.
Harst gab diesem hundert Mark. „Bestellen Sie irgendwie den Gärtner hierher,“ bat er. „Aber sofort! Dann bekommen Sie noch hundert Mark.“
Eine halbe Stunde später war Muhl zur Stelle.
Harald zeigte ihm seine Legitimation. „Sie sehen,“ sagte er ernst, „daß ich die polizeiliche Genehmigung habe, als Detektiv tätig zu sein. Ich bin leidlich bekannt, Herr Muhl. Sie dürfen zu mir Vertrauen haben, müssen aber auch über alles schweigen, was wir hier verhandeln. – Haben Sie Frau Niendorf in der verflossenen Nacht selbst gesprochen, als Sie ihr die Pulver besorgen mußten?“
„Ja, Herr Harst. Ich reichte der gnädigen Frau die Pulver ins Schlafzimmer. Sie hatte einen Morgenrock an und schenkte mir zwanzig Mark. Ich wünschte ihr noch gute Besserung.“
„Und es war bestimmt Frau Niendorf?“
Muhl lächelte. „Aber Herr Harst, ich werde doch wohl unsere gnädige Frau kennen! Sie war’s! Dafür lege ich den Kopf auf den Block!“
„Sie werden’s vielleicht beschwören müssen –“
„Gut – meinetwegen sofort!“ –
Muhl erhielt dann ebenfalls hundert Mark und ging zufrieden davon.
Harald blickte mich trübselig an. „Nun sind wir mit unserem Latein ganz zu Ende! Du hörtest ja: es war Frau Dora! – Muhl hat es nicht für nötig gehalten, seinen nächtlichen Gang zur Apotheke Lenk gegenüber zu erwähnen. Auch dies spricht für den Gärtner und seine Wahrheitsliebe. Lenk kann das Hauspersonal also nur sehr vorsichtig ausgefragt haben. – Fahren wir heim! Hier sind wir ja auf dem Holzwege. Es sind eben – Nebelgestalten, die wir verfolgen.“ –
Zu Hause angelangt, beschäftigte Harald sich mit Gartenarbeiten, bis gegen sieben Uhr ein Klient erschien, ein Herr von Bronk, Regierungsassessor a. D. und Syndikus einer großen Aktiengesellschaft.
Ein tadellos angezogener Herr mit Monokel und jener unnachahmlichen Ruhe in Sprache, Gesten und ganzem Auftreten, die ihn sofort als Zugehörigen erster Kreise auswiesen. Er hatte einen Verlust zu beklagen: er hatte heute mittag in der Straßenbahn seine Aktentasche mit wichtigen Papieren vergessen!
Harald schickte ihn höflich weg. Bronk entschuldigte sich und zog enttäuscht ab, nachdem er noch gefragt hatte, ob Harst denn gerade einen Fall in Arbeit und daher keine Zeit hätte. Er schien gar nicht zu begreifen, daß Harald Harst denn doch nicht dazu da war, Aktentaschen zu suchen, die jemand irgendwo liegen gelassen hatte.
Als Herr von Bronk durch den Vorgarten schritt, stand Harald hinter der Gardine, schaute ihm nach und sagte ganz unvermittelt:
„Einen haben wir!“
Er betonte das so seltsam, daß ich ihn verdutzt anstarrte.
Und – er lächelte.
„Wie fein gebügelte Beinkleider Bronk trägt! Und so tadellose dunkelbraune Schuhe! Nachts trug er – Lackstiefel mit Stoffeinsatz!“
„Was heißt das?!“ platzte ich heraus. „Mach’ doch keine Witze! Wie willst Du –“
„Gestatte, lieber Alter: die beiden, die den Baron Toornward in „Willbergs“ Keller auf das Bett legten, standen so, daß ich dem einen in sein tadellos gebügeltes Beinkleid unten eine Stecknadel so hineinstecken konnte, daß nur der Kopf noch herausschaute. Und – dieses Erkennungszeichen, den Stecknadelkopf, hättest Du bei Herrn von Bronk bemerken können.“
Und ich dachte daran, daß ich ja selbst gesehen hatte, wie Harald das Beinkleid des einen Mannes berührte. „Wenn nun aber dieser Bronk gar nicht Bronk heißt?! Wäre es nicht besser, ihm zu folgen? Er kann sich einen beliebigen Namen –“
Harst ging schon in den Flur und nahm Hut und Stock, sagte nur:
„Manchmal redest Du sehr überflüssiges Zeug, mein Alter!“ –
Der Mann, der sich von Bronk nannte, drehte sich nicht ein einziges Mal bis zur nächsten Haltestelle der Straßenbahn um. So blieben wir denn in aller Bequemlichkeit hinter ihm. Er fuhr bis zum Zoologischen Garten, stieg aus und schlenderte die Kantstraße hinab, wobei er wiederholt halt machte und seine Zigarre immer wieder anbrannte. Dabei war diese offenbar gar nicht ausgegangen. Als er wieder ein Zündholz halb verkohlt weggeworfen hatte, flüsterte Harald (wir waren etwa hundert Meter hinter Bronk): „Ich werde es aufheben!“
Er tat es. Inzwischen hatte Bronk schon zwei weitere Zündhölzer benutzt und sie auf den Bürgersteig fallen lassen.
Auch diese hob Harald auf.
Als er sich nun nach einem neuen Zündholz bückte, trat plötzlich ein Herr an uns heran dessen linke Wange mehrere Schmißnarben hatte und sagte mit einer gewissen Schärfe:
„Bitte – geben Sie mir die abgebrannten Zündhölzer. Sie sind nicht für Sie bestimmt!“
Harald blickte den elegant gekleideten Herrn sehr kühl an.
„Ich hebe auf, was mir gut erscheint!“ meinte er kurz. – Ich glaubte einen gewissen Doppelsinn aus den Worten herauszuhören.
„Sie werden mir die Zündhölzer aushändigen!“ fuhr der Herr barsch auf.
Harald lachte. „Ich rate Ihnen, sich zu entfernen –“
Mehr verstand ich nicht, da ich inzwischen auf den Gedanken gekommen war, Bronks weitere Zündhölzer aufzulesen. Ich ging also davon. Ich fand noch drei. Bronk selbst war verschwunden.
Dann gesellte sich Harald mir wieder zu, sagte leise auflachend: „Er drückte sich, der Kerl! Da springt er in ein Auto!“
Es war der Herr mit den Schmissen. –
Die Zündhölzer waren von jener breiten, rotgefärbten Sorte, die nicht gerade häufig ist. – In einer kleinen Konditorei prüften wir sie.
Und – jedes Zündholz hatte tatsächlich etwas Besonderes an sich: eine Aufschrift mit Tinte! – Die sieben Zündhölzer enthielten folgende Worte, jedes eins:
elf, Sieglindenstr., heute, zwölf, bestimmt, Mansarde, rechts.
„Es mußte ja mit diesen Zündhölzern irgend eine Bewandtnis haben,“ meinte Harald und hielt mir das Zigarettenetui hin. „Die ganze Art, wie dieser Herr von Bronk die Streichhölzer wegwarf, nachdem er sie kaum angezündet hatte, war ebenso ungeschickt wie auffallend.“
„Also eine Nachricht für den Herrn mit den Schmissen,“ sagte ich darauf. „Eine sehr eigentümliche Nachricht, die nur den einen Schluß zuläßt, daß die beiden Herren scharf beobachtet werden und nicht wagen, anderswie Mitteilungen auszutauschen.“
„Es gibt noch eine zweite Erklärung für dieses Streichholztelegramm,“ lächelte Harald fein. „Zunächst wollen wir aber die sieben Worte ordnen.“
„Was nicht schwer ist,“ behauptete ich. „Ich würde folgenden Satz daraus formen:
Heute bestimmt zwölf (Uhr) Sieglindenstraße (Nr.) elf, Mansarde rechts,
was einen durchaus logischen Inhalt ergibt.“
„Du hast recht, kehren wir heim. Wir werden aber nicht um zwölf, sondern schon früher Sieglindenstraße 11 besuchen. Holen wir unser Handwerkzeug.“
Wir fuhren in einem Taxameterauto nach Hause. Unterwegs fragte ich: „Glaubst Du, daß außer Bronk auch der andere mit den Schmissen zu dem Fall Niendorf in Beziehung steht? Bronk ist ja bereits durch die Stecknadel überführt.“
„Ich glaube nichts. Ich werde prüfen. Und fällt die Prüfung so aus, wie ich beinahe erwarte, dann werde ich auf Deine Frage mit Ja antworten.“ –
Die Sieglindenstraße in Steglitz, dem westlichen Berliner Vorort, war erst zum Teil bebaut. Gegen zehn Uhr schritten wir in der Maske bärtiger Telephonarbeiter diese Straße entlang. Nr. 11 stand für sich allein inmitten kleiner Laubengärten. Es war die übliche bessere Mietskaserne, vier Stock hoch mit zurückspringendem Giebel und Mansardenfenstern nach jeder Seite.
Die Haustür war noch offen. Der Portier scheuerte den Flur. Als er mit seinem Eimer in seiner Wohnung verschwand, traten wir schnell ein und gingen leise die beläuferten Treppen empor. Niemand begegnete uns. Wir kamen auf den Vorboden. Wir machten halt und lauschten. Dann knipste Harst seine Taschenlampe an. Rechter Hand bemerkten wir an der Tür der einen Mansardenwohnung eine mit Heftzwecken befestigte Visitenkarte. An der anderen Tür befand sich ein Porzellanschild: August Aubner, Kunstmaler.
Auf der mit Tinte ausgeschriebenen Visitenkarte aber stand:
Graf Emanuelo Parmano.
Harald läutete bei dem Maler an. Ein vertrocknetes Männchen öffnete, nachdem er zunächst die Sicherheitskette eingehakt gelassen hatte. Harst flüsterte ihm jedoch seinen Namen zu, und das zerstreute alle Ängstlichkeit Herrn Aubners.
Er führte uns in sein Atelier.
„Herr Aubner,“ sagte Harald, „Ihr Name ist mir nicht fremd. Sie sind Illustrator für medizinische Werke. Sie haben auch einen Teil der Illustrationen für das Buch „Die gerichtliche Medizin“ geliefert. – Ich möchte gern wissen, wer Ihr Mansardennachbar ist.“
Aubner hob die Schultern. „Ich kenne ihn nicht. Er wohnt erst eine Woche hier. Ich habe ihn noch nicht zu Gesicht bekommen.“
„Ob er jetzt daheim ist?“
„Das glaube ich nicht. Seine Möbel sollen erst morgen eintreffen. Er hat sich vorläufig ein Feldbett und einen Waschtisch vom Portier Mischke unten geborgt. Mischke erzählte mir, der Graf sei Italiener und wolle hier in Berlin Kunststudien treiben. Es soll ein sehr eleganter Herr sein, der mit dem Gelde nur so um sich wirft.“
„Danke, Herr Aubner. – Ich bitte Sie, unsern Besuch gänzlich zu vergessen.“
„Ich werde schweigen. – Gute Nacht, meine Herren.“
Wir gingen zum Schein die Treppe hinab, machten dann aber kehrt und läuteten bei dem Grafen an.
Niemand erschien. Harald nahm den Patentdietrich und drückte den Schloßriegel zurück. Die Tür ging auf. Ich klinkte sie wieder ein und legte auf Haralds Wink die Sicherheitskette vor.
Die beiden Zimmer, Küche und Nebengelaß waren bis auf Bett, Waschtisch und einen mittelgroßen Koffer leer.
Harald machte sich sofort an den Koffer heran. Das Schloß war gut. Er mußte eine Weile sich abmühen, bevor er es geöffnet hatte. Der Koffer enthielt gebündelte alte Zeitungen und allerlei Handwerkszeug, das ganz neu war: Holzbohrer, Feilen, drei Stahlsägen, zwei Stemmeisen und fünf kleine Rollen starken Blumendraht.
Harst verschloß den Koffer wieder und flüsterte: „Die Kunststudien des Grafen scheinen besonderer Art zu sein!“
Dann besichtigten wir die kleine Wohnung eingehender. Die Fenster gingen nach der Seite hinaus. Harald hatte das eine geöffnet, seine Lampe ausgeschaltet und sich hinausgelehnt.
Es war draußen sehr dunkel. Am Himmel war nicht ein einziger Stern zu sehen. Ein hohler Wind umpfiff das Gebäude und trieb schwere, schwarze Wolken gen Osten.
„Komm’ mal her,“ meinte Harald dann.
Auch ich beugte mich hinaus und konnte so an der grauen Fläche der Hauswand entlang auf die Laubengärten hinabblicken, die bis an das Gebäude heranreichten. Allmählich unterschied ich da unten Einzelheiten: das Dach eines Bretterhäuschens und zwei erleuchtete Fenster dieser Sommerlaube.
Ich sah noch mehr. Das eine Fenster stand offen, und jetzt schwebte aus diesem Fenster langsam etwas zu uns empor – etwas, das seiner Art nach nicht zu erkennen war, – etwas wie ein breites Band.
„Eine Strickleiter!“ hauchte Harald mir ins Ohr. „Man zieht sie an dünnen Blumendrähten hoch. Da – hörst Du nicht das leise Quietschen von Metallrollen? Sie müssen unter dem Fenstersims des zweiten Fensters dieses Zimmers befestigt sein. – Sehen wir nach.“
Wir sahen nach – mit äußerster Vorsicht – und fanden tatsächlich zwei kleine Haken mit Rollen in der Mauer, darunter aber zwei starke, besonders gebogene Haken.
„Diese sind für die Strickleiterringe,“ meinte Harst. „Eine feine Einrichtung! Die Ringe der Strickleiterenden müssen von selbst über die Haken gleiten. Warten wir ab.“
Und die Strickleiter schwebte höher und höher.
Wir paßten auf. Nun ein leises metallisches Geräusch. Die Ringe waren in die Haken gefallen, wie Harald sich durch Betasten überzeugte, ohne sich am Fenster in voller Figur zu zeigen.
3. Kapitel.
„Was soll das?!“ meinte ich erstaunt.
Harst schwieg minutenlang.
„Entferne die Sicherheitskette der Flurtür,“ sagte er dann. „Die Sache gefällt mir nicht. Ich werde nicht daraus klug.“
Ich tastete mich im Dunkeln vorwärts, öffnete die Tür nach dem kleinen Flur und hakte die Kette los. Als ich zurückschleichen wollte, hörte ich auf dem Vorboden das Knarren der Dielen, das auch uns vorhin geärgert hatte.
Ich blieb stehen. Ein Schlüssel wurde ins Schloß geschoben. Schnell zog ich mich zurück, war im Moment neben Harald, der sich als dunkler Strich an dem einen Fenster abzeichnete.
„Es kommt jemand,“ flüsterte ich atemlos vor Erregung.
„Dann in das kleine Zimmer nebenan! Vorwärts!“
Wir zogen die Tür zu, zogen aber auch für alle Fälle unsere Clementpistolen. Harst hatte es zuerst getan. Ich sah nichts. Ich vernahm nur das schwache Knacken der zurückgleitenden Sicherung.
Nebenan jetzt schleichende Schritte und Flüstern. Und plötzlich ward die Tür, hinter der wir standen, aufgerissen. Ein blendend weißes Licht hüllte uns ein, blendete uns.
Ein paar Männer stürzten sich auf uns – Männer, die uns mit Leichtigkeit niederrangen. Ich wehrte mich verzweifelt, bis Harst rief:
„Laß das doch! Weshalb die Anstrengung?!“
Und dann eine wohlbekannte Stimme, die unseres Freundes Lenk, des langen Kommissars:
„Verdammt – das scheint Harst zu sein!“
Lenks Beamte gaben uns frei. Die Parteien standen sich keuchend gegenüber.
„Das ist ja eine nette Bescherung!“ meinte Lenk. „Ich bin hier scheußlich genasführt worden.“ Er drückte uns die Hand. „Ja – regelrecht genasführt! Ich erhielt heute gegen sieben Uhr abends einen anonymen Brief durch einen geheimnisvollen Boten. In dem Briefe riet mir „ein Freund der Polizei“, heute gegen elf Uhr in diese Wohnung einzudringen, wo die Brüder Steiner, also die beiden Mieter Herrn Allins, verborgen sein sollten. Der Brief war in echtem Kaschemmendeutsch abgefaßt. Jedenfalls ließ ich das Haus von acht Uhr ab beobachten, sah zwei Telephonarbeiter in verdächtiger Weise hineinschlüpfen und – so kam dieser Überfall zu Stande. – Was treiben Sie denn nun hier, bester Harst?“
Harald setzte sich auf das Feldbett. „Einen Moment, Lenk! Die Geschichte ist eine Mirakulum wert.“
Er begann zu rauchen. Wir umstanden schweigend das Feldbett.
Nach einer Weile sah Harst nach der Uhr. „Bereits halb zwölf!“ sagte er und erhob sich. „Es war Leim! Sie, lieber Lenk, erhielten einen Brief, und Schraut und ich sammelten sieben Zündhölzer auf. Man hat uns beide geleimt!“ – Er erzählte, was wir mit Herrn von Bronk und mit dem andern mit den Schmissen erlebt hatten.
„Ich habe daheim schon festgestellt, daß es keinen Herrn von Bronk in Berlin gibt,“ fügte er dann hinzu. „Im Berliner Adreßbuch ist er nicht zu finden. – Wer also ist dieser Mensch?! – Nun – wir werden ihn schon aufstöbern! Jedenfalls gehört er zu den vier Nebelgestalten und erschien wohl nur deshalb bei mir, um mich hinter sich her zu locken, damit ich die Zündhölzer fände! Sie verstehen, Lenk: die Zündhölzer waren Bluff! Man wollte Schraut und mich heute abend hierher dirigieren, damit man anderswo etwas anderes unbelästigt von uns unternehmen könnte. Selbst die Strickleiter war nur ein Mittel, mich zu veranlassen, hier in der leeren Wohnung auszuharren Es kam mir ja gleich recht merkwürdig vor, daß die Strickleiter gerade hochgewunden wurde, als ich hinabschaute.“
Lenk schüttelte den Kopf. „An diesen Bluff glaube ich nicht, lieber Harst! Nein – das kann ich nicht. Daß man Sie nur hier –“
„Bitte – bleiben Sie bei Ihrer und ich bei meiner Ansicht, Lenk!“ fiel Harald ihm ins Wort. „Jedenfalls werden Schraut und ich jetzt schleunigst anderswohin gehen. – Auf Wiedersehen –“
Er eilte hinaus. Und ich folgte. Lenk aber blieb hinter uns.
An der nächsten Straßenecke hielt ein geschlossenes Polizeiauto.
„Nach Babelsberg, bitte,“ sagte Harald zu dem Kommissar.
Wir drei stiegen ein. Es hatte zu regnen begonnen. Wir sahen bei dieser Dunkelheit nur die roten Pünktchen unserer Zigaretten im Auto.
„Also doch Frau Dora Niendorf!“ meinte Lenk, der bisher genau so stumm gewesen wie wir.
„Dann wissen Sie mehr als ich, Lenk!“ entgegnete Harst, der tief in der einen Ecke des Rücksitzes lehnte. „Ich weiß bisher nur, daß der angebliche von Bronk eine der vier Nebelgestalten ist, und vermute, daß die zweite der Herr mit den Schmissen sein kann. Was ich noch vermute, wird sich in Babelsberg herausstellen. – Wo haben Sie dort Ihre zur Bewachung der Villa Niendorf kommandierten Leute postiert?“
„Einen vor der Villa, einen zweiten im Nebenhause als Sommergast, zwei weitere auf dem Wasser mit einem Motorboot.“
„Sehr gut, Lenk, sehr gut!“
Damit hatte das Gespräch wieder ein Ende. –
Das Auto hielt auf der Straße in der Nähe des Westufers an der Kanalbrücke. Es sprühte noch immer mit Regen. Wir gingen von hier zu Fuß die Seestraße entlang. Nach vier Minuten pfiff Lenk in besonderer Weise. Aus der Dunkelheit löste sich eine Gestalt und kam auf uns zu.
„Etwas Neues, Müller?“ fragte Lenk seinen Beamten.
„Hier nicht, aber auf der Wasserseite, Herr Kommissar,“ erwiderte Müller. „Renborn war vor zehn Minuten hier und sagte mir, Sie möchten doch aufs Boot kommen, es gebe so allerlei zu berichten.“
Wir machten kehrt und umrundeten den See, der ja nur am Südufer bebaut ist. Der Waldpfad zieht sich dicht am Wasser hin. Sehr bald bemerkten wir einen dunklen Gegenstand unweit des Ufers. Eine Erle war hier unterspült worden und hatte sich fast bis auf den Wasserspiegel gesenkt, bildete so einen natürlichen Anlegesteg.
Lenk pfiff wieder. Der dunkle Gegenstand, das Motorboot, näherte sich dem Baume. Es war an diesem vertäut. Wir kletterten an Bord. Das kleine Fahrzeug hatte vorn ein Verdeck aus geölter Leinwand. Diese winzige Kajüte ließ sich durch Vorhänge verschließen.
Wir saßen hier gegen Wind und Regen geschützt. Renborn hatte eine Pendellampe angezündet. Wir blickten gespannt in sein mageres Gesicht, dessen intelligente Züge und lebhafte Augen einen Mann von besonderer Intelligenz verrieten.
„Los, Renborn!“ meinte Lenk. „Was haben Sie beobachtet?“
„Kurz vor elf Uhr näherte sich von Osten her eine kleine Motorjacht,“ begann der Beamte. „Ich wurde auf sie sofort aufmerksam, als sie hier gegenüber der Villa etwa dreißig Meter von uns ab Anker warf. Wir lagen dicht an der Krone der umgesunkenen Erle mit unserem Boot und waren kaum zu bemerken. Mein Glas ließ mich auf der Jacht zwei Herren in Sportanzügen erkennen. Der eine stand auf dem Deckaufbau und schaute gleichfalls mit einem Glase nach der Villa hinüber. Diese hatte bisher nur drei Fenster im Erdgeschoß erleuchtet gehabt. Es war genau elf Uhr, als im ersten Stock noch zwei Fenster hell wurden, deren Vorhänge nicht zugezogen waren. Nun beobachtete ich etwas sehr Merkwürdiges. An dem einen Fenster wurde der Vorhang mindestens zehn Minuten lang in Pausen hin und her gezogen, bald bis zur Hälfte nur, bald nur ein Viertel, bald ganz geschlossen, wieder geöffnet und so fort. Es machte auf mich den Eindruck, als ob –“
„– dies eine verabredete Zeichensprache war,“ vollendete Harald, der Lenk bisher von unserem Besuch bei der Schriftstellerin nichts mitgeteilt hatte.
„Ganz recht, Herr Harst,“ nickte Renborn. „Auch der Herr auf dem Kajütaufbau ließ dann eine elektrische Taschenlampe eine Weile länger und kürzer aufleuchten. Hierauf wurden die Fenster wieder dunkel. Aber die Jacht blieb noch auf demselben Fleck liegen, entfernte sich erst, nachdem drüben mit dem Vorhang wieder ein paar Signale gegeben worden waren. Sie entfernte sich so plötzlich, daß wir darauf verzichten mußten, ihr zu folgen. Vielleicht wäre eine Verfolgung auch gar nicht zweckmäßig gewesen.“
„Nein,“ meinte Harst. „Es war richtiger, daß Sie hier blieben, Herr –“
In demselben Moment wurde der Türvorhang zurückgeschoben, und der andere Beamte rief leise:
„Die Jacht!“ –
Unser Boot lag wieder an dem Baume. Es regnete stärker. Wir konnten die Jacht nur als Schatten und an dem Motorgeräusch erkennen.
Jetzt stoppte der Motor.
„Lenk,“ flüsterte Harald. „Schraut und ich werden hinüberschwimmen und –“
Renborn, der mit dem Glase neben uns stand, meldete da: „Ein Ruderboot nähert sich der Jacht von der Villa her. Eine Dame und ein Mann sind darin –“
Harald nahm Renborn das Glas ab. Nach einer Weile gab er es Renborn hastig zurück.
„Die Frau ist auf die Jacht übergestiegen,“ sagte er. „Der Mann rudert zurück. Vorwärts – ran an die Jacht! Los mit dem Tau!“
Renborn sprang schon nach hinten.
Der Motor begann zu arbeiten.
Aber auch die Jacht glitt vorwärts, wendete und jagte gen Osten.
Doch unser Boot war schneller. Wir kamen näher und näher.
Die Jacht änderte plötzlich den Kurs und hielt auf das bewaldete Ufer zu.
Noch fünfzig Meter – noch vierzig. Wir fieberten vor Jagdeifer.
Dann rief Lenk, mit den Händen als Sprachrohr am Munde:
„Halt – hier Kriminalpolizei! Stoppen Sie sofort!“
Die Jacht fuhr langsamer. Wir sahen, wie sie auf einen ins Wasser hinausgebauten Brettersteg zulief, wie die Dame mit einem Satz den Steg erreichte und eiligst im Walde verschwand.
Lenk fluchte.
Die Jacht glitt mit abgestelltem Motor noch fünfzig Meter weiter.
„An den Steg heran!“ rief Harald. „Schraut – ihr nach!“
Unsere Taschenlampen flammten auf. Wir sprangen auf die morschen Bretter. Waldesrauschen empfing uns. Wir trennten uns; wir suchten eine Viertelstunde – alles umsonst. Dann stellten wir uns bei dem Brettersteg wieder ein. Hier lagen nun die beiden Fahrzeuge nebeneinander. Renborn half uns an Deck unseres Bootes, sagte kleinlaut: „Herr Lenk sitzt mit den beiden Herren in der Kajüte der Jacht. Denken Sie sich, Herr Harst: es sind zwei sehr bekannte Persönlichkeiten: der Fabrikbesitzer Geheimrat Panzer und dessen Generaldirektor Graf von Asten! – Die beiden haben dem Kommissar erklärt, daß ihre Privatangelegenheiten die Polizei gar nichts angingen; Er möge ihnen doch mal sagen, was man ihnen vorzuwerfen hätte. Na – der Herr Kommissar ist nun übel in der Zwickmühle! Er hofft, daß Sie der Sache eine andere Wendung geben werden.“
„Das werde ich! Ich kenne die Herren persönlich. Es sind Mitglieder des Universum-Klubs, dem auch ich angehöre.“
Wir gingen auf die Jacht hinüber und stiegen die Treppe zur Achterkajüte hinab. Als wir eintraten, saßen Lenk und die beiden Herren am Tisch und starrten finster vor sich hin.
Wir begrüßten den Geheimrat und den Grafen ganz zwanglos. Panzer war ein noch sehr jung aussehender Fünfziger. Der Graf Asten konnte Mitte Dreißig sein.
„Frau Niendorf befindet sich drüben in unserem Boot,“ sagte Harald dann leichthin. „Sie war über eine Wurzel gestolpert und –“
Das harte Auflachen des bekannten Großindustriellen, den man für den drittreichsten Mann Deutschlands hält, ließ Harald verstummen.
„Herr Harst,“ sagte Panzer eisig, „mit solchen Tricks fangen Sie uns nicht! Frau Niendorf befindet sich in ihrer Villa!“
Harald drehte sich um und ging hinaus. Gleich darauf schossen die Jacht und unser Boot dem Anlegesteg der Villa zu. – Wir beide und Lenk begaben uns durch den in Terrassen ansteigenden Garten zum Vordereingang und läuteten. Lenk lief noch schnell auf die Straße und rief Müller herbei. Der Beamte beteuerte, daß niemand die Villa verlassen oder betreten habe.
Dann wurde uns von einem Mädchen nach gut zehn Minuten geöffnet. Lenk verlangte Frau Niendorf zu sprechen. Die Zofe erklärte, sie würde die gnädige Frau wecken.
Wir drei gingen in den ersten Stock hinauf und beobachteten aus einiger Entfernung die Zofe, die an eine Tür klopfte.
Die Tür tat sich eine Handbreit auf. Das Mädchen flüsterte mit jemand. Dann eine angenehme Stimme:
„Meine Herren, gedulden Sie sich nur einige Minuten.“
„Bitte, gnädige Frau,“ rief Lenk zurück.
Die Schlafzimmertür schloß sich wieder. Harst und ich schauten uns an.
„Es war dieselbe Stimme,“ meinte Harald leise, „die Stimme der Maskierten, die uns bewachte! Es war dieselbe Frau, die im Tiergarten um Hilfe rief und mich festhielt, daß[3] ich mich nicht wehren könnte!“
Die Zofe trat näher. „Ich werde die Herren in den Salon führen,“ sagte sie.
„Danke!“ lehnte Lenk ab. „Wir bleiben hier. Wir sind schon genügend genasführt worden!“
Nach drei Minuten bereits erschien Frau Dora Niendorf in einem eleganten Morgenkleid.
Im Flur brannten vier Deckenlampen. Wir beide, Harald und ich, waren überrascht von der eigenartigen Schönheit dieser Frau, die uns nun mit vollkommener Ruhe begrüßte.
Lenk stellte uns vor. Wir beide in unseren Kostümen als Telephonarbeiter machten unsere Verbeugung. Dann fragte Lenk auch schon sehr dienstlich:
„Haben Sie die Villa in dieser Nacht verlassen, Frau Niendorf?“
„Nein.“ Das klang ablehnend kühl.
„Gut – dann werden Herr Harst und ich Ihr Schlafzimmer jetzt durchsuchen, während Herr Schraut hier bei Ihnen bleibt.“
„Und weshalb?“ rief sie jetzt scheinbar empört.
„Weil der Koffer mit den anderthalb Millionen noch immer fehlt, gnädige Frau,“ erklärte Harald höflich. „Es wäre wirklich besser, Sie würden endlich der Wahrheit die Ehre geben. Sie wollten vorhin mit der Motorjacht entfliehen. Wir werden hier im Hause Ihre noch schmutzigen Schuhe, den regenfeuchten Mantel und den Lackhut finden.“
Frau Niendorf schüttelte leicht den Kopf. „Ich begreife all das nicht. Aber – bitte, suchen Sie! Ich habe die Villa nicht verlassen!“
Lenk und Harald zögerten noch. Dann sagte Harald: „Allerdings, Sie konnten auch kaum, falls Sie der Flüchtling waren, bereits auf dem Landwege die Villa wieder erreicht haben, gnädige Frau –“
„Ich schwöre es Ihnen: ich war hier in der Villa!“ rief sie da, und es kam mir vor, als ob sie jetzt nur deshalb ganz ruhig war, weil sie wußte, daß wir den Flüchtling nicht ergriffen hatten.
„Wer war die Dame denn?“ meinte Harst, indem er Frau Niendorf forschend beobachtete.
„Ich weiß es nicht, Herr Harst –“
„Würden Sie auch dies beschwören, gnädige Frau?“ fragte er langsam.
Sie senkte den Kopf, hob ihn wieder.
„Meine Privatangelegenheiten gehen die Polizei nicht das geringste an!“ sagte sie schroff.
„Wenn man Schraut und mich im Tiergarten brutal zu Boden schlagen läßt, genügt schon dies für eine Einmischung der Polizei,“ erwiderte Harald durchaus höflich. „Kommen Sie, Lenk, wir werden trotz alledem das Haus durchsuchen. – Schraut, begleite Frau Niendorf in den Salon.“
So wurde ich denn nun der Wächter dieses entzückenden Weibes, dessen stolze Haltung bisher allen Anfechtungen gegenüber widerstanden hatte.
In dem eleganten Salon wurde zwischen uns kein Wort gewechselt. Sie saß regungslos in der Ecke des Seidensofas: Nur ihre Hände spielten nervös mit der Troddel der Morgenkleidschnur.
Ich sah zum dritten Male nach der Uhr. Halb zwei morgens.
War das wieder einmal eine Nacht! Erst das Mansardenerlebnis in Steglitz, dann die Verfolgung auf dem Griebnitz-See und die Suche im dunklen Walde; nun abermals ein neuer Schauplatz – diese vornehme Villa, deren Besitzer sich selbst den Tod gegeben. – Weshalb hatte Peter Niendorf wohl die Hand an sich gelegt – weshalb?! Wirklich aus Furcht vor dem Strafrichter?! – Ich begann zu grübeln. – Und weiter: weshalb hatte Dora Komtesse van der Bloozen diesen Niendorf geheiratet? Was bedeuteten jene Sätze ihres Tagebuchs?! – Oh – man stand hier vor einer Unmenge von Fragen; man brauchte nur einer dieser Fragen nachzuspüren, und sofort zerteilt sie sich in so und so viel andere. – Wer war die Frau, die in den Wald entfloh? Wie kamen der Geheimrat Panzer und Graf Asten dazu, sich in diese Angelegenheit als heimliche Helfer einzumischen?! Wie –
Und – da geschah das, was ich am wenigsten erwartet hatte.
4. Kapitel.
Frau Niendorf schnellte jäh in die Höhe.
Ihre Augen waren starr auf das gerichtet, das sich hinter mir befinden mußte.
Ich saß in einem Sessel, mit dem Rücken nach der Portiere hin, die vor der Tür in das Nebenzimmer hing. Ich hatte nichts gehört, drehte mich jetzt mißtrauisch um.
Vor mir ein kleiner breitschultriger Mann mit blauer Seglermütze, mit einer Maske vor dem Gesicht, mit vorgestrecktem rechten Arm.
Das elektrische Licht ließ den vernickelten Revolver funkeln. Und der Revolver blieb auf meine Stirn gerichtet, hob sich, wie ich mich erhob.
„Um Gottes willen!“ schrie Frau Niendorf entsetzt auf.
„Ruhe!“ rief der Mann drohend. „Wir haben die Dienstboten eingesperrt, und ebenso die beiden anderen Schnüffler! Der Herr Lenk wird ein feines Gesicht gemacht haben, als hinter ihm die Kellertür zuschlug. – Wer sind Sie denn eigentlich?“ fragte er mich mit triumphierendem Hohn. „Auch ein Kriminalbeamter, ein Greifer, scheint mir! Na, diesmal haben wir die Trümpfe in der Hand! Sie suchen hier wohl die anderthalb Millionen aus dem Keller in der Musketierstraße, he?!“ – Er kicherte in einer scheußlichen Weise. „Suchen Sie die wirklich etwa hier?! Das wäre ein feiner Spaß! Ich kann Ihnen genau sagen, Herr Kriminalwachtmeister, wo der Koffer mit dem Gelde sich befindet –“ – Jedes seiner Worte triefte vor überlegenem Spott. „Der Koffer ist auf der Gepäckaufbewahrungsstelle Bahnhof Friedrichstraße abgegeben worden. Hier ist der Schein!“
Er faßte mit der Linken in die linke Jackentasche und hielt mir tatsächlich einen Gepäckaufbewahrungsschein hin.
Ja – das war damals für mich wirklich eine zu große Verführung, als der Kerl in seinem übergroßen Sicherheitsgefühl den Revolver ein wenig hatte sinken lassen.
Ich tat, als ob ich nur Interesse für den Schein hätte. Ich berechnete trotzdem den Hieb mit der linken Hand nach aufwärts ganz genau, schlug zu – mit aller Kraft.
Und traf das Handgelenk – sah den Revolver nach oben fliegen, – schlug zum zweiten Male zu, dem Menschen gerade unter das Kinn, griff gleichzeitig nach dem Schein, erwischte ihn auch.
Der Kerl taumelte zurück. Ich hatte schon die Clement herausgerissen, schob die Sicherung herum.
Wie ein Blitz war der Mensch hinter der Portiere verschwunden.
Ich sprang hinterdrein. Aber ich bekam die Lampe nicht schnell genug aus der Tasche heraus. Ich hörte, wie eine Tür abgeschlossen wurde, stolperte im Dunkeln über einen Polsterschemel. –
Ich will mich kurz fassen, will Einzelheiten übergehen: ich erwischte den Menschen ebensowenig wie einen seiner Genossen!
Als ich auf die Straße hinauslief und Müller hereinrufen wollte, erhielt ich keine Antwort. Nachher stellte sich heraus, daß der Kriminalbeamte von einem Manne, der sich unbemerkt an ihn herangeschlichen hatte, mit einem Sandsack niedergeschlagen und dann gebunden und geknebelt worden war. Wir fanden ihn in einem Vorgarten im Gebüsch liegen, als ich Harst und Lenk befreit hatte.
Ich mußte die beiden erst suchen. Sie waren wirklich im Weinkeller der Villa eingesperrt worden, hatten auch diesen flüchtig in Augenschein nehmen wollen und mußten es erleben, daß hinter ihnen die schwere Tür krachend zugeworfen wurde. Als ich in den Vorkeller kam, hörte ich sie schon gegen die Tür hämmern. Der Schlüssel steckte im Schloß. Ich brauchte also nur aufzuschließen.
Als ich den beiden nun in aller Hast mein Abenteuer erzählte, als ich frohlockend den Gepäckaufbewahrungsschein ihnen zeigte, pfiff Harald leise durch die Zähne und meinte:
„Ach so – ich begreife! Sie wollen den Koffer loswerden, und Du, mein Alter, kamst ihnen als Wächter Frau Niendorfs gerade recht!“
„Was heißt das?!“ fuhr ich auf. „Das klingt ja so, als ob der Kerl Komödie gespielt hätte!“
„Hat er auch, hat er auch!“ nickte Harald. „Hast Du vielleicht den Revolver des Menschen zu Dir gesteckt?“
„Ja. Hier ist er.“
Harst besichtigte ihn. „Hm – wirklich geladen! Das wundert mich!“ Dann lachte er, als er eine Patrone herausgenommen hatte. „Da – bitte – eine abgefeuerte Hülse, in die nur die Kugel hineingedrückt worden ist! Der Mann hat sich den Rücken gedeckt. Wäre die Sache mißglückt, hätte er stets sagen können, er hätte Dich ja nur mit einer unschädlichen Waffe bedroht. – Gehen wir zu Frau Niendorf nach oben. Ich weiß jetzt genug, um sie zu einem Geständnis zu zwingen.“
„Woher denn?!“ meinte Lenk erstaunt. „Wir haben doch zusammen –“
„Abwarten, lieber Lenk!“
Frau Dora Niendorf saß noch im Salon. Als wir eintraten, erhob sie sich rasch. Ihre Gesichtszüge verrieten eine gewisse Unruhe, die sie durch eine scheinbar freudige Überraschung zu bemänteln suchte.
„Ah – Sie sind frei, meine Herren!“ sagte sie zu Lenk und Harald. „Ich habe Herrn Schraut geradezu bewundert. Der Einbrecher trat so roh und so drohend auf, daß –“
Harst hatte durch ein ironisches Lächeln ihr den Mund verschlossen. Dieses Lächeln machte sie verwirrt. Sie schwieg.
„Gnädige Frau,“ meinte Harald, „wollen Sie uns bitte in Ihr Damenzimmer begleiten – das dritte von hier.“
Sie nahm sich zusammen, erwiderte kühl: „Bitte! Weshalb nicht?!“ –
Das Damenzimmer hatte zwei Fenster nach dem See hinaus. Harald schritt auf einen ledergepreßten Kasten zu, der auf einem Tischchen stand, öffnete ihn und hob eine Kabinettphotographie heraus.
Frau Niendorf preßte die Lippen zusammen, wechselte die Farbe.
„Gnädige Frau,“ sagte Harald und hielt ihr das Bild hin, „hier steht auf der Rückseite:
Meiner geliebten Zwillingsschwester!
Nora van der Bloozen,
Wendelhof, den 6. Sept. 19…
Sie haben also eine Zwillingsschwester namens Nora, gnädige Frau, die Ihnen, wie das Bild zeigt, Zug um Zug ähnlich sieht. Diese Nora, behaupte ich, hat in der Nacht, als wir im Willbergschen Keller allerlei erlebten, hier in der Villa Ihre Rolle gespielt, Frau Niendorf! Sie war es, die das Migränepulver verlangte; sie war es, die dem Gärtner Muhl die zwanzig Mark schenkte; sie weilte heimlich hier, und sie entfloh aus der Motorjacht in den Wald vor etwa anderthalb Stunden, nachdem Sie, Frau Niendorf, in Ihrem Damenzimmer punkt elf Uhr mit Hilfe des Fenstervorhangs mit den Herren Geheimrat Panzer und Graf Asten Signale ausgetauscht hatten, die sich fraglos darauf bezogen, ob man die Flucht wagen könne. Hieraus geht weiter hervor, daß Panzer und der Graf in alle diese dunklen Dinge eingeweiht sind. Außerdem ist also Ihre Schwester noch daran beteiligt, ferner ein vornehmer Herr, der sich bei mir von Bronk nannte, und ein anderer Herr mit Schmissen, die Schraut und mich sehr schlau dadurch bei Anbruch der Nacht zu beschäftigen wußten, daß sie uns nach Steglitz in eine leere Mansardenwohnung lockten, damit wir nicht etwa den verabredeten Signalaustausch und die Flucht Ihrer Schwester, die sich hier in der Villa nicht mehr sicher fühlte, stören könnten. Schließlich ist an diesem Komplott noch Ihr Chauffeur Fritz Schulze beteiligt, der angeblich seit einer Woche bei seinen Eltern in Stettin weilt. Das stimmt nicht: dieser Schulze war es, der Schraut und mich im Tiergarten niederschlug und der hier soeben als Einbrecher auftrat, damit er meinem Freunde den Gepäckaufbewahrungsschein so in die Hände spielen könnte, als ob es sich wirklich um einen Dieb handelte, der einem Beamten gegenüber mit seiner Millionenbeute renommierte. – Frau Niendorf, ich hoffe, daß Sie nunmehr endlich einsehen werden, wie falsch Ihre Taktik des Leugnens ist.“
Dora Niendorf hatte sich langsam in den Schreibsessel vor den Schreibtisch gesetzt, hatte die Hände im Schoße verschränkt, schaute vor sich hin und regte sich nicht.
„Sie wollen also bei Ihrer Taktik bleiben,“ sagte Harald nach einer Weile. „Gut – die Wahrheit bekomme ich auch so heraus. Gute Nacht, gnädige Frau.“ –
Wir verließen die Villa, fanden den Kriminalbeamten Müller im Vorgarten eines benachbarten Hauses, befreiten ihn, gingen durch den Niendorfschen Garten zum See hinab, wo in der Kajüte der Jacht der Geheimrat Panzer und Graf Asten von Renborn bewacht wurden. Harst hatte mit Lenk bereits vereinbart, daß die beiden Herren frei gelassen werden sollten. – Lenk sagte zu ihnen nur: „Wir wissen jetzt, daß die Dame, der Sie zur Flucht verhalfen, Fräulein Nora van der Bloozen war. Das Weitere wird sich finden. Sie sind frei, meine Herren.“
Der Graf Asten blickte den Geheimrat fragend an. Es schien, als ob Asten nicht abgeneigt war, all diese Rätsel nunmehr zu klären. Doch Panzer schüttelte unmerklich den Kopf.
Da mischte sich Harald ein: „Vielleicht wollen Sie nur noch den Chauffeur Schulze schützen, meine Herren, der, wie ich bestimmt annehme, gegen Ihren und der anderen Beteiligten Wunsch und Willen so roh mit Schraut und mir im Tiergarten umsprang. Ich gebe zu: ich kenne den Kern all dieser seltsamen Geschehnisse noch nicht – noch nicht! Aber ich werde den Kern herausschälen. Wäre es nicht besser, Sie beide –“
Geheimrat Panzer hatte eine ablehnende Handbewegung gemacht. – „Herr Harst,“ sagte er fast feierlich, „ich erkläre Ihnen auf Ehrenwort, daß diese ganze Angelegenheit keinerlei ausgesprochen kriminellen Hintergrund hat. Das mag Ihnen genügen. Wir sind Klubgenossen. Ich bitte Sie, den ich als Ehrenmann schätze: lassen Sie diese Sache begraben sein! – Wenn Herr Kommissar Lenk sich weiter damit befaßt, so ist das vielleicht seine Pflicht. Eine solche Pflicht besteht für Sie nicht, lieber Harst!“
Harald schaute nachdenklich in das noch so jugendliche Gesicht des Multimillionärs. Dann erwiderte er:
„Es widerstrebt mir, einen Fall wie diesen unerledigt ad acta zu legen. Immerhin will ich, weil ich weiß, daß Ihr Ehrenwort, Herr Geheimrat, besser als tausend Zeugeneide ist, über meine ferneren Ermittlungen so lange schweigen, als Sie und die anderen Beteiligten es wünschen. – Lieber Lenk, ich scheide also aus dem Rennen hiermit aus.“
Lenk lächelte. „Schadet nichts! Ich mache das Rennen auch allein!“
Wir drei verabschiedeten uns von Panzer und Asten. Lenk befahl die Überwachung der Villa einzustellen. Dann fuhren wir mit dem Polizeiauto nach Berlin – nach Bahnhof Friedrichstraße.
5. Kapitel.
Der Gepäckschein brachte wirklich den Koffer in unseren Besitz. Im Dienstzimmer des Bahnhofsvorstehers öffneten wir ihn. Das Geld war noch vorhanden. Nichts fehlte.
Dann frühstückten wir in dem soeben geöffneten Wartesaal. – „Was werden Sie nun tun, Lenk?“ fragte Harald den Kommissar.
„Fritz Schulze suchen. Ohne Frage ist der Autodroschkenbesitzer Emil Damm ein Freund Schulzes und hat diesem das Auto freiwillig, wenn auch scheinbar nicht freiwillig überlassen. Vielleicht finde ich Schulze bei Damm.“
„Der Gedanke ist gut. Ich hätte dasselbe getan.“ – Gleich darauf sagten wir Lenk lebewohl. Lenk wollte uns telephonisch Bescheid geben, falls er bei Damm den Chauffeur erwischt hatte.
Harald und ich nahmen ein Auto und fuhren heim nach der Blücherstraße. Aber in der Nähe der Knesebeckstraße drückte Harst auf den Pfeifball. Das Auto hielt. Wir stiegen zu meiner Überraschung aus. Harald bezahlte, und wir gingen zu Fuß weiter.
„Wohin?“ fragte ich. „Was hast Du vor?“
„Ich suche die Person, mit der die Komtesse Dora durch das Auf- und Zuziehen des Vorhangs signalisierte, als sie Privatsekretärin war. Wir sind hier bereits in der Parallelstraße der Knesebeckstraße. Das Haus, in dem diese Persönlichkeit hier gewohnt hat, wird sich finden lassen. Es muß ein Gartenhaus von besonderer Bauart haben, eben mit Fenstern nach hinten heraus, oder gar kein Gartenhaus. Jedenfalls muß die gesuchte Person die Fenster der Komtesse haben beobachten können – eben von den eigenen Wohnungsfenstern aus.“ –
Dieses Haus war bald ermittelt. Und – es war ein recht altes Gebäude, das in einem großen, nach hinten sich erstreckenden Garten stand. – Die Uhr zeigte auf sieben, als wir das Haus betraten. Der Portier putzte gerade das Treppengeländer.
Harald bat ihn, uns behilflich zu sein, einen bestimmten Herrn (die „Person“ war also für Harst ein Mann, wie ich nun merkte) zu finden, der hier vor etwa anderthalb Jahren gewohnt hätte oder noch hier wohne. „Der Herr ist Junggeselle, wahrscheinlich adlig, und –“
Da erklärte der Hauswart schon:
„Das kann nur Graf von Asten sein. Er wohnt in der zweiten Etage rechts seit zwei Jahren.“
Ah – das war eine Überraschung! Also Asten! Und Asten war’s gewesen, der vorhin in der Kajüte der Motorjacht scheinbar zu einem Geständnis bereit war!
„Ist der Graf daheim?“ fragte Harald.
„Ja. Aber noch nicht lange. Er kam vor einer Stunde etwa nach Hause.“
„Kann man von den Fenstern der Wohnung des Grafen die Hinterfenster eines Hauses der Knesebeckstraße sehen?“ forschte Harald weiter.
„Allerdings,“ nickte der Portier. „Es steht da in der Knesebeckstraße nur ein Haus ohne Hintergebäude: Nr. 82.“
„Danke. – So – dies für Ihre Auskunft!“ Und in der Hand des biederen Mannes verschwand ein Zwanzigmarkschein. –
Wir hatten unsere falschen Bärte schon auf dem Rückwege von Babelsberg entfernt. Harald läutete nun bei Asten an.
Niemand öffnete. Er läutete nochmals.
Hinter der Tür glaubte ich leises Flüstern zu hören.
Dann rief Harald mit gedämpfter Stimme:
„Lassen Sie uns ein, Herr Graf! Wir beide sind allein.“
Das half. Eine Sicherheitskette wurde losgehakt. Die Tür ging auf.
Graf Asten blickte uns mit einer gewissen Scheu an.
„Bitte, treten Sie näher,“ sagte er trotzdem höflich und stieß die Tür nach seinem Herrenzimmer auf.
Dann saßen wir uns in drei Klubsesseln um einen Rauchtisch herum gegenüber.
„Herr Graf,“ begann Harald, „Ihre offenbare Absicht uns auf der Motorjacht die Wahrheit einzugestehen, ließ mich vermuten, daß Ihnen mit am meisten an einer sozusagen friedlichen Lösung der Rätsel des Falles Niendorf gelegen ist. Ich ahnte deshalb auch, daß Sie es gewesen, mit dem die Komtesse Dora von ihren Fenstern bei der Schriftstellerin aus Signale gewechselt hatte. Damals schrieb die Komtesse einige Sätze in ihr Tagebuch, die weiter mir die Vermutung aufdrängten, daß sie einen Mann liebte, den Peter Niendorf irgendwie in seiner Gewalt hatte und vernichten konnte. Niendorf hatte sich in die Komtesse verliebt. Er wußte, wem ihr Herz gehörte. Da drohte er ihr: Entweder heiratest Du mich, oder ich verderbe den – Grafen Asten!“
Der Graf war aufgestanden und ans Fenster getreten.
„Sie haben recht,“ sagte er leise. „Niendorf hatte die Wechsel, die ich einst als Offizier – gefälscht hatte, an sich gebracht. Er konnte mich vernichten, und er hätte es auch getan, denn er liebte Dora bis zum Wahnwitz. Das, was ich einst als blutjunger Mensch aus Leichtsinn und Verzweiflung getan, wollte er nun als Waffe benutzen, wollte mit dieser Waffe mir die Waffe in die Hand zwingen, falls Dora nicht die Seine würde. So mußte denn der kurze Glückstraum unserer erst zwei Tage währenden heimlichen Verlobung ein Traum bleiben. Dora opferte sich, und am Hochzeitstage verbrannte Niendorf vor ihren Augen die drei Wechsel. Dann jedoch lernte er Dora von einer anderen Seite kennen: sie war nie sein Weib, war nur dem Namen nach seine Frau! – Aber Niendorf hatte bereits Doras Vater mit Geld ausgeholfen und dessen Gut vor der Versteigerung bewahrt. Nur aus Rücksicht auf ihre Eltern und um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden, drang sie nicht sofort auf eine Scheidung.“
„Anderseits,“ ergänzte Harald nun, „wurde nun von Ihnen, Herr Graf, und Ihren Freunden, denen Niendorf als Lump bekannt war, versucht, Material gegen Niendorf in die Hände zu bekommen. Sie beobachteten ihn ständig.“
„Ja – zwei Privatdetektive, die als Brüder Steiner zuletzt bei Allin wohnten –“
„Niendorf wollte schließlich mit den anderthalb Millionen ins Ausland fliehen –“
„So war’s. – Wir Beteiligten konnten nicht voraussehen, daß er sich bei Allin, nachdem wir ihm den Koffer mit den Banknoten gestohlen hatten, selbst den Tod geben würde. Nein, damit rechneten wir nicht. Nun wollten wir um jeden Preis die ganze so unerquickliche Sache derart vertuschen, daß die Wahrheit nie enthüllt werden könnte. Der Chauffeur Schulze aber tat leider aus Anhänglichkeit an Dora des Guten zuviel und schlug Sie beide nieder, während wir Sie doch nur für einige Zeit hatten von Berlin fortschaffen wollen.“
„Danke, Herr Graf. Ich bin bereits im Bilde. – Und die Mansardenwohnung in Steglitz war doch nur ein Lockmittel, ebenso die Strickleiter?“
„Ja. Besonders diese sollte der Mansarde noch ein geheimnisvolles Gepräge geben.“
„Wer war Herr von Bronk und –“
„– Oh – die richtigen Namen möchte ich verschweigen –“
„Was ich begreifen kann –“
„Und – die Komtesse Nora?“
„Wird sich morgen mit Panzer verloben, während Dora und ich noch einige Zeit warten wollen. Nach unserer Hochzeit übernehme ich die Vertretung der Panzerschen Werke für Amerika und siedle nach Neuyork über. Dann können Sie Herrn Lenk und der Welt die Wahrheit über den Fall Niendorf berichten, Herr Harst.“ –
Die Wahrheit kennt der Leser nun. Der Schluß dieses Abenteuers war für uns recht angenehm: wir machten nämlich zwei Hochzeiten mit – die der Zwillingsschwestern.
Man wird mir recht geben, daß der Fall Niendorf Harst Gelegenheit bot, sein Detektivgenie abermals zu beweisen. Weit mehr noch konnte er dies bei unserem nächsten Abenteuer, bei der Höllenmaschine Doktor Blucks, die ich im folgenden Band dem Leser vorführe.
Anmerkungen:
- ↑ In der Vorlage steht: „Traumgebild“.
- ↑ In der Vorlage steht: „Wohltätigketsfest“.
- ↑ In der Vorlage steht: „das“.
