Hauptmenü
Sie sind hier
Der Klub der Zuchthäusler
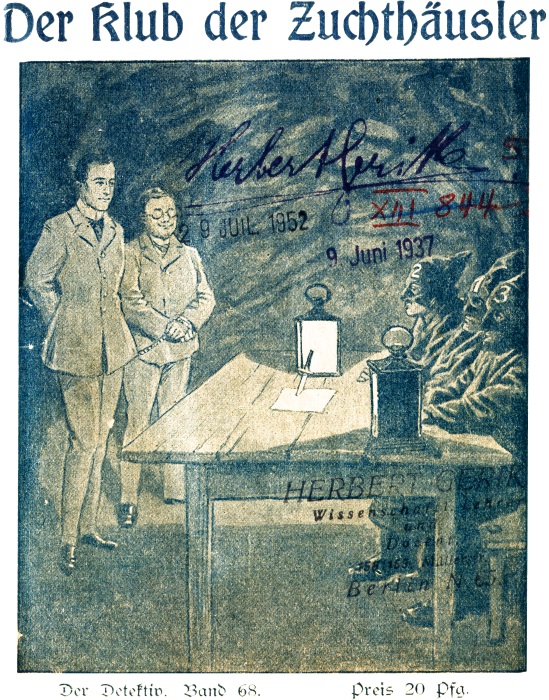
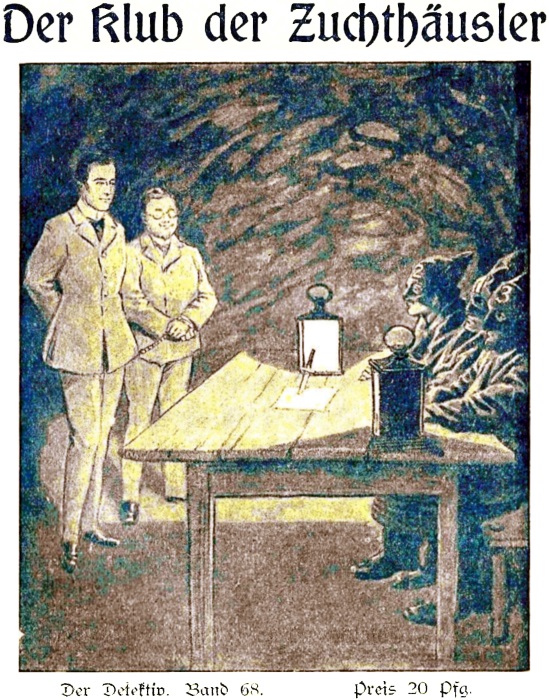
Der Detektiv
Kriminalerzählungen
von
Walther Kabel.
Band 68:
Der Klub der Zuchthäusler
1. Kapitel.
Die Turmuhr von Friedensburg.
Es war kurz vor dem Weihnachtsfest, am 22. Dezember vormittags elf Uhr, als in der Harstschen Villa in Berlin-Schmargendorf, Blücherstraße 10, sich gleichzeitig zwei Herren einfanden, ein Engländer namens Mapserlan und ein Deutscher namens Winndorf.
Sie waren einander fremd. Als ich sie in Haralds Arbeitszimmer geführt hatte, erklärte der sehr solide gekleidete Herr Winndorf, seine Sache sei nicht dringend. Er wäre auch gar nicht zu uns gekommen, wenn ihn nicht Geschäfte nach Berlin geführt hätten. Das, was er Harst vortragen wolle, sei lediglich eine Kleinigkeit.
So wurde er denn gebeten, nebenan in der Bibliothek Platz zu nehmen, und Herr Mapserlan konnte nun seinerseits zuerst sein Herz erleichtern.
Daß er Sorgen hatte, sah man ihm an. Er mochte etwa fünfundvierzig Jahre alt sein, war bartlos und hatte einen ungesunden gelblichen Teint, bemühte sich umsonst, seine große Nervosität zu verbergen, und tupfte sich immer wieder die Schweißperlen von der Stirn.
Sehr sympathisch wirkte dieser Herr Mapserlan nicht. Er hatte recht unruhige, scheue Augen.
„Ich bin seit einem halben Jahr hier in Berlin Vertreter der englischen Tuchfabrik Lincoln und Webster, Birmingham,“ begann er in seiner fahrigen Art, wobei er beständig seine Stiefelspitzen musterte. „Mein Fall, Herr Harst, eignet sich nicht recht für die Polizei. Diese verlangt stets sichere Anhaltspunkte für ein geplantes Verbrechen. Sonst greift sie nicht ein. Mit solchen sicheren Anhaltspunkten kann ich nicht dienen –“
Er lächelte krampfhaft. „Nein – wirklich nicht dienen,“ fügte er hinzu. „Nur mit drei einzelnen Vorgängen, die jeder für sich recht eigentümlich sind. Ich darf sie Ihnen wohl mitteilen, Herr Harst. – Der erste spielte sich vor acht Wochen ab. Ich bin Junggeselle und wohne in der Pestalozzistr. Nr. 199 in Charlottenburg im Gartenhause eine Treppe bei einer Witwe Marten. Sie ist eine ältere anständige Dame. – Als ich damals am 20. Oktober nachts gegen ein Uhr heimkehrte und über den Hof des Gebäudes auf das Gartenhaus zuschritt, sah ich in meinem Wohnzimmer Licht. Die elektrische Krone brannte bei vorgezogenen Vorhängen. Ich stutzte, als ich dies wahrnahm, blieb stehen und überlegte, ob etwa Frau Marten das Licht eingeschaltet haben könnte. Ich sagte mir, daß sie vielleicht ebenfalls spät nach Hause gekommen sei und jetzt erst mein Schlafzimmer zur Nacht in Ordnung bringe. Aber – das Schlafzimmer war dunkel. Und das Licht im Wohnzimmer brannte immer noch, obwohl ich es nun bereits fünf Minuten im Auge behalten hatte.“
„Sie dachten also an Einbrecher?“ meinte Harst, um die Schilderung Mapserlans abzukürzen.
„Ja – auch daran dachte ich –“
„Auch daran? Woran denn noch?“ fragte Harald.
Mapserlan wurde verlegen. „Oh – an die Marten, Herr Harst,“ erklärte er hastig. „Natürlich an die Marten – das erwähnte ich ja schon –“
„Hm – Sie deuteten doch eben an, daß in Ihnen hinsichtlich einer Anwesenheit der Marten in Ihren Zimmern Zweifel aufgestiegen seien, Herr Mapserlan. – Nun gut – weiter bitte.“
„Ja – ich ging dann nach oben, schloß die Flurtür mit dem Patentschlüssel auf – ich hatte ein neues Schloß dort anbringen lassen – und öffnete rasch mein Wohnzimmer, indem ich meinen Revolver bereithielt –“
„Tragen Sie stets einen Revolver bei sich?“ meinte Harald erstaunt oder – scheinbar erstaunt.
„Nein – nur – nur zuweilen, Herr Harst. Es ist das so eine Angewohnheit von mir von früher her. Ich war mal Plantagenverwalter in Indien, und –“
„Danke, Herr Mapserlan. – Sie betraten also das Zimmer. Es war dunkel –“
„Ja – es war dunkel. Ich durchsuchte die beiden Zimmer, weckte die Marten, die mir erklärte, sie sei um zehn Uhr zu Bett gegangen, und wir beide haben dann –“
„Verstehe, Herr Mapserlan: Sie haben nichts[1] entdeckt, was auf die Anwesenheit eines Menschen hindeutete, der das Licht eingeschaltet haben könnte. Frau Marten hatte es nicht getan.“
„Ganz recht: auch nicht das Allergeringste war zu bemerken, Herr Harst,“ sagte Mapserlan etwas widerwillig. Er schien sich darüber zu ärgern, daß Harald ihn so häufig unterbrach. „Und – das möchte ich betonen: ich verstehe zu suchen! Mir bleibt so leicht nichts verborgen. Ich bin in dieser Hinsicht nicht ohne Erfahrungen –“
„So?! Woher haben Sie diese Erfahrungen?“
„Nun – man ist doch in der Welt weit herumgekommen, Herr Harst –“ – Er war abermals merklich verlegen geworden, und eine flüchtige Röte hatte sein fahles Gericht dunkler gefärbt.
„Das stimmt, Reisen schärft den Blick für alles!“ nickte Harald. „Das zweite Erlebnis, Herr Mapserlan?“ setzte er erwartungsvoll hinzu.
„Ja – das hatte ich vierzehn Tage später, als ich infolge eines Grippeanfalls zu Bett lag. Ich hatte Fieber, nicht allzu stark, und mein Schlaf war recht unruhig. Frau Marten war damals sehr fürsorglich und hatte mir ein großes Glas Zitronenwasser bereit gestellt. Ich trank davon, und – erwachte erst am folgenden Nachmittag gegen sechs Uhr. Frau Marten hatte den Arzt kommen lassen, da ihr der tiefe Schlaf unnatürlich erschien. Ich war so schwer wach zu bekommen und hatte so kleine Pupillen, daß der Arzt meinte, ich müßte ein sehr starkes Schlafmittel genommen haben.“
„Kurz, Sie vermuten, jemand hat Ihnen in die Limonade etwas hineingetan, Herr Mapserlan –“
„Ja, so ist’s – Wer das jedoch getan hat, ist mir unbegreiflich –“
„War noch Limonade in dem Glas, als Sie ermuntert wurden?“
„Nein. Nichts. Obwohl ich mich bestimmt besinne, daß ich das Glas kaum zur Hälfte leer getrunken hatte.“
„War der Rest Limonade etwa in den Porzellaneimer gegossen worden?“
„Nein. Ich fand jedoch auf dem Hofe unter meinen Fenstern am nächsten Tage drei Zitronenkerne und jene charakteristischen Fasern von Zitronen. Unter den Fenstern gibt es dort ein kleines Blumenbeet mit ein paar Sträuchern.“
„Sie nehmen an, man hat den Rest der Limonade zum Fenster hinausgegossen?“
„Ja, Herr Harst.“
„Und Ihr drittes Erlebnis?“
„Das – das hatte ich in der verflossenen Nacht. Ich pflege im Bett noch zu lesen und eine Zigarette zu rauchen. Auf meinem Nachttisch steht immer ein Glaskästchen mit Zigaretten. Als ich gestern gegen ½12 nachts zu Bett gegangen war, rauchte ich wie stets, spürte aber schon nach den ersten Zügen eine solche Müdigkeit und Übelkeit, daß ich in die Kissen zurücksank und bis heute neun Uhr vormittags wie ein Bewußtloser dagelegen habe. Die angerauchte Zigarette –“
„– war verschwunden,“ ergänzte Harst, „und abermals fanden Sie keinerlei Spuren der Anwesenheit eines Fremden in Ihren Räumen. – Haben die Türen Ihrer beiden Zimmer, die in den Flur münden, gute Schlösser?“
„Ja, Patentschlösser, die ich ebenfalls gleich nach meinem Einzug bei der Marten anbringen ließ –“
„So so, Herr Mapserlan, dann dürften Sie also doch fraglos in beständiger Angst vor irgend welchen Gegnern leben – oder Feinden. Wer sich so schützt wie Sie, der –“
Mapserlan erhob abwehrend beide Hände. „Keine Rede davon!“ rief er seltsam erregt. „Keine Rede davon!“ Jetzt schaute er Harald an. Und – seltsam genug! – dieser Blick verriet ebensoviel Ärger wie heimliche Furcht.
„Dann ist die Sache allerdings doppelt rätselhaft,“ meinte Harald achselzuckend. „Es steht doch wohl fest, daß sich dreimal jemand bei Ihnen eingeschlichen hatte und daß dieser Jemand Sie zweimal durch irgendwelche Mittel zu irgendeinem Zweck betäubt hat. – Ich gebe zu, Ihr Fall interessiert mich nur deshalb, weil Sie eben keinen Feind haben, denn – um Einbrecher handelt es sich hier nicht. Es ist ja nichts gestohlen worden.“
Mapserlan lächelte plötzlich. Es schien, als ob er jetzt von irgend einer Sorge befreit wäre.
„Ja, Herr Harst, – und gerade das möchte ich gern herausbekommen: wer ist dieser Mensch, der wie ein Geist durch verschlossene Türen und verriegelte Doppelfenster sich bei mir Zutritt verschafft,“ sagte er, indem er das Wort „Geist“ scherzhaft zu betonen versuchte. „Aber ihre Ermittlungen müßten in aller Stille und Verschwiegenheit geschehen. Darauf kann ich mich wohl verlassen?“
„Das können Sie, Herr Mapserlan. Augenblicklich bin ich noch mit einer anderen Sache beschäftigt. Übermorgen will ich zu Ihnen kommen. Wann sind Sie daheim?“
„Um sechs Uhr nachmittags. Sie erscheinen doch verkleidet?“
„Ja. Natürlich. – Noch eine Frage: haben Ihre Zimmertüren Nachtriegel, und lassen Sie nachts die Schlüssel in den Schlössern stecken?“
„Es sind Nachtriegel vorhanden. Nach dem ersten Vorfall, als ich das Licht wahrgenommen hatte, schloß ich ab und ließ die Schlüssel in den Schlössern.“
„Haben die Zimmer noch eine dritte Tür?“
„Nein. Nur eine Balkontür nach dem kleinen Balkon vor meinem Schlafzimmer. Es ist eine Doppeltür, und ein Eindringen auf diesem Wege ist unmöglich, man müßte denn gerade die Fensterscheiben eindrücken.“
„Danke. – Sie werden entschuldigen, Herr Mapserlan. Sie wissen, es ist noch ein Klient da –“
Der dürre Mapserlan reichte uns die Hand und verließ dann das Haus. Ich brachte ihn bis an die Haustür. Als ich wieder ins Arbeitszimmer kam, rauchte Harald eine Mirakulum am Fenster hinter der Gardine, schaute dem merkwürdigen Herrn nach und flüsterte mir dann zu: „Na – was hältst Du von ihm, mein Alter?“
„Schwer zu sagen. Falls die drei Erlebnisse nicht erfunden sind, erscheint dieses Problem einigermaßen vielversprechend.“
„Erfunden? Nein! – Nur der Mapserlan lügt in anderer Beziehung. – Bitte jetzt aber den dicken Herrn Theodor Winndorf herein.“ –
Winndorf setzte sich, nahm die dargebotene Zigarre dankend an und meinte schmunzelnd:
„Hätte mir nicht träumen lassen, Herr Harst, daß ich mal so einer Berühmtheit wie Sie es sind gegenüber sitzen würde. Hm – eigentlich müßte ich mich schämen, Sie mit dem Quark zu belästigen, den ich da beobachtet habe. Aber meine Jette – das ist meine Frau – meinte, ich könnte nicht recht beurteilen, ob’s wirklich so ’ne Kleinigkeit wäre, diese Geschichte mit den Turmuhrzeigern. – Na, ich will alles schön der Reihe nach erzählen. Ich bin Hotelbesitzer, Herr Harst. Besser: Pensionsbesitzer, und zwar bei Alexisbad im Harz. Mein Fremdenheim heißt „Friedenshaus“ und liegt zwei Kilometer von Alexisbad entfernt. Am neunten Oktober trafen drei Gäste bei mir ein, drei Herren, die sich offenbar gut kannten: ein Engländer namens William Boulwer, ein Deutscher Friedrich Krohnke und ein Holländer Pieter van Diemen. Diese drei blieben acht Tage, machten viele Fußtouren und kauften dann das alte Schloß Friedensburg, das meinem Hotel, nur durch ein schroffes Tal getrennt, in etwa vierhundert Meter Entfernung gegenüberliegt. Das Schloß hatte bis dahin einem Berliner Kommerzienrat gehört. Es ist mehr eine Ruine. Erhalten sind davon lediglich der rechte Flügel und der sich an diesen anlehnende Turm, an dem sich eine große Uhr befindet, deren vier Riesenzifferblätter aus Kupfer gerade nach den vier Himmelsrichtungen zeigen. Die drei Herren erwarben das Schloß samt dem bescheidenen alten Mobiliar. Sie setzten einen unverheirateten Kastellan hinein, einen geborenen Schweden namens Sunderholm. Das Schloß wurde auch sogleich für Besucher gesperrt. – Ja, und dann kam das Merkwürdige, Herr Harst: die neuen Besitzer ließen die Turmuhr, die nicht mehr ging, in Ordnung bringen, ließen auch die Zeiger der vier Zifferblätter frisch mit Goldfarbe überziehen und gaben viel Geld dafür aus. Doch – die Uhr bleibt sehr häufig stehen. Erst fiel mir das nicht auf. Ich kenne den Uhrmacher aus der benachbarten Stadt Harzgerode persönlich, der die Uhr repariert hat, und deshalb hatte ich so einiges Interesse für das alte Ding. – Eines Tages sagte Jette zu mir: „Du, Mann, jetzt steht die Uhr wieder – und wieder auf ein Viertel eins.“ – Da fragte ich meine Frau, ob sie denn schon häufiger beobachtet hätte, daß die Uhr plötzlich nicht mehr ging. „Ja,“ sagte sie, „schon zweimal ist sie auf viertel eins stehengeblieben, aber immer nur bis drei Uhr nachmittags.“ Ich paßte nun auf, und acht Tage später stand die Turmuhr abermals auf ein Viertel eins, und um drei nachmittags wurden die Zeiger wieder vorgerückt, und sie waren wieder in Ordnung.“
„Eine Zwischenfrage, Herr Winndorf. – Wann beobachtete Ihre Frau, daß die Uhr zum dritten Male auf ein Viertel eins stehenblieb?“
„Das war etwa am 5. November. Seitdem, Herr Harst, ist die Turmuhr im ganzen neunmal stehen geblieben. Jette und ich haben genau aufgepaßt.“
2. Kapitel.
Gartenhaus Pestalozzistraße 199.
Es entstand eine längere Pause.
Harald ging jetzt auf und ab und rauchte hastig. Dann fragte er: „Sie haben mir noch etwas mitzuteilen, Herr Winndorf, nicht wahr?“
„Ja. Jedoch nichts, was die Uhr direkt angeht. – Es ist ja wohl nur ein Zufall, Herr Harst. Aber wir haben seit dem 24. Oktober auch genau neun Gäste gehabt. Also genau so viel, wie die Turmuhr –“
Harald war neben des Hoteliers Sessel stehengeblieben und fragte hastig, indem er unseren Klienten unterbrach:
„Nur neun Gäste?“
„Nein, das nicht. Aber neun Gäste, die alle nur mit ’nem Handkoffer ankamen und nachher ihren Koffer selbst nach Alexisbad zur Bahn trugen, – alles Männer, die so’n bißchen komisch aussahen –“
„Weshalb komisch?“
„Na – so – ähnlich wie die neuen Schloßherrn – so grau und kränklich im Gesicht. Und – alle hätten Perücken getragen, behauptet Jette.“
„Wie lange blieben sie?“
„Stets nur einen Tag. Morgens kamen sie an, blieben auf ihrem Zimmer, ließen sich das Essen dorthin bringen und wanderten um sechs Uhr abends zum Bahnhof nach Alexisbad mit ihren kleinen Koffern.“
„Was für Leute waren das?“
„Zum Teil Deutsche, zum Teil Ausländer.“
„Und fuhren diese Männer auch wirklich ab, Herr Winndorf?“
„Gewiß, Herr Harst, gewiß. Als ich erst auf diese komischen Besucher aufmerksam geworden war, bin ich dem achten und neunten – das waren ein Schwede und ein Deutscher – nach ’ner Weile zum Bahnhof gefolgt. Sie lösten Fahrkarten nach Hamburg beziehungsweise Bremen und bestiegen auch den Zug.“
„Waren die Leute elegant gekleidet?“
„Nein – anständig nur, – so alles fertige Sachen. Das sieht man doch.“
Harald begann wieder seine Promenade durch das Zimmer, nahm eine frische Zigarette und fragte:
„Die drei neuen Schloßherrn leben sehr zurückgezogen?“
„Ja. Man sieht sie kaum jemals. Aber sie sind wohltätig – sehr sogar.“
„Haben sie viel Bedienung?“
„Nein, nur den Kastellan, einen Koch und zwei Diener, von denen der eine gleichzeitig Kutscher und Chauffeur spielt.“
„Haben Sie jemandem mitgeteilt, daß Sie mich aufsuchen wollten?“
„Bewahre, Herr Harst. Jette und ich haben nicht mal zu anderen von dem Stehenbleiben der Turmuhr gesprochen. Die drei Herren beziehen nämlich sämtliche Lebensmittel von mir. Und das ist ’n gutes Geschäft. Sie haben wohl alle dort im Schlosse einen sehr gesunden Appetit.“
„Sie liefern also recht viel dorthin?“
„Ja – allerdings, recht viel. Jette meint, die im Schloß müssen an Magenerweiterung leiden,“ lachte er behaglich.
„Bringen Sie die Lebensmittel hin?“
„Nein. Der Kutscher Jörnbaar, ein Schwede, holt sie ab.“
„Verreisen die Schloßherrn häufig?“
„Ja – ziemlich häufig. Sie bekommen auch oft Besuch.“
„Immer nur Herren?“
„Nur, Herr Harst.“
„Können Sie sonst noch etwas Auffallendes über die Schloßbewohner berichten?“
„Auffallendes?! Nein! Wirklich nicht. Ich möchte Sie ja überhaupt bitten, Herr Harst, mir nicht etwa die gute Kundschaft des Schlosses zu vergraulen. Sie verstehen mich: ich bin nur hergekommen, weil ich gerade hier in Berlin zu tun habe. Die ganze Geschichte ist ja so unbedeutend und belanglos. Nicht wahr?“
„Vollständig belanglos, Herr Winndorf,“ nickte Harald.
Ich wußte, daß er jetzt die Unwahrheit sprach.
„Und – was halten Sie davon, Herr Harst?“ fragte der Hotelier schüchtern. „Ich muß doch Jette was Interessantes über den Besuch bei Ihnen erzählen können. Und ’n Detektiv weiß doch gleich Bescheid. Das ist doch das Interessante –“
„Oh, Herr Winndorf, die Sache mit der Turmuhr ist wirklich leicht erklärt. Die Uhr hat doch ein Schlagwerk?“
„Ja, ein sehr lautes und helles.“
„Na also. Wenn ich mal über Mittag gehörig die versäumte Nachtruhe nachholen will, halte ich meine Standuhr dort in der Ecke auch an. Und so werden’s die Schloßherren auch machen. Daß gerade neun einzelne Herren nur einen Tag bei Ihnen wohnten, ist natürlich Zufall, weiter nichts.“
Winndorf schlug sich knallend auf den Schenkel. „Natürlich, natürlich – der Nachmittagsschlaf soll nicht gestört werden – natürlich!“ rief er. „Jette wird Augen machen! So ’ne einfache Erklärung!“
Er blieb dann noch zehn Minuten, trank ein Glas Wein und lud uns beide dringend für ein paar Tage „gratis und franko“ zu sich ein. –
Als er gegangen, sagte Harald:
„Es sind beides verheißungsvolle Fälle, sowohl Mapserlan als auch Schloß Friedensburg. Wir werden Mapserlan zuerst erledigen. Die andere Sache eilt weniger. Wie wär’s, wenn wir uns das Haus Pestalozzistraße 199 mal sofort ansehen würden? – Es dürfte aber ratsam sein, den Spion, der drüben auf dem anderen Bürgersteig herumlungert, zu täuschen.“
„Spion?! Wo?!“ Ich war wirklich überrascht.
„Oh, ich sah ihn schon, als Mapserlan fortging. Das heißt, es waren zwei Spione. Der eine folgte dem blassen Engländer, der andere blieb und ist noch da. Also machen wir Maske und verlassen wir das Haus durch den Gemüsegarten.“ –
Es war gegen halb eins, als wir die Pforte des Gemüsegartens hinter uns abschlossen. Wir schauten uns argwöhnisch um. Es war jedoch kein dritter Spion in der Nähe. –
Zwei ältere Herren suchten dann im Gartenhause von Nr. 199 möblierte Zimmer. Der Portier der großen eleganten Mietskaserne meinte, im zweiten Stock sei noch bei der Hulbatz was frei.
Frau Hulbatz war daheim. Wir nahmen das noch unbesetzte Vorderzimmer für acht Tage, bezahlten im voraus, gaben uns als Kaufleute aus Hamburg aus und wollten nachmittags mit unseren Koffern einziehen.
Als wir gegen ¾2 nachmittags Frau Hulbatz vorläufig lebewohl sagten und sie gerade hinter uns die Flurtür ins Schloß gedrückt hatte, erscholl unten ein gellender Schrei.
Der Schrei wiederholte sich im Treppenhause.
„Mord – Hilfe!“ kreischte ein Weib offenbar in höchster Angst.
Wir eilten hinab. Im Nu füllte sich das Treppenhaus.
An ihre Flurtür lehnte mehr tot als lebendig Frau Marten, eine ältere korpulente Dame.
Mühsam nur erfuhren wir durch energisches Befragen von ihr, daß sie soeben erst von Besorgungen heimgekehrt sei und in ihrer Küche ihren möblierten Herrn, den Engländer tot aufgefunden hätte. –
Fünf Minuten drauf waren zwei Kriminalbeamte von der nächsten Polizeiwache eingetroffen. Harald nahm den einen beiseite und flüsterte mit ihm. So durften wir denn, angeblich als Zeugen, mit in die Wohnung hinein. Frau Marten blieb draußen.
Ich will das, was wir hier feststellten, nur kurz erwähnen, da es nur zum Teil von Wichtigkeit ist.
Der Befund in der Küche der Marten war nur zu sehr geeignet, den Gedanken an ein Kapitalverbrechen aufkommen zu lassen.
Mapserlan lag mitten in der Küche auf dem Rücken. Er hatte an der rechten Halsseite unmittelbar über dem Kragenrand eine furchtbare Wunde. Die Schlagader war durchtrennt.
Die beiden Kriminalbeamten gestatteten uns nur, bis an die Küchentür vorzutreten. Auch sie gingen nicht hinein. Sie hatten die Mordkommission benachrichtigt und wollten deren Erscheinen abwarten.
Harald betrachtete minutenlang den Toten und die Küche, ohne ein Wort zu sprechen. Dann erklärt er:
„Es liegt kein Mord hier vor. Der Engländer ist aus irgend einem Grunde rückwärts umgesunken und hat dabei mit dem Halse das Messer jener Brotschneidemaschine, die dort auf der Küchenbank steht, gestreift. Das Messer der Maschine ist nach außen und halb nach unten umgeklappt, so daß die Schneide nach oben zeigt. – Beachten Sie jenen dicken Blutstrahl an der Wand. Und ferner die Stellung der Brotschneidemaschine. Sie steht schief. Die der Wand zugekehrte Seite ist aufgerichtet – infolge des Anpralls des Halses Mapserlans auf das Messer.“
Die Beamten prüften mit den Augen diese Hinweise und meinten dann, Harald könnte wohl recht haben.
„Frau Marten wird das Messer der Maschine vielleicht gesäubert haben,“ fügte Harst noch hinzu. „Deshalb klappte sie es herunter. Mapserlan schlug, nach dem er die tödliche Wunde erhalten hatte, lang hin und fiel so hart mit dem Hinterkopf auf, das er das Bewußtsein verlor. Dann verblutete er. Wäre er nicht bewußtlos gewesen, hätte er ohne Zweifel trotz der furchtbaren Wunde noch die Küche verlassen und um Hilfe rufen können. – Schraut und ich werden uns jetzt in Mapserlans Wohnzimmer setzen.“
Die Beamten hatten nichts dagegen.
Als wir dort nun allein waren, sagte Harald leise: „Mapserlan ist vor einem Angreifer in die Küche geflohen. Sahst Du nicht, daß sein Selbstbinder wie ein Strang langgereckt und der Kragen vom Oberhemd halb abgerissen war? Der Mann hatte ihn gepackt, und Mapserlan hat sich gewaltsam befreit und sich in der Küche in Sicherheit bringen wollen. Der Schlüssel der Küche lag rechts unter dem Tisch auf den Dielen. Vielleicht wollte er sich in die Küche einschließen.“
Wir standen noch mitten in dem recht elegant möblierten Zimmer.
„Nicht vom Platze!“ flüsterte Harst dann. „Hier gibt es allerlei zu sehen!“
Allerdings: hier schien ein Dieb gehaust zu haben! – Alle Fächer des Schreibtisches, des altertümlichen Bücherschrankes und einer noch älteren reich geschnitzten Kommode mit Perlmuttereinlagen waren herausgerissen. Der Inhalt war über die Dielen und den Teppich verstreut. Auf der Schreibtischplatte waren verwischte Blutspuren zu bemerken. Ein Stuhl lag umgeworfen neben dem Sofatisch.
„Hm,“ meinte Harald, „etwas zu viel des Guten!“ Er öffnete die Tür nach dem Schlafzimmer. Auch dort derselbe Anblick: Die Anzüge Mapserlans lagen auf dem Bett, die Wäsche neben dem Bett; zwei Koffer mir erbrochenen Schlössern standen mitten im Zimmer.
„Mache! Täuschungsversuch!“ sagte Harst wieder. „Der Mann, vor dem Mapserlan in die Küche floh, wollte durchaus den Eindruck hervorrufen, als wäre er ein gewöhnlicher Einbrecher und der Unfall ein Mord oder Totschlag. Der Mann war natürlich derselbe, der hier schon vorher mindestens dreimal irgend etwas gesucht hat und den Mapserlan sehr genau kennen dürfte.“
„Was wollte Mapserlan dann aber bei uns, wenn er seinen Feind kannte?“ warf ich zweifelnd ein.
„Er kannte ihn, mein Alter, gewiß. Aber er war sich seiner Sache insofern nicht sicher, als er den „Feind“ eben nie zu Gesicht bekam und fraglos aus bestimmten Gründen anzunehmen berechtigt war, dieser „Feind von einst“ könne unmöglich hier in Berlin wieder aufgetaucht sein. Wir sollten den Mann eben herausfinden, und dann hätte Mapserlan weitere und vielleicht nicht ganz harmlose Entschlüsse gefaßt. Das ist ja nun alles gegenstandslos geworden. Mapserlan ist tot. Uns bleibt die Aufgabe trotzdem, diesen „Feind“ zu suchen. Ich wette, der Mann würde uns wenig Schmeichelhaftes über Mapserlan mitteilen. – Sehen wir uns hier nun mal um. Ich denke, der „Feind“ wird zum Eindringen die Balkontür benutzt haben, denn die Stubentüren mit ihren Patentschlössern und Riegeln stellten doch zu schwierige Eingänge vor.“
Er öffnete die innere Balkontür. Diese Doppeltür war keine Flügeltür; sie schlug nach innen.
„Nein,“ erklärte er nach kurzer Besichtigung, „diese Tür kommt nicht in Frage. Nun das Fenster –“
Es war ein Doppelfenster. Harst kletterte auf das Fensterbrett und öffnete die oberen quadratischen Flügel.
„Aha – wir haben’s schon!“ sagte er mit feinem Lächeln. „Hier sind zwei fingerdicke Löcher durch das Fensterkreuz gebohrt – sehr sauber! Und in den Löchern stecken genau passende, an den Enden mit der richtigen Farbe angestrichene Pflöcke. Der Anstrich des Fensterkreuzes ist sehr rissig. Und die Risse in der Farbschicht halfen die Pflöcke verbergen. Wenn der Eindringling die Pflöcke von außen herauszog, konnte er mit einer besonders gestalteten Zange auch den Riegel der Innenscheiben heben. Hier an dem Riegelzapfen ist eine Erhebung ausgefeilt und wieder überpinselt worden. – So, daß genügt mir.“
Gleich darauf erschien die Mordkommission, die sich dann Haralds Ansicht anschloß: ein Unfall, kein Mord!
Das Mapserlan vorher bei uns gewesen, verschwieg Harald. Er erklärte unsere Verkleidung und unsere Anwesenheit in diesem Hause mit einem Auftrag, den wir – angeblich – hier in der Nähe in der Pestalozzistraße zu erledigen hätten.
Da die Polizei die Neugierigen zerstreut hatte, konnten wir dann auch, ohne aufzufallen, das Haus wieder verlassen.
Als wir daheim wieder eingetroffen waren, fanden wir einen an Harald gerichteten Brief vor, der soeben erst durch einen Dienstmann abgegeben worden war.
Er lautete:
Herr Harst! Wir warnen Sie, sich mit der Angelegenheit Mapserlan noch weiter zu befassen. Mapserlan hat sein wohl verdientes Ende gefunden. Sollten Sie diese Warnung nicht beachten, so müßten wir zu Zwangsmaßregeln greifen. Wir verfügen über genügend Hilfsmittel, unseren Willen durchzusetzen. Mapserlan war ein Schurke, der drei Leute kaltblütig ins Unglück gestürzt hat. Er ist es wahrlich nicht wert, daß Sie sich seiner annehmen.
D. Kl. d. Z.
„Siehst Du, mein Alter,“ sagte Harald und steckte den Brief in die Tasche[2], „Mapserlan ist wirklich ständig beobachtet worden. Die Spione waren hinter ihm her und wußten so, daß er bei mir gewesen. Da haben sie oder besser „sein Feind“ – das können auch mehrere Leute sein – sogar am Tage sich in seine Zimmer gewagt und irgend etwas von ihm zu verlangen gesucht. So wurde sein Ende indirekt durch uns beschleunigt.“
„Und die Unterschrift D. Kl. d. Z.?“ fragte ich.
„Ja – das kann heißen: Der Klub der Zuchthäusler, – kann!“
„Wie kommst Du gerade darauf?! Klub der Zuchthäusler – sehr hübscher Titel für ein Schauerdrama!“
„Spotte nicht! Es gibt zuweilen sehr merkwürdige Zufälle im Leben. – Na, davon später. – Um fünf Uhr werden wir bei Frau Hulbatz einziehen –“
„Und der Zweck? Mapserlan ist doch nun tot –“
„Hm – der Zweck?! – Bei der Hulbatz wohnt doch ein möblierter Herr, der das Balkonzimmer innehat. So ein Balkon ist ein bequemer Weg auf den unteren Balkon. Und von diesem kann man ebenso bequem Mapserlans Schlafstubenfenster erreichen.“
„Ah – dann allerdings! – Der Mieter hieß Braun, wie ich mich besinne. Seine Karte hing an der Flurtür.“
„Und die Hulbatz sagte, es sei ein sehr ruhiger Herr, der schon drei Monate bei ihr wohne.“
3. Kapitel.
Hartnäckige Verfolger.
Als wir dann kurz nach fünf bei der Hulbatz anlangten, sagte sie sofort:
„Die Herren wollten doch zwei Zimmer haben. Sie können jetzt auch das des Herrn Braun erhalten, der gegen drei Uhr abgereist ist.“
Harald blickte mich an. Das hieß: Merkst Du was?! Der Kerl ist vor uns ausgekniffen!
„Gut, Frau Hulbatz, wir nehmen auch das andere Zimmer,“ erklärte er. „Ist es schon in Ordnung?“
„Ja. Herrn Brauns Koffer habe ich in die Badestube gestellt. Er will ihn abends abholen lassen.“
„So – so,“ meinte Harst.
Wir schlossen die Verbindungstür der beiden Räume auf und packten dann unsere Handkoffer zum Schein aus. Frau Hulbatz wurde von Harald zu Einkäufen weggeschickt: sie solle etwas für uns zum Abendbrot einholen.
Harald ging sofort, als wir in der Wohnung allein waren, in das Badezimmer. Ich mußte im Flur aufpassen. Er wollte Brauns Koffer durchsuchen. Die Kofferschlösser bereiteten ihm keine Schwierigkeiten.
Doch – die ganze Arbeit war umsonst. Der Koffer enthielt nichts, was über Herrn Braun näheren Aufschluß gegeben hätte.
Dann besichtigte Harald das Balkongeländer und fand auch eine Stelle, wo offenbar häufiger ein eiserner Haken festgeklammert worden war.
Jetzt kam Brauns bisheriges Zimmer heran. Der Schreibtisch war völlig leer. Einen Papierkorb gab es nicht. – Der Schrank und das Bücherspind, der Ofen, das Bett und der Nachttisch – alles wurde aufs genaueste durchstöbert.
Zuletzt der Waschtisch.
Und hier – hier hatte ich Glück! – Die Schublade war innen mit weißem Papier ausgelegt. Harald hatte, bereits etwas enttäuscht über die Erfolglosigkeit unseres Suchens, dieses Papier nur angehoben, ohne es ganz herauszunehmen. Ich war diesmal der Sorgfältigere; ich nahm es heraus. Und – in der linken hinteren Ecke fand ich ein zu einem Fidibus zusammengefaltetes Zigarettentütchen mit dem Aufdruck:
Bahnhofswirtschaft Stahlbad Alexisbad, Harz,
Inhaber M. Sattler.
Harald hatte sich umgedreht.
„Doch etwas entdeckt, mein Alter?“ fragte er.
Ich starrte noch immer auf das schmale Tütchen hin. – Nur ein Zigarettentütchen – und doch erzählte es hier ein ganzes Kapitel einer spannenden Geschichte! – Mir waren sofort Haralds Worte eingefallen: „Spotte nicht! Es gibt zuweilen sehr merkwürdige Zufälle im Leben!“ – Und er hatte die Unterschrift des Warnbriefes als „Der Klub der Zuchthäusler“ gedeutet!
Ich dachte weiter an Herrn Theodor Winndorfs Erzählung von Schloß Friedensburg mit den drei neuen Besitzern, an die stets um ein Viertel eins stehen bleibende Turmuhr und die neun Gäste, von denen Winndorf ebenfalls den grauen, ungesunden Teint hervorgehoben hatte und – die Perücken!
Grauer Teint – kahlgeschorene Köpfe, daher Perücken, – Zuchthäusler –!
Harald hatte mir das Tütchen abgenommen las den Aufdruck, nickte mir zu.
„Mir scheint,“ sagte er, „Der Klub der Zuchthäusler ist auch für Dich kein Schauerromantitel mehr. Winndorfs Mitteilungen zwangen mir förmlich den Gedanken auf, daß zunächst jene drei Leute, die das Schloß erwarben, entsprungene Zuchthäusler sein könnten. Die neun Gäste sind natürlich nie abgereist, obwohl sie den Zug in Alexisbad bestiegen haben. Sie werden ihn auf der nächsten Station verlassen haben und sind von da ins Schloß gefahren.“
„Genau dasselbe denke ich. – Aber die Turmuhr?!“
„Wenn Du Winndorf gefragt hättest, ob nie neun Männer nicht jeder ein Zimmer nach Nordwest heraus, nach dem Schlosse zu, verlangt hätten, würde er mit Ja geantwortet haben. – Die Sache ist die, glaube ich, daß die Turmuhr, sobald sie auf ein Viertel eins stehen blieb, den Gästen verriet, daß sie sich getrost ins Schloß wagen dürften. Die Leute sind eben sehr vorsichtig – und dies mit Recht.“ – Er faßte in die Tasche und holte die neueste Nummer der internationalen Polizeinachrichten hervor, auf die er stets abonniert war.
„Du, mein Alter, hast heute über Mittag ein Stündchen Verdauungsschlaf gehalten,“ sagte er nun. „Ich habe diese Zeitschrift studiert. Und darin hättest Du einen Aufsatz über die rätselhaften Ausbrüche von Gefangenen aus Zuchthäusern in England, Holland, Deutschland und Schweden gefunden. Dieser Aufsatz ist sehr lesenswert. Es heißt darin, daß ohne Zweifel Gefangenaufseher bestochen worden sein müssen. Es müsse des weiteren hinter diesen stets gelungenen Ausbrüchen irgend eine geheime Organisation stehen, die, überreich mit Geldmitteln ausgerüstet, nur bestimmte Gefangene befreien wolle. Bisher seien sechs englische, zwei holländische, fünf deutsche und drei schwedische Schwerverbrecher, die sämtlich zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt waren, mit größtem Raffinement befreit worden. Man habe keinem der in Frage kommenden Gefangenaufseher eine Beteiligung nachweisen können, und doch müßten sie die Hand mit im Spiel gehabt haben. – Diesen Artikel las ich nach Empfang des Warnungsbriefes mit der Unterschrift D. Kl. d. Z. Und ich rechnete aus: drei Schloßbesitzer, ein neuer Schloßkastellan, drei Bediente und neun Gäste, die bei Winndorf gewohnt hatten, – das macht sechzehn Leute. Und sechzehn Schwerverbrecher sind entflohen! – Sollte das alles Zufall sein?!“
„Niemals!“
„Na also! – Herr Braun hier ist vor uns ausgekniffen. Die Hulbatz wird ihm von den beiden Mietern erzählt haben. Und da hat Braun Verdacht geschöpft, daß wir beide Interesse für ihn hätten. – Wir werden nun warten, bis die Hulbatz heimkehrt, werden zum Schein rasch etwas essen und dann draußen auf der Straße warten, bis Brauns Koffer abgeholt wird. Wenn wir die Sache schlau anfangen, wird der Koffer uns doch noch etwas verraten.“ –
Wir fingen die Sache schlau an. Wir setzten uns in ein geschlossenes Auto, dessen Chauffeur durch einen Hundertmarkschein sich schnell zum Detektivgehilfen entwickelte.
Er arbeitete scheinbar im Schweiße seines Angesichts vor dem Hause Nr. 199 auf der anderen Fahrdammseite an dem Motor herum.
Wir froren wie die Schneider. Aber wir hatten Geduld. Es wurde ½8; es wurde 8, wurde ½9, wurde – Na – um zehn Uhr gab Harald die Sache auf.
„Du,“ meinte er, „der Braun ist doch nicht so dämlich! Leider nicht! Fahren wir heim.“
In demselben Augenblick öffnete der Chauffeur die Tür und flüsterte in das Wageninnere hinein:
„Herr Harst, hier hat mir eben ein Mann, ein Radfahrer, ’nen Brief für Sie abgegeben –“
Harald schnitt den Umschlag auf. Da stand auf der Rückseite einer mitten durchgerissenen Speisenkarte mit Bleistift geschrieben:
Sie werden sich einen Schnupfen holen. Ich saß seit ½7 am Fenster der Kneipe schräg gegenüber. – Ich warne Sie nochmals: Lassen Sie die Hände davon weg! Sonst merken Sie sehr bald, daß mit uns nicht zu spaßen ist! – D. Kl. d. Z.
Wir fuhren nach Hause. Harald lachte ganz vergnügt: „Der Kerl hat im Warmen gesessen, und wir im Kalten. Na – bald wird es umgekehrt sein! Dafür werde ich sorgen!“
Daheim schrieb er einen Brief an Frau Hulbatz, sie könne die Zimmer weiter vermieten; wir hätten plötzlich abreisen müssen. Unsere Koffer würden später abgeholt werden.
Den Brief trugen wir – nicht mehr maskiert – in den nächsten Kasten.
„Sperre die Augen gut auf!“ meinte Harald. „Wir werden feststellen, wo ihre Spione sind!“
Doch – es schienen keine da zu sein. – „Hm,“ sagte Harald unzufrieden, als er den Brief in den Kasten warf, „dies behagt mir nicht! Wir müssen unbedingt in die Nähe von Alexisbad gelangen, ohne daß jemand weiß, wohin wir gereist sind. – Na – morgen ist auch noch ein Tag!“ –
Am folgenden Vormittag besorgte ich für uns Eintrittskarten zum Neuen Operettentheater. Harald hatte mit unserem Bekannten, dem Kriminalkommissar Bechert, alles genau verabredet. Bechert sollte uns während der Vorstellung herausrufen und im Dienstauto zum Präsidium bringen, von wo wir dann durch einen Seitenausgang verschwinden konnten. Unsere beiden Koffer sollten um neun Uhr abends nach dem Anhalter Bahnhof geschafft werden.
Den Tag über merkten wir nicht das geringste davon, daß wir beobachtet würden. Als wir uns für das Theater fertig machten, meinte Harald: „Die Kerle sind schlau! Ich wette, sie sind doch in der Nähe!“
Um 10 Uhr holte uns Bechert ab. Wir fuhren jetzt erst zum Anhalter Bahnhof und ließen uns unsere Koffer herausgeben.
Bechert wußte über unsere Absichten nichts weiter, als daß wir den Mann suchen wollten, der bei Mapserlan eingebrochen hatte. Von dem D. Kl. d. Z. erfuhr er nichts. Nur das eine merkte er ja selbst; daß irgendwelche Leute uns ständig im Auge behielten! –
Um Mitternacht fuhr der berühmte „grüne Wagen“ am Präsidium mit einigen Häftlingen nach dem Moabiter Untersuchungsgefängnis. In dem Wagen saßen auch ein älterer Herr und eine grauhaarige Dame: Harst und ich! – Bechert war uns nach Moabit vorausgeeilt. Wir verließen den Wagen erst im Hofe, so daß unser Trick unmöglich durchschaut werden konnte.
Nach einer Stunde brachte uns ein Auto samt den Koffern nach dem Bahnhof Friedrichstraße. Hier bestiegen wir ein zweites, vorher bestelltes Auto, und sausten nun mit dem eleganten Reisewagen aus Berlin hinaus gen Halle. Unser Chauffeur war der Privatdetektiv Plittner, mit dem wir schon häufiger zusammengearbeitet hatten.
Als wir die offene Chaussee erreicht hatten, ließ Harald halten. Wir hatten hinter uns die Scheinwerfer eines anderen Autos bemerkt und wollten es vorüberlassen. Harald war noch immer argwöhnisch, obwohl ich es für ausgeschlossen hielt, das man noch auf unserer Spur sein könnte.
„Plittner, basteln Sie an dem einen Reifen herum – zum Schein!“ sagte Harst.
Das andere Auto war noch weit entfernt.
Da – mit einem Male erloschen seine Scheinwerfer.
„Aha!“ meinte Harald. „Also doch!“
Er weihte Plittner jetzt völlig ein. – „Wir werden sie doch loswerden!“ lachte Plittner. „Sobald wir dicht vor dem Städtchen Jüterbog sind, halte ich einen Moment, und Sie beide steigen mit den Koffern schnell aus. Ich fahre weiter.“
So wurde es denn auch gemacht. Das andere Auto war etwa fünfhundert Meter hinter uns. Die Nacht war so dunkel, daß wir nicht zu fürchten brauchten, von den Verfolgern beobachtet zu werden.
In einem Wäldchen stehend, ließen wir das zweite Auto vorbei.
„Fahrt wohl!“ sagte Harald ironisch. „Schade, daß wir nicht sehen konnten, wer darin saß –“
Wir nahmen unsere Koffer und schritten der Stadt zu.
Zwei Autos kamen uns entgegen; dann ein drittes – ohne Verdeck. Wir waren hinter einen dicken Chausseebaum getreten. Das dritte Auto hielt plötzlich dicht vor uns. Die drei Männer hinten sprangen heraus und auf uns zu.
Einer der Scheinwerfer wurde so gedreht, daß er uns beleuchtete.
Wir hatten unsere Pistolen unter den Pelzmänteln stecken. Wir konnten sie nicht schnell genug hervorholen. Die drei Leute sprachen kein Wort. Sie trugen Autobrillen und hielten uns ihre Revolver vor das Gesicht. Der eine deutete stumm auf das Auto. Das hieß: wir sollten einsteigen!
Gerade diese Lautlosigkeit ihres Vorgehens wirkte bedrohlich. Die Kerle hätten uns wohl fraglos niedergeknallt, wenn wir uns widersetzt hätten.
Wir gehorchten. Als wir dicht am Auto uns befanden, packten die Kerle zu. Zwei nahmen Harsts Arme, ein wahrer Riese die meinen. Handschellen knackten um unsere Gelenke zu.
Dann drängte man uns in den Wagen, band uns Autobrillen mit geschwärzten Gläsern vor, und – die Fahrt ging weiter, nachdem das Verdeck wieder aufgeschlagen war. – Das Auto der Verfolger hatte ein Verdeck gehabt.
Niemand sprach ein Wort. – Wir beide konnten nichts sehen. Das Auto machte wiederholt kehrt, wie ich merkte. Man wollte uns über die Fahrtrichtung täuschen.
Dann – nach etwa drei Stunden – passierten wir eine größere Stadt. Es mußte nun bald Tag werden.
Das Auto hielt sehr bald. Wir wurden herausgehoben und in einen Raum geführt, in dem es eisig kalt war. Man nahm uns die Autobrillen ab. Wir fanden uns so in einem Zimmer wieder, das fraglos zu einer Sommervilla gehörte und das nur einen eisernen Ofen hatte. Die Fenster gingen nach einem verschneiten Walde hinaus.
Zwei der Leute blieben bei uns. Der eine heizte den Ofen, der andere bewachte uns. Wir hatten uns auf ein Rohrsofa setzen müssen. Sie hatten die Autobrillen noch auf und trugen fuchsige falsche Bärte. Auch jetzt sprachen sie nichts. Die Geschichte war ziemlich unheimlich.
Die Sonne stieg höher und beleuchtete den Wald. Wir froren sehr. Ein dritter Mann brachte uns dann heißen Kaffee und auf einem zweiten Tablett Setzeier, Wurst, Brot und Butter.
„Trinke den Kaffee nicht!“ sagte Harald laut zu mir. „Vielleicht ist etwas darin, wodurch wir allzu fest schlafen könnten.“
Endlich doch wieder eine menschliche Stimme! Nach diesen Stunden des Schweigens wirkten diese Worte wie eine Erlösung.
„Wir nicht Mörder sind!“ erklärte unser Wächter dumpf und in mangelhaftem Deutsch. „Sie sich irren, Herr Harst!“
Der andere Mann, der noch vor dem Ofen hockte, wandte sich um und meinte: „Sei still! Wenn sie nicht trinken wollen, dann lassen sie’s eben bleiben!“
Das klang weit unfreundlicher. Der, der es sagte, war jedoch kein Ausländer, sondern ein Deutscher.
Harald nickte mir zu. „Ich glaube, wir dürfen es wagen. Leider sind uns noch die Hände gefesselt.“
„Wenn Sie versprechen, keinen Fluchtversuch zu unternehmen, werden Ihnen die Fesseln abgenommen werden,“ ließ sich der vor dem Ofen wieder hören.
„Wir versprechen es,“ erklärte Harst kurz.
Dann hatten wir wirklich die Hände frei. – Im Ofen prasselte jetzt ein tüchtiges Feuer. Die Luft erwärmte sich schnell. Nachdem wir gegessen hatten, lehnten wir uns jeder in eine Sofaecke. Harald griff in die Tasche. Der Wächter fragte schnell: „Ihr Zigarettenetui Sie suchen, Herr Harst?“ – „Ja – dachten Sie an meine Pistole? Nein, das würde gegen die Abrede sein. Wir werden nicht fliehen.“
Inzwischen waren auch der Chauffeur und der Mann der den Kaffee gebracht hatte, ins Zimmer gekommen und hatten sich an den Ofen gesetzt.
Harald versuchte, eine Unterhaltung zu beginnen. Der Deutsche sagte jedoch recht schroff: „Verhalten Sie sich ruhig! Um ein Uhr mittags können Sie reden!“
4.Kapitel.
Schloß Friedensburg.
Diese Gefangenschaft war jetzt nicht mehr aufregend. Sie war sogar meines Erachtens so harmlos, daß ich in meiner Sofaecke einschlief.
Ich wurde von selbst wieder munter. Ich sah, daß Harald acht Mirakulum inzwischen aufgeraucht hatte. Die Stummel lagen auf der Untertasse. – Ich vernahm draußen das Knattern eines Motors. Im Zimmer befand sich außer uns beiden nur noch der Wächter.
Dann ging die Tür auf und vier Männer traten ein. Der vierte war also neu angekommen – vielleicht mit dem Auto, das ich soeben gehört hatte.
Dieser vierte setzte sich uns gegenüber und sagte ohne jede Einleitung (er war durch Autobrille und Bart genau so unkenntlich wie die anderen):
„Wir verlangen, daß Sie beide nach Berlin zurückkehren und den Fall Mapserlan für alle Zeit vergessen. Sie werden uns Ihr Ehrenwort geben, daß dies geschieht.“ – Die Stimme war herrisch und drohend. Der Mensch schien ein Engländer der Aussprache des Deutschen nach zu sein. Er hatte sich an Harald gewandt, und dieser antwortete ebenso prompt:
„Wir werden unser Ehrenwort nicht geben – niemals!“
Schweigen. – Und nach einer geraumen Weile wieder der Neuankömmling:
„Was geht Sie eigentlich dieser Schurke Mapserlan an?“
„Ob er ein Schurke war, weiß ich nicht. Ich glaube aber fast, er war es. Für ihn interessiere ich mich nicht. Ich möchte lediglich für mich selbst ermitteln, weshalb der sogenannte Herr Braun, der über Mapserlan wohnte, dessen Zimmer dreimal mindestens heimlich durchsucht hat und weshalb Mapserlan vor geheimen Gegnern solche Furcht hatte.“
„Herr Harst, das ist eine Sensationslust, die in diesem Falle für Sie beide sehr unangenehm werden kann. Wenn Sie nicht Ihr Ehrenwort geben, müssen wir Sie ein halbes Jahr gefangen halten.“
Harald erwiderte nichts, sondern nahm eine frische Zigarette.
„Wohin wollten Sie sich jetzt begeben?“ fügte der Sprecher daher hinzu.
„Natürlich nach England, nach London. Die Detektivpolizei von Scotland Yard[3] hätte uns geholfen, herauszubringen, was mit Mapserlan –“
Der Sprecher hatte herrisch abgewinkt. „Sie hätten in London nichts wesentliches erfahren. Wären Sie lieber in Berlin geblieben. – Ich frage zum letzten Mal: geben Sie Ihr Ehrenwort?“
„Nein. Langweilen Sie mich auch nicht weiter mit solchen Zumutungen.“
„Gut – dann sind Sie beide verloren! – Fesselt sie wieder!“ –
Man legte uns die Stahlfesseln an. Und nach zwei Stunden, als es bereits dämmerig war, setzte man uns die Autobrillen auch wieder auf, führte uns in ein Auto und fuhr mit uns davon.
Wohin?! – Ja – das konnte ich mir unschwer selbst beantworten: nach Schloß Friedensburg – nach dem Klubhaus des Klubs der Zuchthäusler! –
Harald und ich saßen wieder auf den Rücksitzen im Wagen.
Nachdem wir etwa eine Stunde gefahren waren, begann er mit dem linken Ellenbogen jene Art von Telegraphie, die uns schon häufig gute Dienste geleistet hatte. Die ersten drei leichten Stöße gegen meinen rechten Ellenbogen waren das Signal „Achtung!“ – Ich wiederholte die Stöße zum Zeichen, daß ich aufpaßte. – Dann zählte ich die ferneren genau ab. – Neunzehn Stöße – also S. Dann ein Stoß – also A. – Und so ging es weiter, bis der Name Saalborg zusammengestellt war. Damit war Schluß.
Ich telegraphierte zu Harst hinüber: „Wo?“ – Nur das eine Wort.
Und die Antwort lautete: „Der Sprecher – vorn im ersten Auto.“
Ah – das stimmte: vor uns fuhr ein Auto her! Sehen konnte ich nichts. Aber ich hatte wiederholt die Hupe gehört.
Also doch Saalborg! Und er war der Sprecher gewesen! – Wie mochte Harald das herausgefunden haben?!
Dann hielt der Wagen.
Und fast im selben Moment vernahm ich den häßlichen, keifend-gellenden Schlag einer Turmuhr.
Ich zählte die Schläge mit. Es war Mitternacht.
Harald hüstelte. Ich verstand: das sollte mir sagen: „Schloß Friedensburg ist erreicht!“ – Herr Winndorf hatte ja von einem sehr durchdringend hellen Schlagwerk der Turmuhr gesprochen.
Ich hörte Flüstern, ein Tor knarren. – Das Auto ruckte wieder an.
Dann befahl eine dumpfe Stimme: „Aussteigen!“
Man nahm mich bei den Armen, führte mich über endlose Treppen und Gänge; man entfernte die undurchsichtige Brille, und ich blinzelte in das rötliche Licht einer großen, alten Petroleumhängelampe, sah Harst vor mir stehen, dem einer der Leute gerade die Clementpistole aus der Tasche zog, sah unsere beiden Koffer auf dem Parkettfußboden und überflog mit raschem Blick das recht große Gemach, dessen alte Möbel, hohe Wandtäfelung und geschnitzte Decke sowie der mächtige Marmorkamin mit seinen lohenden, knisternden Buchenscheiten so überaus behaglich wirkten.
Dann trat der Sprecher ein. Im ganzen waren hier nun fünf Leute vom „Klub“ anwesend.
„Herr Harst,“ begann der Sprecher kurz. „Sie haben Ihr Schicksal noch einmal in der Hand: Wollen Sie Ihr Ehrenwort geben? – Ich mache Sie nochmals darauf aufmerksam, daß wir gezwungen sind, Sie hier vielleicht ein halbes Jahr festzuhalten. Das ist bitterer Ernst.“
Harald schüttelte den Kopf. „Bedauere. Ich kann Ihnen keine andere Antwort geben.“
Die fünf flüsterten hierauf eine Weile miteinander. Dann sagte der Sprecher wieder: „Wir sind bereit, Ihnen die Handfesseln abermals abzunehmen, falls Sie nicht fliehen wollen.“
„Eine etwas seltsame Zumutung!“ meinte Harald. „Gut – für 24 Stunden gebe ich für uns beide die Zusicherung ab, nicht zu entweichen.“
Die Leute tauschten Blicke aus, nickten sich zu. Man nahm uns die Handschellen ab. – Dann mußte Harald unsere Koffer öffnen. Der Sprecher nahm alles an sich, was zum Ausbrechen irgendwie geeignet war, zeigte uns noch einen fensterlosen Alkoven, in dem eine gefüllte Zinkbadewanne und ein anderer, meist in Badezimmern untergebrachter Gegenstand sich befanden, und verließ das Zimmer, schloß die schwere, geschnitzte Tür hinter sich ab und schob von außen noch zwei Riegel vor, wie an den Geräuschen zu erkennen war.
Das Badewasser war lau. Wir badeten, und ich zog dann wieder einen Männeranzug an. Auch Harald legte seine Verkleidung ab. Gleich darauf erschien einer der Leute, der jetzt eine graue Stoffmaske vor dem Gesicht trug, und brachte uns auf einem Riesenteebrett eine reichliche Mahlzeit.
Wir rollten uns zwei altertümliche, hochlehnige Sessel an den Mitteltisch und begannen zu essen. Inzwischen hatten wir schon festgestellt, daß die beiden Fenster von innen durch eiserne Fensterläden verwahrt waren. Es gab hier im Zimmer zwei Diwans mit mehreren Kissen und Decken.
Der Mann holte nachher das Tablett, räumte den Tisch ab und verschwand wortlos.
Wir hatten die Sessel an den Kamin geschoben und rauchten. Ich war hundemüde, gähnte oft und versuchte dreimal, Harst eine Frage zuzuflüstern. Er schüttelte stets ärgerlich den Kopf. – Ich merkte: wir wurden beobachtet!
Dann begaben wir uns angekleidet zur Ruhe. Harald schnarchte bald. Er schien wirklich zu schlafen. Auch ich schlummerte allmählich ein, schreckte wieder empor, versank nachher desto tiefer in dem Meer der Unwirklichkeit, träumte aufregendes, wirres Zeug. Bis ich munter wurde, weil ich laut sprechen hörte. –
Ich richtete mich auf. Vor mir stand der Sprecher. Harald saß bereits auf dem Diwanrand und schnürte sich die Schuhe zu.
„Herr Schraut!“ sagte der Sprecher, „in einer Stunde werden Sie beide dieses Zimmer verlassen. Frühstücken Sie gut. Die nächsten Stunden werden an Ihre Nerven einige Ansprüche stellen.“
Ich bemühte mich umsonst, in dieser dumpfen Stimme das angenehm-schmiegsame Organ Vincent Saalborgs wiederzuerkennen. Ich dachte auch nur einen Moment an Saalborg. Die Worte des Sprechers mit ihrem bedrohlichen Inhalt verfehlten ihre Wirkung nicht. Sollte ich mich doch, was unsere persönliche Sicherheit anbetraf, allzu trügerischen Hoffnungen hingegeben haben?! Sollte sich nicht auch Harald hinsichtlich der Person Saalborgs geirrt haben?!
Der Sprecher und der andere Mann, der inzwischen mit dem Frühstück erschienen war, entfernten sich wieder.
5. Kapitel.
Die Tropfsteinhöhle.
Ich folgte Harald in den Alkoven. Wir wuschen uns. Ich konnte jetzt nicht schweigen, fragte leise: „Was haben die Leute mit uns vor?“
Er zuckte die Achseln. „Ich weiß es wirklich nicht, mein Alter. Jedenfalls befinden wir uns in Schloß Friedensburg. Und dieser Klub der Zuchthäusler scheint mir nur edle Zwecke zu verfolgen.“
Ich war über diese Bemerkung so verblüfft, daß ich sehr gedehnt wiederholte: „Edle Zwecke?“
„Ja. Der ganze Fall Mapserlan deutet darauf hin. – Die Gerechtigkeit, die Justitia, wurde schon von den alten Griechen als Weib mit einer Binde vor den Augen dargestellt, das heißt: blind! – Diese Blindheit zu beseitigen, dürfte –“ – Er schwieg plötzlich und begann sich umständlich die Zähne zu putzen. Ich konnte nur vermuten, daß wir auch hier im Alkoven belauscht worden waren.
Wir frühstückten dann. Nachher traten vier Leute mit grauen Stoffmasken ein und legten uns die Handfesseln wieder an. Man band uns Tücher vor das Gesicht und führte uns hinaus.
Es ging mehrere Treppen abwärts, durch fünf Türen. Dann wehte mich kühle, feuchte Kerkerluft an. Es mußten sehr ausgedehnte Kellerräume sein. Abermals zwei enge Treppen; abermals zwei in den Angeln kreischende Türen.
Dann änderte sich die Luft. Sie war wärmer; sie hatte einen besonderen Geruch – etwa so wie in der Nähe eines Bottichs, in dem Kalk gelöscht wird. – Über holprigen Boden, durch hallende Gewölbe noch ein Weg von fünf Minuten.
Unsere Führer machten halt. Man nahm uns die Tücher ab. Ein Blick genügte mir: wir waren in einer jener Tropfsteinhöhlen, an denen der Harz so sehr reich ist und von denen die größten für den Besuch der Touristen sogar elektrisch beleuchtet werden.
Rechts von uns stand ein langer Holztisch. Dahinter saßen, vom Lichte zweier großen Petroleumlaternen beschienen, drei Männer in braunen Umhängen, deren Kapuzen über die Gesichter herabgezogen waren. Die Kapuzen trugen aufgenähte weiße Zahlen. Nummer 1 saß in der Mitte, rechts 2 und links 3.
Unsere Führer hatten sich bereits wieder entfernt.
Das ganze glich etwa der Sitzung des mittelalterlichen Femegerichts. – Was aber sollte dieser Mummenschanz?! Wollte man etwa uns beide damit schrecken?!
Harald hatte sich an die Grottenwand gelehnt. Meine Augen suchten die seinen. Er blinzelte mir zu. Ein schwaches Lächeln huschte um seine bartlosen Lippen.
Die drei Femrichter schwiegen und bewegten sich kaum. Nach einigen Minuten tauchten vier Männer auf. Zwei von ihnen führten einen Mann, dem über Kopf und Oberleib eine Decke hing.
Vor dem Tisch blieben sie stehen. Ein Ruck, und die Decke flog herab.
Der Mann war nicht gefesselt. Es war ein mittelgroßer, hagerer, älterer Herr in Smoking und Lackschuhen. Sein bartloses Gesicht war aschfahl. Er stierte wild um sich. Auf seiner Stirn perlte der Angstschweiß.
Die vier Leute traten zurück.
Da – Nummer eins der Femrichter begann zu Sprechen.
„Thomas Blyton,“ sagte er zu dem Herrn im zerknitterten Gesellschaftsanzug, „als Sie vor drei Tagen von Bord Ihrer Jacht Neptun nachts heimlich heruntergeholt wurden, ahnten Sie wohl nicht, weshalb dies geschah. Ahnen Sie es jetzt, nachdem wir Sie bis hierher geschafft haben?“
Blyton richtete sich auf, suchte eine gewisse Empörung vorzutäuschen. – „Ihr seid gemeine Erpresser, nehme ich an! Die Polizei wird –“
Er kam nicht weiter. Der Richter Nr. 1 hatte ihn drohend unterbrochen: „Du Lump wagst mit der Polizei zu drohen?! – Winnamour,“ wandte er sich an einen der vier Leute. „Tritt vor und erhebe Anklage gegen diesen Thomas Blyton, Chef des Exporthauses Blyton u. Co. in London.“
Der Mann nahm die Stoffmaske ab und stellte sich neben den Tisch, rief Blyton zu: „Schurke, erkennst Du mich?! Fünf Jahre habe ich durch Deine Schuld bereits im Zuchthaus geschmachtet, bis man mich befreite!“
Thomas Blyton war zurückgetaumelt.
Winnamour, ein noch junger Mensch, sprach weiter: „Ich klage diesen elenden Schurken an, mich durch heimtückische Ränke in den Verdacht des Mordes gebracht und durch bestochene Zeugen meine Verurteilung zu lebenslänglichem Zuchthaus erreicht zu haben. Ich soll seinen Kassenboten umgebracht und 80 000 Pfund Sterling geraubt haben. Ich bin unschuldig. Er selbst ist der Mörder!“
Blyton spielte hier eine von vornherein sehr traurige Rolle. Gewiß, er gab sich alle Mühe, seine Todesangst zu verbergen. Der Schweiß lief ihm über die Stirn, über die bleichen Wangen. Dann stieß er recht unsicher hervor:
„Diese – diese Frechheit! Ich soll gemordet haben!“
„Weixler, Bleeker!“ rief der Richter Nr. 1.
Und wieder traten zwei der Leute vor und nahmen die Masken ab. Einer sagte dann zu Blyton: „Schurke, erkennst Du uns?! Wir sind jene beiden Zeugen, die Du zuerst bestachst, um Winnamour ins Unglück zu bringen! Du bestachst uns und drohtest gleichzeitig, uns wegen kleiner Unredlichkeiten anzuzeigen, die wir uns als Deine Angestellten hatten zuschulden kommen lassen. Als Winnamour dann erledigt war, kam die Reihe an uns beide! Wir wissen es jetzt, wie Du es angestellt hast, uns gleichfalls für Lebenszeit ins Zuchthaus zu bringen. Wir ahnten nicht, daß Du dahinter stecktest –“
Jetzt nahm auch der Richter Nr. 1 die Maske ab. Ein bartloses, faltiges, kluges Gesicht mit großen Augen kam darunter zum Vorschein.
„Stannington!“ kreischte Blyton auf.
„Ja – Stuart Stannington, noch vor vier Jahren der angesehenste Privatdetektiv Londons!“ sagte dieser langsam. „Jetzt ein – entsprungener Zuchthäusler – ebenfalls Dein Opfer, Thomas Blyton! – Ich war es, der Deinen Schandtaten gegen Winnamour, Weixler und Bleeker auf die Spur kam! Ich wollte Dich überführen. Aber Deine satanische Schlauheit siegte auch diesmal: Du vermochtest mich gleichfalls eines Mordes scheinbar zu überführen! Dein Ränkespiel, überaus fein berechnet und gestützt durch Deine Millionen, glückte. Auch ich verschwand hinter Kerkermauern. Nicht viel hätte gefehlt, dann wäre ich zum Tode verurteilt worden. – Thomas Blyton, wir haben Dich seit gestern in Deiner Zelle hungern und dürsten lassen. Und Dir wird weiter Speise und Trank entzogen werden, bis Du ein Geständnis schriftlich abgelegt und auch unterzeichnest. Hoffe nicht, daß man Dich hier finden wird. Du bist hier so sicher verborgen, als hätten wir Dich nach dem Mond gebracht. – Willst Du gestehen, Thomas Blyton?“
„Und – und was dann?“ stammelte Blyton.
„Dann werden wir Dich nach London zurückschaffen. Ich werde mit Dir nach Scotland Yard fahren und mich dort der Polizei stellen. Dann werden die, die Du ins Unglück brachtest, im neuen Prozeß freigesprochen werden.“
Blyton lachte heiser auf. „Ah – und ich werde gehenkt werden! – Schurken – was seid Ihr dumm! Eher verhungere ich, als daß ich –“
In demselben Moment trat Harald vor.
„Halt, Mr. Blyton,“ meinte er. „Was Sie da soeben ausgesprochen haben, war ein Geständnis. – Vielleicht kennen Sie meinen Namen. Ich bin der Liebhaberdetektiv Harald Harst. Wenn ich als Zeuge auftrete, diese Szene hier schildere und Ihre Worte wiederhole, wird man mir Glauben schenken. – Mr. Stannington,“ wandte er sich darauf an den englischen Detektiv, „lassen Sie Blyton wieder abführen. Ich möchte mit Ihnen unterhandeln.“
Blyton hatte sich, als er Harsts Namen hörte, noch mehr verfärbt. Er duckte sich scheu zusammen, und – dann rannte er wie gehetzt nach links zu in die dunkle Höhle hinein.
„Halt – halt!“ brüllte Stannington. „Ein Abgrund! Blyton – keinen Schritt weiter!“
Aus dem Dunkel ein gellender Schrei – ein vielfaches Echo – so stark, daß ich vor Entsetzen erbleichte.
„Er hat sich selbst gerichtet!“ sagte Stuart Stannington ernst. „Geht, Freunde, – holt, was noch von ihm übrig ist!!“
Zwei der Männer zündeten ihre Laternen an und eilten dem Abgrunde zu.
Stannington wandte sich an Harald.
„Herr Harst, noch einige Worte der Aufklärung,“ meinte er.
„Oh – die erübrigen sich,“ erklärte Harst. „Ich las in den internationalen Polizeinachrichten von den Ausbrüchen der Zuchthäusler. Der erste der Gefangenen, der aus einer englischen Strafanstalt entkam, waren Sie, Stannington; der zweite hieß Winnamour – und so fort. Ich nehme an, daß Sie der Begründer des Klubs der Zuchthäusler sind. Sie als Detektiv stellten sich die Aufgabe, Verurteilte zu befreien, die, wie Sie als Detektiv irgendwie erfahren hatten, unschuldig im Kerker saßen. Sie und zwei der Befreiten erwarben unter anderen Namen Schloß Friedensburg –“
„Ah,“ riefen Stannington und die beiden anderen Femrichter wie aus einem Munde. „Sie wissen auch dies?“
„Ja – die Turmuhr hat Sie verraten. Die Zeiger, die auf ein Viertel eins stehen blieben, waren für die Gäste des Fremdenheims Friedenshaus das Zeichen, daß alles sicher sei und daß sie abends ins Schloß kommen könnten.“
„Also die Turmuhr!“ sagte Stannington kopfschüttelnd. „Und wir glaubten, die Zeigerstellung würde nicht auffallen! Wir wollten eben recht vorsichtig sein –“
„Einer Frau stieß das häufige Stehenbleiben der Uhr auf, nämlich Frau Winndorf,“ nickte Harald. „Ihr Mann war bei mir – zugleich mit Mapserlan. Die Spione, die Mapserlan folgten, werden Winndorf nicht beachtet haben. – Übrigens – wer war „Herr Braun“, der bei der Hulbatz wohnte, und wen von Ihnen hatte Mapserlan ins Zuchthaus gebracht?“
Stannington kam jetzt zunächst um den Tisch herum und nahm uns die Fesseln ab. Dann sagte er:
„Ich selbst war Braun. Mapserlan aber –“
Da wurde er von dem Richter Nr. 2 unterbrochen. Dieser hatte rasch die Kapuze hochgezogen. Wir erkannten auf den ersten Blick Vincent Saalborgs schmales, feines Gesicht. Er sah jetzt genau so aus, wie wir ihn vor vielen Monaten zum ersten Mal in Pernambuco (vergl. Band 57 „Das Geheimnis des Brasilianers“) kennengelernt hatten.
„Herr Harst, meine Laufbahn als Hochstapler dürfte nun zu Ende sein. Meine Lebensgeschichte will ich Ihnen nachher erzählen. Jetzt nur folgendes: Ich war bereits wieder in Berlin, als Sie die italienische Erpresserbande „Loge zum heiligen Chrysostomos“ unschädlich machten. Mich interessierte dieser Fall derart, daß ich dabei lediglich den Beobachter spielte. Dann erkannte ich eines Tages Stannington, der mir von Ansehen nicht fremd war, in der Maske des Herrn Braun, und durch Stannington, dem ich nachgeschlichen war, wurde ich auf jenen Mann aufmerksam, der sich Mapserlan nannte und bei der Witwe Marten wohnte. – Herr Harst, dieser angebliche Mapserlan, der in Wahrheit Bollingray hieß, ist nun ein noch weit schlimmerer Schurke als Blyton gewesen. Es ist der Mann, der mich auf die Bahn des Verbrechens gestoßen hat, der aber auch zwei Holländer ins Zuchthaus brachte. Und dieser Holländer wegen wurde er vom Klub der Zuchthäusler ständig bewacht, damit man ihm bei günstiger Gelegenheit die Papiere, die die Unschuld der Holländer beweisen konnten, abnehmen könnte. – Jedenfalls merkte ich, daß Stannington hinter diesem Bollingray her war. Ich hatte in der Zeitung gelesen, Stannington sei aus dem Zuchthaus entwichen. Ich trug also keinerlei Bedenken, mich ihm anzuvertrauen. So wurde ich selbst ein Mitglied des Klubs. Bollingray-Mapserlan starb durch einen Unfall. Er floh vor mir in die Küche, stolperte und fiel auf die Schneide des Messers der Brotmaschine. Ich fand die Papiere, die die Unschuld der Holländer dartun werden, in seiner Weste hinten im Futter eingenäht; ich fand gleichzeitig noch etwas. Darüber spreche ich nachher, etwas, das mich angeht!“
„So,“ fügte Stannington hinzu, „nun möchte ich Sie fragen, Herr Harst, wie Sie sich zu unserer Bitte stellen, das Geheimnis des Klubs der Zuchthäusler so lange niemand zu verraten, bis wir die Schuldlosigkeit sämtlicher Mitglieder den Gerichten beweisen können.“ –
Mir fielen jetzt Haralds Worte über den edlen Zweck ein. Ich erkannte, daß Harald aus sich selbst heraus den Zweck des Klubs richtig durchschaut gehabt hatte. –
„Sie verlangen da etwas von mir, Stannington, das ich nicht versprechen kann,“ erwiderte Harst. „Aber – ich will mir die Sache überlegen. Der Fall Mapserlan ist nun genau so geklärt wie der des Kl. d. Z. – Mich interessiert jetzt lediglich noch Vincent Saalborgs Lebensgeschichte und das, was er in Mapserlans Weste fand.“ –
Die beiden Leute kamen mit Blytons Leiche herbei. Der Kopf war bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert. –
Wir gingen durch die Kellerräume nach oben ins Schloß. Saalborg und Stannington setzten sich dann in unserem Zimmer mit an den Tisch.
Uns dreien erzählte Saalborg nun seine seltsamen Schicksale. Ich bringe diese Schilderung als erstes Kapitel des „armlosen Fakirs“ auf der nächsten Seite.
Der armlose Fakir
1. Kapitel.
Saalborgs Erzählung.
„Selten wohl dürfte der Lebensweg eines Menschen so scharfe Kurven beschrieben haben wie der meine.
Sie, die heute endlich erfahren, wer der gefürchtete Hochstapler Saalborg, der Mann mit den tausend Namen und tausend Gesichtern, in Wirklichkeit ist, werden Dinge hören, die außerhalb jeder Möglichkeit zu liegen scheinen. Keines berufsmäßigen Erzählers überhitzte Phantasie könnte das ersinnen, was ich durchgemacht habe. Nur in Indien, dem Lande der Rätsel, konnte sich eine solche Anhäufung von scheinbar unfaßbaren Schicksalsschlägen ereignen.
Ich bin Engländer von Geburt. Mein Name ist Lord Horace Wiclaytour.
Ich sehe Ihr ungläubig-erstauntes Gesicht, Landsmann Stannington. – Es ist so: ich bin Wiclaytour, der scheinbar vor sechs Jahren im Ganges-Flusse ertrank, als er kurz vor seiner Hinrichtung aus dem Gefängnis in Benares ausbrach.
Ich bin der letzte Träger dieses Namens. Mein Vater war Major in der indischen Armee und stand damals, als ich das Licht der Welt erblickte, in der Residenz der Fürstin von Bhutala in Garnison.
Meine ersten Jugenderinnerungen zeigen mir ein uraltes, prächtiges Schloß außerhalb der Stadt Bhutala mit weiten Parkanlagen. Meine Mutter war ein Jahr nach meiner Geburt gestorben, und mein Vater wurde der bevorzugte Günstling der indischen Fürstin, die in jenem Schlosse hauste, der Fürstin Dschehani von Bhutala.
Ich erhielt mit zehn Jahren einen Erzieher, einen Engländer namens Doktor Edward Bollingray, dessen Bruder jener Mapserlan-Bollingray war.
Doktor Bollingray flößte mir sehr bald tiefen Abscheu ein. Ich war ein frühreifes Kind. Ich war sehr viel mir allein überlassen gewesen und hatte ohne Wahl alles gelesen, was mir in die Hände geriet. Mein Erzieher, ein Heuchler schlimmster Sorte, merkte in kurzem, daß die Begum (Fürstin) Dschehani mich haßte, weil mein Vater, den sie ganz für sich allein haben wollte, an mir mit großer Liebe hing.
Der Reichtum der Fürstinnen von Bhutala ist bekannt. Doktor Bollingray freundete sich mit der englischen Gesellschafterin der Begum, einer Miß Breeg, sehr an, und diese beiden Menschen waren es, die mich nun auf diese oder jene Art heimtückisch beseitigen wollten.
Ich sollte – verunglücken! – Die beiden hofften fraglos, daß die Begum sich erkenntlich zeigen würde.
Wollte ich hier schildern, was sie alles ersannen, um ihr Ziel zu erreichen, dann müßte ich viele Stunden erzählen.
Wie gesagt: ich war frühreif, klug, listig, ein kleiner Schauspieler, dabei kräftig, gewandt und furchtlos. Schon nach dem ersten Attentat merkte ich, was mir drohte. Ich überlegte damals, ob ich mich meinem Vater anvertrauen sollte. Ich hatte mit einem Fakir, der nördlich des Schlosses in einer Schlucht des Windhya-Gebirges hauste, Freundschaft geschlossen.
Der Mann hatte keine Arme. Er war Schlangenbeschwörer und Zauberer, also ein Yogi, wie die richtige Bezeichnung für diese Unterkaste der Hindu lautet. Er hieß Shara Dragi. – Ich hatte ihm häufig Geld geschenkt, und irgend etwas Unerklärliches zog mich zu dem schmierigen Krüppel hin, der seine Arme infolge seiner fabelhaften Gewandtheit, die Zehen als Finger zu benutzen, kaum entbehrte.
Diesem Yogi erzählte ich, daß Doktor Bollingray mich bei einem Spaziergang auf ein loses Felsstück an einem Abhang gelockt hätte. Shara Dragi riet mir, meinem Vater alles zu verschweigen. Und er war es denn auch, der mich heimlich zu schützen suchte.
So wurde ich fünfzehn Jahre, ohne daß mir etwas zustieß. Dann ließ Doktor Bollingray seinen jüngeren Bruder Thomas nach Bhutala kommen. Thomas war Kaufmann und trat in der Residenzstadt in eine englische Firma als Buchhalter ein.
Bald nach seinem Eintreffen spürte ich, daß ich morgens stets mit wirrem Kopf und wie halb gelähmt aufwachte.
Der Yogi, mein einziger Vertrauter, warnte mich abermals davor, meinem Vater gegenüber Doktor Bollingray zu verdächtigen. Der Doktor hatte sich auch bei meinem Vater längst derart eingeschmeichelt, daß dieser mir kaum Glauben geschenkt hätte.
Ich sollte, riet Shara Dragi mir, einmal die Abendmahlzeit unberührt lassen. – Ich tat es, und am anderen Morgen war mein Kopf völlig klar. Mithin brachte man mir kleine Mengen Gift im Abendessen bei.
Ich bat meinen Vater nun, mich nach England in eine der berühmten Erziehungsanstalten zu schicken. Doch mein Vater wollte sich erst nicht von mir trennen bis ich ihm dann in meiner Erregung mitteilte, was ich über die Wirkung der Abendmahlzeiten festgestellt hatte. Er – lachte mich aus.
Das steigerte meine Erregung noch. Ich hütete mich, zu verraten, daß der Yogi mein Freund und Beschützer bisher gewesen. Ich erzählte meinem Vater jedoch von all den Attentaten – anders kann ich diese Mordversuche nicht bezeichnen –, die man gegen mich unternommen hätte.
Da wurde sein Gesicht ernst und traurig. Er strich mir über das Haar und murmelte: „Mein armer Junge!“
Dann ging er hinaus.
Nach ein paar Stunden wurde ich vor dem Leibarzt der Begum in seiner Anwesenheit sozusagen ins Verhör genommen. Ich mußte nochmals alles wiederholen, was ich gegen Doktor Bollingray vorzubringen hätte.
Ich merkte bald: der Arzt und mein Vater zweifelten an meinem gesunden Verstand, hielten mich für – irrsinnig!
Während der Arzt sich noch mit mir unterhielt, erschien meines Erziehers Bruder im Zimmer. Dieser Thomas Bollingray behauptete dann, ich hätte ihm gegenüber seinen Bruder letztens in derselben Weise verdächtigt.
Das war natürlich gelogen. Ich widersprach. Ich bekam einen Wutanfall, als ich spürte, daß man meinem Vater bereits eingeredet hatte, ich litte an – Verfolgungswahn.
Ich war ein starker Bursche, sprang Thomas Bollingray an die Kehle, und – dadurch war mein Schicksal besiegelt.
Am folgenden Tage holten mich zwei Ärzte ab und nahmen mich mit nach Benares in ein – Privatsanatorium.
Ich war jetzt ein Gefangener. Ich war – gemeingefährlich. –
Sechs Jahre lebte ich dort in einem Zimmer mit vergitterten Fenstern. Gleich nach meiner Einlieferung hatte sich in mir ein unvernünftiger Haß gegen meinen Vater festgesetzt. Ich konnte nicht glauben, daß mein Vater wirklich von meiner Geisteskrankheit überzeugt wäre. Ich nahm an, er hätte mich als ihm unbequem los sein wollen.
Mein Vater besuchte mich immer seltener. Freilich – trat er im meinen Kerker ein, drehte ich ihm den Rücken zu.
Daß ich in diesen sechs Jahren nicht den Verstand tatsächlich verlor, hatte ich nur meiner Energie zu verdanken und – Shara Dragi, dem armlosen Fakir, der häufiger im Garten des Sanatoriums bettelnd erschien und dann Gelegenheit fand, sich mit mir zu unterhalten. Er tröstete mich; er sprach mir Mut zu. Er gab mir auch einmal eine Stahlsäge, damit ich nachts das Fenstergitter zerschneiden und fliehen könnte. Doch – das Sanatorium wurde zu gut bewacht. Ich mußte den Plan aufgeben. Die kleine Säge aber nähte ich in das Futter einer Jacke ein – für eine besonders günstige Gelegenheit.
Ich studierte fleißig fremde Sprachen, bildete mich allein weiter, turnte, trieb Sport, las viel und suchte die Ärzte der Anstalt zu überzeugen, daß ich völlig gesund sei.
Sie waren freundlich zu mir. Aber – sie hielten mich doch für geisteskrank. –
Kurz nach meinem 21. Geburtstag war’s, als der Yogi abermals sich im Garten zeigte. Ich ging hinab. Mein Wärter blieb wieder wie immer dicht hinter mir.
Shara Dragi wußte sein Äußeres gut zu verändern, damit seine häufigen Besuche nicht auffielen.
Der Yogi hockte neben einer Bank. Ich setzte mich und begann mit ihm eine scheinbar gleichgültige Unterhaltung. Er flüsterte mir dann in Zwischenräumen zu, daß die Begum einen neuen Günstling gefunden hätte und daß mein Vater nach Benares ziehen würde, wo er bereits einen Bungalow (Sommervilla) erworben hätte. – Er sagte mir auch, wo dieser Bungalow im Europäerviertel lag, und teilte mir weiter mit, mein Vater scheine jetzt hinsichtlich des wahren Charakters der Brüder Bollingray und der Miß Breeg doch wohl anderer Ansicht geworden zu sein; vielleicht würde mein Vater mich nun aus der Anstalt herausnehmen. –
Diese Neuigkeiten ließen mich völlig gleichgültig. Mein Vater war mir fremd geworden. Ich sah in ihm kaum noch meinen[4] Vater. Daß er mich aus meinem Kerker aus eigenem Antriebe befreien würde, daran glaubte ich nicht.
Der Yogi erzählte mir jedoch noch mehr. Und dieser Schluß seiner Mitteilungen machte doch einen gewissen Eindruck auf mich. – Mein Vater, sagte er, hätte im Laufe der Jahre von der Begum eine Unmenge Diamanten geschenkt erhalten. Diese Edelsteine habe er irgendwo verborgen. Es sprachen nun verschiedene Anzeichen dafür, daß die Brüder Bollingray versuchen würden, die Diamanten irgendwie an sich zu bringen. Shara Dragi konnte mir diesen Verdacht nicht näher begründen, da er dazu nicht genügend Zeit hatte. Ich zweifelte nicht daran, daß dieser Verdacht berechtigt sei. Auch Doktor Bollingray weilte nämlich noch immer in Bhutala, wo er in dieselbe Firma eingetreten war, von der sein Bruder Thomas inzwischen durch recht dunkle Machenschaften Besitz ergriffen hatte.
Der Yogi versprach mir noch, die Bollingrays nicht aus den Augen zu lassen, und verabschiedete sich dann. –
So, und nun, meine Herren, kommt das, was ich mit Recht als Katastrophe bezeichnen kann – die Katastrophe meines Lebens! Ich will die Ereignisse nur kurz streifen.
Zwei Tage nach diesem Besuch des Fakirs wurde mir im Garten aus einen Gebüsch von unbekannter Hand ein um einen Stein gewickelter schmaler Streifen Papier unauffällig zugeworfen. Auf dem Papier stand auf englisch in sehr unbeholfener Schrift:
„Heute nacht zwölf Uhr. Achtung. Fenster. – Vernichten“.
Ich konnte nur annehmen, daß der Yogi den Zettel geschrieben hatte. – Ich zerkaute den Streifen Papier und verschluckte ihn.
Abends wurde ich wie immer eingeschlossen. Ich legte mich zum Schein ins Bett. Als ich die Uhr im Korridor 12 schlagen hörte, trat ich an das linke Fenster. – Die Scheibe wurde von einem bärtigen Inder, der offenbar an einem Strick vom Dache sich herabgelassen hatte, eingedrückt. Der Mann flüsterte mir zu, ich solle an der Tür lauschen, damit wir nicht überrascht würden. Er sägte das Fenstergitter durch. Dann rief er mich leise herbei und riet mir, mich sofort nach dem Bungalow meines Vaters zu begeben. Er kletterte nach oben auf das Dach. Ich folgte ihm. Aber er war schon verschwunden, als ich oben anlangte.
So mußte ich denn allein meine Flucht fortsetzen. Ich kam unbemerkt über die Mauer des Parkes und eilte dem Europäerviertel zu. Hier fragte ich einen Polizeimann nach der Straße, in der mein Vater wohnen sollte. Ich wußte in Benares nicht Bescheid.
Als ich über das Gitter der Gartenpforte geklettert war und die Veranda des Hauses erreicht hatte, sah ich durch ein offenes Fenster meinen Vater schlafend in einem erleuchteten Arbeitszimmer in einem Sessel sitzen.
Ich stieg durch das Fenster ein. Zu meinem Entsetzen gewahrte ich dann, daß die Hausjacke des anscheinend Schlafenden an der Herzseite mit Blut besudelt war. Mein Vater war tot! Neben dem Sessel lag ein langer, krummer afghanischer Dolch.
Kaum hatte ich diese Waffe bemerkt, als im Flur des Hauses jemand laute Hilferufe ausstieß.
Es wurde wieder still. Ich verharrte noch immer wie betäubt am selben Platze.
Diener erschienen, – auch bald ein Polizeimann. Ich war so verstört, daß man mich verhaftete. –
Ich blieb in Haft. Man glaubte mir nicht, daß ein Fremder mir zur Flucht verholfen hätte. Man nahm an, ich hätte meinen Vater aus Rachgier ermordet, weil er mich in die Anstalt gebracht hatte.
Polizeiärzte untersuchten mich auf meinen Geisteszustand hin. Ich wurde für – gesund erklärt. Ich war es ja auch.
Inzwischen hatte man in einem dichten Gebüsch des Nachbargartens meines Vaters noch die Leiche Doktor Bollingrays gefunden – ebenfalls mit einer breiten Stichwunde im Herzen. Auch dieser Mord wurde mir zur Last gelegt. Für die Polizei und das Gericht war ich ein ganz raffinierter Verbrecher, ein völlig verderbter Mensch. –
Thomas Bollingray, der sich in Berlin jetzt Mapserlan genannt hatte, wurde mir gegenübergestellt. Er verstand es, mich noch mehr zu belasten. Ich wurde zum Tode verurteilt.
Da erst erwachte ich gleichsam, als mir das Todesurteil verkündet wurde. Der Trieb zum Leben, der Wunsch, diese Schurkerei, deren Opfer ich geworden, aufzuklären, gab mir die nötige geistige Spannkraft, meine Flucht vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Man verfolgte mich jedoch sofort. Ich sprang in den Ganges-Fluß und täuschte hier sehr geschickt im Wasser einen verzweifelten Kampf mit einem Krokodil vor, schrie um Hilfe, versank, als ob die Bestie mich in die Tiefe zöge, und schwamm unter Wasser auf ein verankertes Hausboot zu.
Ich entkam so.
Seltsamerweise hatte der Fakir nichts mehr von sich hören lassen. Er sollte als Zeuge vernommen werden. Er war nicht zu finden – ebensowenig die Juwelen meines Vaters! Und dies letztere betone ich besonders.
Verkleidet hatte ich mich nach Bhutala begeben. Ich wollte Shara Dragi suchen. In Bhutala erfuhr ich, daß Thomas Bollingray das Geschäft verkauft hatte und vor fünf Tagen nach England zurückgekehrt war.
Ich besaß keinerlei Geldmittel. Als indischer Bettler fristete ich wochenlang mein Leben. Dann begann ich meine Laufbahn als Dieb, als Hochstapler, um mir das Geld zur Verfolgung Thomas Bollingrays zu verschaffen.
Ich konnte Bollingray nirgends aufstöbern. Ich war ein Geächteter, ein Namenloser. So erklärte ich denn denen den Krieg, die praßten und schlemmten, währen andere darbten. Ich bestahl nur Reiche. So wurde ich der Schrecken der Großstädte, wurde ich – Vincent Saalborg.“
2. Kapitel.
Der Ort der Tat.
Lord Horace Wiclaytour schwieg.
Wir drei Zuhörer schauten ihm voller Mitleid in das schmale, edle Gesicht.
Er griff langsam nach einer Zigarette und zündete sie an, fügte nach den ersten Zügen hinzu:
„Das, was ich in Mapserlans Weste außer den Papieren fand, war dies –“
Er nahm einen Ring aus der Tasche, einen altindischen Schlangenring mit zwei Brillanten.
„Dieser Ring war das erste Geschenk, das die Fürstin von Bhutala meinem Vater machte. Er trug den Ring stets am kleinen Finger der linken Hand. Ich habe ihn nie ohne diesen Ring gesehen. Er hätte ihn auch nie verschenkt. Der Ring ist der beste Beweis dafür, daß Thomas Bollingray-Mapserlan der Mörder meines Vaters und seines Bruders war, und daß er die Juwelen geraubt hat. Wahrscheinlich hat er auch den Yogi umgebracht.“
Lord Wiclaytour blickte bei diesen Sätzen Harald fragend an.
„Sie wünschen meine Ansicht zu hören?“ meinte Harst denn auch sofort. „Ich glaube nicht, daß Thomas seinen Bruder beseitigt hat. Es gibt eine Lösung, die wahrscheinlicher ist. – Waren Sie seit Ihrer Flucht nochmals in dem Bungalow Ihres Vaters in Benares?“
„Nein. Was sollte ich dort, Herr Harst?!“
„Nun ja. Sie mögen von Ihrem Standpunkt recht haben, Mylord!“ Er schaute eine Weile nachdenklich vor sich hin und fuhr dann, zu Stannington gewandt, fort:
„Ich bin zu einem Entschluß gelangt. – Schraut und ich sind Ihre Gefangenen. Sie haben uns verschwinden lassen, damit wir nicht störend in das Treiben des Klubs der Zuchthäusler eingreifen. Ich kann das verstehen und trage Ihnen diese Gewaltanwendung nicht weiter nach. Ich würde jedoch mit den Gesetzen in Konflikt geraten, wenn ich über die Geheimnisse von Schloß Friedensburg schweigen wollte, sobald ich meine Freiheit wiedererlangt hätte. Ich mache Ihnen daher folgenden Vorschlag, Stannington. Sie beurlauben Schraut und mich für drei Monate. In dieser Zeit können Sie das, was der Klub noch zur Erreichung seiner Zwecke plant, beschleunigt zu Ende führen. Nach drei Monaten finden wir uns hier wieder ein. Ich will mit Schraut nach Indien, um dort zu ermitteln, was aus den Juwelen des verstorbenen Lords geworden ist. Nach meiner Rückkehr lassen Sie uns beide endgültig frei. Dann werde ich auch vor der englischen Polizei meine Aussage über Blytons Tod zu Protokoll geben. – Einverstanden?“
„Gewiß!“ nickte Stannington.
Horace Wiclaytour aber rief: „Herr Harst, nehmen Sie mich mit nach Indien. Ich könnte Ihnen nützlich sein. Schließlich handelt es sich ja auch um meine Rehabilitierung. Sollten Sie die Vorgänge jener Nacht in Benares restlos aufklären, so werde ich mich den Gerichten stellen, und Vincent Saalborg wird seine Millionenbeute herausgeben, die er bei verschiedenen Banken deponiert hat.“
„Gut, begleiten Sie uns, Mylord. Über die Rolle, die Sie spielen sollen, sprechen wir nachher. – Noch eins, Stannington,“ wandte er sich an den englischen Detektiv. „Sie dürfen niemand mehr gewaltsam aus dem Zuchthaus befreien. Das muß ich unbedingt verlangen.“
Stannington verbeugte sich. „Die Leute, die wir befreien wollten, sind befreit, Herr Harst. Es handelt sich lediglich noch darum, für sieben von uns beweiskräftiges Entlastungsmaterial zu beschaffen.“
„Danke. Das genügt mir. – Wir werden abends Schloß Friedensburg verlassen. Ich werde noch drei Tage bei meiner Mutter in Berlin bleiben. Am 5. Januar, Mylord, treffen wir uns in Brindisi auf dem Bahnhof. Wie wär’s, wenn Sie als mein Diener mit uns reisen? Schraut und ich werden als reiche deutsche Touristen auftreten.“
„Ich hätte Ihnen den gleichen Vorschlag gemacht,“ meinte Wiclaytour. „Ich werde ein älterer, sehr würdiger Diener sein.“
– – – – – – – –
Am 20. Januar stiegen im Prinz Edward-Hotel in Benares die beiden Herren Müller, zwei Brüder aus Berlin, mit ihrem Diener Karl Schneider ab.
Wir hatten unser Äußeres nur etwas verändert. Es gab in Benares nur sehr wenig Leute, die uns von früher her persönlich kannten. – Wir nahmen drei Zimmer im Hochparterre des Seitenflügels nach dem Hotelpark zu. Eins diente uns als Wohnraum, im zweiten schliefen wir, im dritten war unser Diener untergebracht.
Wir waren morgens eingetroffen. Nach dem Frühstück gingen wir drei nach der Roudlandstraße[5] im Europäerviertel, in der der Bungalow des ermordeten Lords lag. – Lord Horace trug als Diener einen ähnlichen Sportanzug wie wir.
Bevor wir noch die Roudlandstraße erreicht hatten, geschah etwas, das uns dreien sehr zu denken gab: zwei Inderinnen mit Gesichtstüchern, also Mohammedanerinnen, waren uns vom Hotel aus gefolgt!
Harst erklärte nach einer Weile: „Es gibt eine Möglichkeit, die Anwesenheit dieser beiden Spione zu deuten. Ich möchte diese Möglichkeit jedoch nicht gern aussprechen. Sie enthält eine schwere Verdächtigung. – Übrigens sind die beiden Frauen jetzt verschwunden. Wir wollen rasch ein vorüberkommendes Auto besteigen und auf Umwegen die Roudlandstraße besuchen.“
So geschah es auch. Wir stellten fest, daß jetzt niemand hinter uns her war. In der Roudlandstraße ließen wir das Auto warten. Wiclaytour mußte im Wagen bleiben. Wir beide gingen die Straße weiter hinunter und läuteten dann an der Mauerpforte von Nr. 12.
Über dem Knopf der elektrischen Glocke war ein Messingschild angebracht:
I. Blackfellow.
Ein eingeborener Diener erschien, öffnete die Gitterpforte und fragte nach unseren Wünschen.
„Wir möchten Master Blackfellow sprechen,“ erklärte Harst.
Der Inder blickte uns überrascht an.
„Master Blackfellow? – Die Dame, die hier wohnt, ist unverheiratet. Sie ist nicht daheim,“ sagte er kurz.
„So gehört der Dame der Bungalow?“
„Nein. – Der Bungalow gehört meinem Herrn Ghori Nawab.“
„Schon lange?“
„Ja – viele Jahre.“
„Dann melde uns Deinem Herrn.“
„Ghori Nawab ist ein Greis und gelähmt. Er empfängt nie Besucher.“
„Sage ihm, daß wir ihn sprechen müßten – in einer sehr wichtigen Angelegenheit.“
Der Diener schloß die Pforte wieder ab, ließ uns draußen stehen und eilte die Allee entlang dem Hause zu.
Harald lächelte mich an. „Der alte Herr hat also einen Teil des Hauses an Miß Izabell Blackfellow vermietet, ihres Zeichens Malerin. Ich wußte, daß „I. Blackfellow“ eine Dame war –“ Er hatte auf das Messingschild gedeutet. „Wenn Du Deine Augen besser gebrauchen würdest, mein Alter, hättest Du es auch gewußt. In der Vorhalle des Hotels hingen eine Menge kleiner Ölskizzen an einer Wand, darüber „Verkäuflich“. Und die recht nett gemalten Tempelmotive waren sämtlich von Iza. Blackfellow, wie in den Ecken zu lesen war, – also Izabell Blackfellow.“
„Weshalb fragtest Du denn nach Master Blackfellow?“
„Weil ich durch die Büsche dort auf der Veranda des Bungalows etwas beobachtet hatte, als Du kaum geläutet hattest. – Nun möchtest Du gern wissen, was! Aber ich werde mich hüten, Deine Unachtsamkeit oder besser Deine behagliche Gleichgültigkeit zu unterstützen! Nur eins merke Dir: wenn Du Dir einbildest, hier in Benares in aller Gefahrlosigkeit Horace Wiclaytours Fall aufklären zu können, so bist Du schief gewickelt – total schief!“
Da kehrte auch schon der Diener zurück, schloß die Pforte wieder auf, ließ uns ein, schloß ab und bat uns, ihm zu folgen.
„Ist Dein Herr völlig gelähmt?“ fragte Harald auf dem Wege zum Bungalow.
„Ja. Er kann sich nur an Krücken fortbewegen.“
„Er bewohnt nur die linke Seite des Hauses, nicht wahr. Rechts wohnt die Malerin.“
„So ist es, Sahib.“
Wir schritten die Verandatreppe empor. Zur Linken saß in einem eleganten fahrbaren Krankenstuhl ein weißbärtiger Inder in einem hellen Anzug von europäischem Schnitt. Über sein Knie war eine Decke gebreitet. Seine Hände ruhten im Schoße.
„Entschuldigen Sie, Master Ghori Nawab, daß wir Sie für ein paar Minuten stören,“ sagte Harald höflich. „Wir sind die Brüder Müller, Kaufleute aus Berlin.“
„Sie sind mir willkommen, meine Herren,“ erwiderte der Greis in gutem Englisch ebenso höflich. „Bitte, nehmen Sie Platz.“
„Master Ghori Nawab,“ begann Harald, „ein Bekannter von uns in Berlin, ein Engländer, hat uns gebeten, diesen Bungalow für ihn käuflich zu erwerben.“
Des Greises Gesicht änderte den Ausdruck. Ich merkte, daß diese Einleitung ihn gespannt aufhorchen ließ.
„Gerade diesen Bungalow?“ fragte er dann.
„Ja.“
„Dürfte ich erfahren, weshalb der Herr gerade auf diesen Besitz Wert legt?“
„Leider kann ich Ihnen hierüber keinen Aufschluß geben,“ erwiderte Harald mit gedämpfter, geheimnisvoller Stimme. „Der Engländer hat uns lediglich den Auftrag erteilt, diesen Bungalow zu erwerben. So vertraut stehen wir doch nicht mit ihm, daß wir ihn geradezu fragen mochten, weshalb er plötzlich wieder nach Indien übersiedeln will, wo er doch jetzt in Berlin eine gute Anstellung hat.“
Der Greis schaute vor sich hin. Dann sagte er ohne besondere Betonung: „Der Herr hat also schon in Benares gewohnt?“
„Ich glaube ja –“
„Wie heißt der Herr?“ fragte der Greis nun.
„Mapserlan –“
„So – Mapserlan. – Der Herr muß diesen Bungalow doch wohl von früher her kennen. Man erwirbt doch kein Grundstück, das man nicht bereits gesehen hat.“
„Gewiß kennt er diesen Besitz,“ nickte Harald. „Mapserlan war mit einem Lord befreundet, dem der Bungalow früher mal gehört hat. Den Namen des Lords habe ich vergessen. Die Sache ist ja von unserer Seite nichts als eine Gefälligkeit Mapserlan gegenüber.“
Ich sah, daß der Inder aufhorchte, als Harst den Lord erwähnte.
„Ja,“ meinte er dann, „Lord Percy Wiclaytour war der Vorbesitzer des Bungalow. Er wurde ermordet.“
„Wie?!“ rief Harald. „Ermordet?! Davon hat Mapserlan nichts gewußt, oder – er hat es uns verschwiegen. Hm – das finde ich etwas merkwürdig. Nicht wahr, Master Ghori Nawab?“
Der Greis hob die Schultern. „Ich kann das kaum beurteilen.“
„Na – es ist ja schließlich auch gleichgültig. – Wollen Sie den Besitz veräußern. Mapserlan bietet 40 000 Rupien.“
Das war ein sehr anständiges Angebot.
„Ich will es mir überlegen,“ erklärte Ghori Nawab. „Vielleicht bemühen Sie sich morgen vormittag wieder her, meine Herren.“
Wir erhoben uns. Der Inder entschuldigte sich, daß er nicht aufstehen könnte. „Ich bin gelähmt,“ meinte er. „Bitte drücken Sie dort auf den Knopf. Mein Diener wird Sie an die Pforte geleiten.“
Der Diener kam. Wir verbeugten uns und gingen.
Als wir auf der Straße waren, sagte Harald leise: „Der Alte ist sehr mit Vorsicht zu behandeln. Er ist nicht gelähmt. Als wir vor der Pforte vorhin Einlaß begehrten, schritt er auf der Veranda auf und ab. Das war’s, was ich beobachtet hatte, und was Dir entgangen war.“
Ich blieb unwillkürlich stehen. „Der Alte ist wohl gar kein Inder, Harald?“ fragte ich rasch.
„Doch, er ist echt. Nur seine Lähmung ist unecht. Wir müssen zu erfahren suchen, was man hier von ihm hält.“
Er schaute nach der Pforte des Nachbarbungalow hin. Dort harkte gerade ein Diener, ein Inder, den Kiesweg. An der Pforte war ein Porzellanschild befestigt:
Pension Walker.
Zimmer mit und ohne Verpflegung.
Wir gingen weiter.
„Nachmittags ziehen wir um,“ meinte Harald. „In die Pension Walker. Meine Theorie über den Fall Wiclaytour ist fertig. Ich glaube nicht, daß sie sich als falsch herausstellen wird. – Ah – was bedeutet das?!“ rief er lebhafter. „Der Lord befindet sich nicht mehr im Auto? – ich sehe ihn auch nirgends in der Straße!“
Er schritt schneller weiter. Dann fragte er den braunen Chauffeur:
„Wo ist unser Diener geblieben?“
„Sahib, es trat ein Dienstmann an das Auto heran und flüsterte mit Eurem Diener. Beide gingen dann nach dorthin die Straße entlang. Mehr weiß ich nicht.“
Wir stiegen ein. – „Zum Prinz Edward-Hotel,“ befahl Harst. – Der offene Wagen ruckte an.
Als wir aus der Roudlandstraße in eine breitere Hauptstraße einbogen, sagte Harald plötzlich:
„Ah – vielleicht Miß Blackfellow –“
Auf dem Promenadenweg kam eine grauhaarige, sonngebräunte, kneiferbewaffnete Europäerin daher. In der Linken trug sie einen riesigen Malkasten, in der Rechten ein zusammengeklapptes Malgestell und ein Klappstühlchen.
Ihre hellen, farblosen Fischaugen richteten sich durchdringend auf unsere Gesichter, als wir vorüberglitten.
„Wenig sympathisch,“ sagte ich kurz.
„Unsympathisch!“ nickte Harald. –
Nun – im Hotel war Wiclaytour nicht, wie uns unten in der Vorhalle schon der Hoteldirektor mitteilte.
„Dann mal zur Polizei,“ meinte Harald leise. „Ich muß die Maske lüften. Detektivinspektor Worbler wird uns nicht verraten. Von Wiclaytour natürlich kein Wort.“
3. Kapitel.
Miß Breeg.
„Worbler, ich möchte Sie zunächst um strengste Diskretion bitten,“ begann Harald. „Dann – wissen Sie genaueres über den alten Inder, der im Bungalow des ermordeten Lord Wiclaytour wohnt?“
„Aha! Also der Fall Wiclaytour!“ lächelte Worbler. „Bin schon im Bilde! Wer hat Sie denn damit beauftragt, bester Harst? – Der Fall ist nichts für Sie; der liegt ganz klar.“
„So?! Ganz klar? – Wo sind denn die Juwelen des Lords geblieben?“
„Dja! Das weiß niemand. Ich nehme an, der Sohn hat sie irgendwo versteckt.“
„Lord Horace? Wie das?!“
„Nun – er hat doch seinen Vater ermordet. – Ein übler Bursche war’s! Zwei Morde in einer Nacht – aus Rachgier! Schade, daß er dem Strange entging! – Also, bester Harst, – wer hat Sie beauftragt?“
„Niemand, lieber Worbler, niemand. Ich las in einer Schilderung besonderer Kriminalfälle die ganze Geschichte – von dem irrsinnigen Lord, der dann ausbrach und den Vater niedergestochen haben soll, ebenso jenen Doktor Edward Bollingray, seinen früheren Erzieher. – Ich glaube nicht an seine Schuld. Ich will Licht in die Sache bringen.“
Worbler blickte Harst scharf an. „Dann haben Sie auch irgendwelche Anhaltspunkte, daß Lord Horace unschuldig ist!“
„Gewiß habe ich die. – Wir wohnen im Prinz Edward-Hotel als Gebrüder Müller nebst unserem Diener. Wir waren vorhin im Bungalow Lord Percys, der jetzt dem Inder Ghori Nawab gehört. Ich pflege mir stets erst den Tatort anzuschauen. Von wem kaufte der Alte den Bungalow?“
„Von der Regierung, die Lord Percys Eigentum mit Beschlag belegt hatte. Erben waren nicht da. So überließ man denn dem alten Manne das Besitztum für 18 000 Rupien.“
„Woher stammt Ghori Nawab?“
„Aus dem Norden – aus Lahore, glaube ich. Genau weiß ich es nicht. Er ist hier recht angesehen, tut viel Gutes und lebt ganz für sich. Jedenfalls ist er über jeden Verdacht erhaben. Er ist gelähmt. – Halten Sie ihn etwa für –“
Harald winkte ab. „Für den Mörder?!“ ergänzte er. „Keine Rede! – Er hat die eine Hälfte des Hauses vermietet. Wer ist jene Izabell Blackfellow?“
Worbler lachte. „Ein richtiges verrücktes Malweibchen.“
„Seit wann wohnt sie bei Ghori Nawab?“
„Hm – vielleicht seit fünf Jahren.“
„Hielt sie sich schon früher in Benares auf?“
„Nein. Sie wohnte in Kalkutta.“
„Wissen Sie das bestimmt?“
„Ja. Bei der letzten Choleraepidemie erkrankte sie. Ich versiegelte ihre Wohnung, bis sie aus dem Lazarett entlassen war. Sie verlangte das. In ihrer Wohnung lagen ihre Papiere auf dem Schreibtisch. Ihr Vater war Hauptmann in der indischen Armee.“
„Würden Sie sich mal mit Kalkutta telephonisch verbinden lassen, Worbler? Fragen Sie bei der dortigen Polizei wegen der Familie des Hauptmanns Blackfellow an.“
Worbler nahm den Hörer vom Tischtelephon und gab der Telephonzentrale der Polizeidirektion die nötigen Befehle unter „sehr dringend“.
Dann wandte er sich wieder an Harst. „Sie scheinen anzunehmen, daß Miß Blackfellow hier unter falscher Flagge segelt?“
„Ja. Das nehme ich an.“
„Wer soll es denn sein?“
„Darüber werde ich später sprechen, lieber Worbler. – Erzählen Sie uns doch mal, was Sie noch über die beiden Morde wissen –“
Worbler hatte ein vorzügliches Gedächtnis und berichte mit allen Einzelheiten. Als er fertig war, meinte Harald:
„Ich finde, Sie haben sich die Arbeit damals ziemlich leicht gemacht, lieber Worbler. Denken Sie, wenn nun Lord Horace gehenkt worden wäre und wenn ich dann wie jetzt bei Ihnen erschienen wäre und Ihnen diesen Ring des alten Lords vorgelegt hätte, den man letztens in Berlin Thomas Bollingray abgenommen hat, dem Bruder des Erziehers.“
Harst hatte den Ring vor Worbler auf den Tisch gelegt.
Worbler starrte das Schmuckstück wie hypnotisiert an.
„Ja – dieser Ring wurde gleichfalls vermißt,“ stammelte er.
„Na also! Und Thomas Bollingray trug ihn in die Weste eingenäht bei sich!“
„Verdammt – die Sache bekommt ein anderes Aussehen, Harst!! –“
Da schrillte das Telephon. Worbler meldete sich.
„Lassen Sie mich heran,“ bat Harst.
Er nannte seinen Namen. „Ich bin hier bei Detektivinspektor Worbler. – So, Hauptmann Blackfellow verstarb vor acht Jahren. Und seine Tochter Izabell? – Wie – starb damals ebenfalls – Beulenpestepidemie? – Hatte Blackfellow noch mehr Töchter? – So – nein! – Wer beerbte ihn denn? – So – so. – Danke. Die Auskunft genügt mir.“
Er legte den Hörer weg und sagte zu Worbler:
„Erbin des Hauptmanns und seiner Tochter war nach der soeben erhaltenen Auskunft Miß Desideria Breeg, Gesellschafterin der Begum von Bhutala.“
„Donnerwetter!“ entfuhr es Worbler. „Ob etwa die Breeg hier die Izabell Blackfellow spielt?“
„Das tut sie! Und das argwöhnte ich sofort. – Wissen Sie auch, weshalb: weil ich, als ich von der Mieterin des alten Inders hörte, mir dachte, die Breeg könnte nur in jenen Bungalow gezogen sein, um dort nach den Juwelen zu suchen! – Es war das so ein Gedanke von mir – so ein blitzartiges Aufzucken eines Verdachts, den ich dann nicht mehr los wurde.“
Worbler schüttelte den Kopf. „Daran hätte ich nie gedacht, nie! Aber – vielleicht haben Sie wieder mal recht, Harst!“
„Hält die falsche Izabell sich Dienerschaft?“
„Ja. Welcher Europäer haust hier ohne Bediente?!“
Harald blickte sinnend zum Fenster hinaus. Dann sagte er: „Worbler, Sie unternehmen nichts in dieser Angelegenheit. Sie überlassen alles uns. Wir werden heute gegen Abend in die Pension Walker übersiedeln – verkleidet. Lassen Sie unsere Koffer vom Bahnhof abholen. Wir reisen zum Schein ab. Ich will ihnen nämlich verraten, daß man uns hier bereits beobachtet – zwei Inderinnen mit Gesichtstüchern waren hinter uns her. Die Sache sieht mir sehr nach einem gefährlichen Wespennest aus. – Wir werden uns hier bei Ihnen verkleiden, Worbler. Um sechs Uhr sind wir hier. Auf Wiedersehen.“ –
Als wir ins Hotel kamen, war unser „Diener“ noch nicht da.
Harald und ich setzten uns in den Speisesaal und bestellten das Diner.
„Die Geschichte gefällt mir gar nicht,“ meinte er nach einer Weile. „Man kann Horace in eine Falle gelockt haben –“
„Wer aber?! Und weshalb?!“
„Bitte – die Desideria Breeg mag, gerade weil sie Malerin ist, ein vorzügliches Personengedächtnis haben.“
Der Direktor ging gerade vorüber.
„Einen Moment,“ winkte Harst. „Besitzt Miß Blackfellow vielleicht ein Segelboot?“
„Jawohl, Mr. Müller. Ein Boot und einen Motorkutter.“
„Kommen Sie näher. – Ich möchte Ihnen anvertrauen, daß wir nicht Müller, sondern Harst und Schraut heißen. – Im Namen Inspektor Worblers warne ich Sie, dies irgend jemandem zu verraten, genau so, wie Sie darüber zu schweigen haben, daß ich Sie nach Miß Blackfellow ausfragte. – Wissen Sie, wo die Boote der Miß liegen?“
„Im Osten der Stadt in der Mündung des kleinen Flüßchens Bonti.“
„Ist der Motorkutter leicht herauszufinden?“
„Er ist weiß gestrichen, oben hellblauer und schwarzer Strich. Er heißt „Gainsborugh“ nach dem berühmten englischen Maler.“
„Danke. – Also Diskretion!“ –
Wir aßen sehr hastig. Plötzlich murmelte dann Harst etwas vor sich hin, das wie „Verwünschtes Pech!“ klang.
„Was gibt’s?“ fragte ich.
„Sie war hier. – Sie ist soeben durch die zweite Tür verschwunden – nach dem Hotelpark zu.“
Er stand auf. „Vorwärts – wenn sie gesehen hat, wie ich mit dem Direktor flüsterte, wird sie Argwohn geschöpft haben –“ –
Wir nahmen ein Auto und fuhren durch einen Teil des Eingeborenenviertels bis in eine enge Gasse, die auf das Flüßchen Bonti zulief. Harst ließ das Auto warten. Dann mieteten wir ein kleines Boot und ruderten der Mündung des Bonti zu, wobei wir die Ufer mit ihren zahlreichen Anlegestegen scharf musterten. Vor der Mündung wurde der Bonti sehr breit. In dieser seeartigen Ausbuchtung lag ein winziges Inselchen, dessen Ufer durch Pfähle befestigt waren. Auf dem Inselchen stand ein verfallener, kleiner Hindutempel, der mehr einem Schutthaufen glich.
Vom linken Ufer des Bonti kam knatternd ein kleiner, gedeckter Kutter herbei und legte dann an dem Bootssteg des Inselchens an.
„Ihr Kutter!“ sagte Harald.
Ein eingeborener Inder bediente den Kutter. Er vertäute ihn, schloß das Schiebedeck des Motors ab und verschwand im Innern des Tempels.
Wir waren kaum drei Minuten später ebenfalls auf der Insel und folgten dem Motorbootmann. – Der Eingang des Tempels war mit Unkraut und Schlingpflanzen dicht bewachsen. Die Treppe war noch leidlich erhalten. Im Innern herrschte eine trübe Dämmerung.
Wir schalteten unsere Taschenlampen ein. – Mir war’s, als ob mich eine Stimme warnte. Aber Harald hatte bereits die Mitte der Tempelhalle erreicht. Im Hintergrunde stand eine riesige Statue des Gottes Brahma, scheußlich bunt bemalt. Davor hockten zwei Leute auf den Fliesen des Bodens: der Motorbootmann und ein – ja – ein nackter, schmieriger, zotteliger, armloser Fakir, beide scheinbar tot für die Außenwelt, beide in tiefster Entrücktheit.
„Der Fakir!“ flüsterte ich Harald zu. –
Wir standen nebeneinander drei Schritt hinter den beiden Andächtigen.
4. Kapitel.
Der Fakir.
Der dumpfe Modergeruch der Halle legte sich mir beklemmend auf die Brust. Ich zupfte Harst am Ärmel. Er regte sich nicht, sagte dann plötzlich ganz laut:
„Shara Dragi!“
Der Yogi drehte sich langsam wie ein Träumender nach uns um.
Der Lichtkegel meiner Lampe fiel auf sein Gesicht, das durch die Haarzotteln halb verdeckt wurde.
Auf dem Gesicht des Fakirs erschien ein grausames Lächeln.
„Wenn Ihr leben bleiben wollt, rührt Euch nicht von der Stelle!“ sagte er dumpf. „Schaut neben Euch!“
Alles Blut verließ meine Wangen.
Neben meiner rechten Hüfte zappelte wütend eine in einen langen Stock eingeklemmte Kobra! Die Brillenschlange hatte ihre Haube vor Wut aufgebläht.
Den Stock mußte ein Mensch halten, der sich hinter uns befand.
Und – ein Blick nach Harst hinüber zeigte mir genau dieselbe höllische Überraschung: eine zweite Kobra, auch in einen oben aufgespaltenen Stock eingeklemmt!
„Wer seid Ihr?“ fragte der Fakir nun. „Ich warne Euch vor der kleinsten Lüge! Sobald Euer Mund die Unwahrheit spricht, lasse ich Euch beißen! Außerdem werdet Ihr von hinten niedergeschlagen!“
Harald schwieg ein paar Sekunden. Dann – dann kam für mich die neue Überraschung:
„Master Ghori Nawab,“ sagte er völlig ruhig, „Sie verkennen die Sachlage!“
Ghori Nawab?! Der Gelähmte?!
Ja – er war’s! Er konnte sein Erschrecken nicht verbergen. Er war zusammengezuckt; sein Gesicht verzerrte sich vor Ingrimm.
Dann sprang er auf, trat näher auf Harst zu.
„Wer bist Du?“ rief er. „Lüge nicht!“
Auch der Bootsmann hatte sich erhoben, hatte jetzt einen kleinen Revolver in der Hand, eine sehr zierliche Waffe, richtete sie auf Harst und regte sich nicht mehr.
„Schicke die Leute hinaus, Ghori Nawab,“ erwiderte Harald. „Es ist besser für Dich und einen, der noch lebt und dessen Freund Du warst –“
Der Fakir warf die Haarzotteln nach hinten. Jetzt erkannte ich ihn. Der Bart war durch Asche schmierig grau gefärbt, ebenso das Haupthaar. Die Zotteln waren nur eingeflochten. – Sein Gesicht ward anders – neugierig, unsicher.
„Die Krokodile des Ganges haben Deinen jungen Freund nicht verzehrt,“ fügte Harald hinzu. „Du hast dies stets gehofft. Es wird jetzt alles klar werden. Beuge den Kopf vor, – ich werde Dir etwas zuflüstern!“
Doch – der Alte war noch immer mißtrauisch. „Sprich laut,“ meinte er. „Meine Diener dürfen alles hören.“
„Sind es alles Deine Diener?“
„Ja. Nur der da nicht!“ Er blickte auf den braunen Motorbootführer.
„Gut – also nur einer! – Kennst Du den Namen Harald Harst, Ghori Nawab? – Du nickst. – Ich bin Harst. Und Horace Wiclaytour ist mit mir und meinem Freunde Schraut nach Indien gekommen, um –“
„Du lügst!“ fuhr der Alte auf. „Du lügst! Einer, der zum Tode verurteilt wurde, wird es nicht wagen, sich Dir anzuvertrauen! Du willst hier –“ Er zögerte.
„Nun – was will ich denn?“
Der Fakir machte eine herrische Kopfbewegung.
„Ihr werdet Euch jetzt binden lassen!“ sagte er finster. „Wagt keinen Widerstand. – Hinter Euch stehen fünf Leute. Und die Schlangen sind –“
Er kam nicht weiter.
Harst hatte einen Satz vorwärts gemacht.
Der Bootsmann schoß. Aber sein Arm war durch einen Faustschlag hochgeschnellt. Dieselbe Faust traf ihn unter das Kinn; er flog nach hinten.
Harald hatte schon den Fakir gepackt. Ich selbst war ebenso rasch zur Seite gesprungen, hatte den Mehrlader aus der Jackentasche gerissen.
Nur zwei Inder standen uns als Gegner gegenüber. Sie hielten noch die langen Stöcke in der Hand; sie waren so verblüfft, daß sie sich erst regten, als Harst befahl:
„Legt die Stöcke hin! Sofort!“
Er hatte den Fakir mit der Linken umklammert. Der Alte stieß mit den Beinen nach ihm. Haralds Clementpistole drohte den beiden Dienern.
Sie gehorchten. – Hätten sie nicht gehorcht – mein Finger lag am Abzug. Ich hätte geschossen. –
Harst gab den Alten frei, sagte ruhig:
„Ghori Nawab, Du bist ein Narr! Schicke Deine Diener hinaus. Hast Du schon je gehört, daß Harald Harst die Ungerechtigkeit verteidigt?!“
Der Alte winkte den Dienern mit dem Kopfe zu. Sie verließen die Tempelhalle.
„So,“ meinte Harst, „nun wollen wir Klarheit schaffen, Ghori Nawab. – Weißt Du, wer in Deinem Hause wohnt, wer die Malerin Izabell Blackfellow in Wirklichkeit ist?! Kanntest Du die Gesellschafterin der Begum von Bhutala von Ansehen?“
Der Fakir, von meiner Taschenlampe hell beschienen, blickte Harald fragend an. Er überlegte, sagte:
„Ich kannte Miß Breeg, gewiß! Ich sah sie aber in Bhutala stets nur verschleiert. Die Damen gingen dort nie ohne Schleier aus, und ins Schloß der Begum kam ich selten.“
„Nun – Desideria Breeg, die Verbündete der Brüder Bollingray, wohnt seit Jahren bei Dir unter dem Namen einer in Kalkutta verstorbenen Verwandten. Das habe ich heute festgestellt. Sie weiß und wußte, wer Du bist – eben der Yogi Shara Dragi, der Freund Lord Horace Wiclaytours. In Deinem Bungalow vermutete sie die Juwelen Lord Percys, die bis heute verschwunden sind.“
Der Alte hielt seine klugen, ernsten Augen unverwandt auf Harsts Gesicht gerichtet. – Minutenlang blieb er still. Er dachte offenbar nach. Es schien ihm Mühe zu kosten, Klarheit in seine Gedanken zu bringen.
Dann nickte er sinnend, murmelte: „Sie wird mich belogen haben! Die Wahrheit ist hier zu suchen!“ Und lauter fügte er hinzu:
„Ich glaube Ihnen, Master Harst. Das Weib hat mich heute sehr schlau hintergangen. Ich will Ihnen alles mitteilen. – Vorher nur eine Frage: Lebt Horace Wiclaytour wirklich noch? – Gewiß, ich habe es im stillen stets gehofft. Mein Herz hing an ihm. Er war als Knabe und herangewachsener Jüngling so unendlich zu bedauern.“ –
Der braune Bootsmann, den Harst niedergeboxt hatte, regte sich und suchte sich aufzurichten.
Der Fakir warf einen finsteren Blick auf ihn und bat uns, den Menschen zu fesseln. – „Er ist dem Weibe treu ergeben, Mr. Harst, – zu treu!“ erklärte er. – Wir banden dem Inder die Hände auf dem Rücken zusammen. Dann erwiderte Harald auf des Alten Frage:
„Sie können beruhigt sein, Ghori Nawab: Der Lord lebt! – Aber ich glaube, Desideria Breeg hat ihn irgendwo in eine Falle gelockt. Er ist seit vier Stunden verschwunden.“
„Das würde ganz zu den Lügen passen, mit denen sie mich heute umgarnt hat,“ meinte der Fakir in seiner bedächtigen Art. „Nun – wir werden ihn finden!“ Wieder schaute er den Bootsmann durchdringend an und fügte hinzu: „Matana, Dein Auge weicht dem meinen aus. Wo ist der weiße Sahib geblieben. Lüge nicht! Du weißt, wer ich bin! Du bist ein Sandkorn, das ich jede[6] Sekunde in den Abgrund des Nichts blasen kann!“
Matana senkte den Kopf. Ein Zittern lief über seinen Leib hin. Dann stieß er hervor: „Ich weiß es nicht, großer Ghori! Ich weiß es nicht! Ich war’s, der den Sahib vom Auto weg auf den Kutter lockte, indem ich ihm sagen mußte, Sahib Harst erwarte ihn dort. Er wurde nicht argwöhnisch. Auf dem Kutter haben wir drei Diener der Mem Sahib (Dame, Frau) Blackfellow ihn gefesselt und in ein Ruderboot gelegt, in dem die Mem Sahib allein saß. Er wurde mit Decken zugedeckt, und die Mem Sahib fuhr davon. Es ist die Wahrheit.“
Harst winkte dem Fakir jetzt zu. „Gehen wir mehr nach dem Eingang hin, damit Matana uns nicht belauschen kann. Wenn er seiner Herrin so treu ergeben ist, möchte ich vorsichtig sein –“
Wir setzten uns hier auf ein paar Mauerblöcke. Und der Fakir begann: „Mr. Harst, ich bin ein sehr alter Mann, vielleicht älter, als Sie denken. Ich habe unendlich viel erlebt und durchgemacht. Ich hatte eine Familie; ich war glücklich. Die Cholera nahm mein Glück dahin – alles! Die Götter werden wissen, weshalb sie mir diese Prüfung auferlegten. – Ich war einsam. Und wollte noch einsamer werden. So zog ich in die Windhya-Berge nördlich der Residenz Bhutala. Und dann – dann schloß sich der Knabe, der Sohn Lord Wiclaytours an mich an; da wurde das Kind mir ein Trost. Was noch an Zärtlichkeit in mir aufzuglühen vermochte, schenkte ich dem Knaben. Er vergalt mir Gleiches mit Gleichem. Er wurde ein Jüngling; er war ein Gefangener –“
Ghori Nawab schwieg ein paar Sekunden. Seine dunklen Augen hatten einen schwärmerischen Glanz angenommen. Noch mehr als vormittags, als ich ihn auf seiner Veranda nicht als den verkrüppelten Yogi, sondern als den gelähmten Besitzer eines hübschen Bungalows kennengelernt hatte, fiel mir der edle Schnitt seines Gesichts auf. –
„Ich hätte ihn befreien können,“ fuhr er mit demselben würdevollen Ernst auf. „Aber – er war in der Anstalt als scheinbarer Geisteskranker sicherer. Dann kam jene Nacht, in der sein Vater ermordet wurde. In jener Nacht hatte ich den Bungalow Lord Wiclaytours wie ein treuer Hund, der eine Gefahr wittert, umschlichen. Ich wurde Zeuge, wie jener Thomas Bollingray den alten Lord ermordete. Ich konnte den Todesstreich nicht mehr abwenden. Ich sah, wie die beiden Brüder aus einem geheimen Wandfach des Zimmers einen Kasten raubten; ich sah, wie sie der Mauer des Nachbargartens zuflohen. Und – mit den Zehen zog ich meinen Dolch unter dem Lendenschurz hervor, nahm den Griff in den Mund. So trat ich den beiden entgegen – so sprang ich zu, als Doktor Bollingray mich niederstechen wollte. Ich überrannte ihn. Meine Waffe fand sein Herz. Mit einem Schrei stürzte er zu Boden. Der schmale Kasten entsank seiner Hand. Thomas Bollingray wollte ihn aufraffen. Ich drängte ihn zurück. Sein Messer traf mich. In demselben Augenblick ertönten die Hilferufe der Diener des alten Lords, und Bollingray floh. Er war ein Feigling. – Ich selbst schleppte mich weiter, nahm den Kasten mit, fand Unterschlupf bei einem Freunde, der mich erst nach Monaten gesund gepflegt hat. Ich lag die ganze Zeit über in schwerem Fieber. Und als ich genesen, war Horace Wiclaytour längst von den Gangeskrokodilen getötet, wie man allgemein annahm. Ich konnte nicht an seinen Tod glauben. Und weil ich hoffte, daß er einst an den Ort zurückkehren könnte, wo –“
„– Wo sein Vater durch Mörderhand gefallen,“ ergänzte Harald leise, „deshalb kauften Sie den Bungalow, Ghori Nawab, deshalb bewahrten Sie für den jungen Lord die Juwelen des Vaters auf, die jener Kasten enthalten hatte. – Ich habe mir dies sofort gedacht, als der junge Lord uns seine Leidensgeschichte erzählt hatte. Ich rechnete damit, daß ich den Fakir Shara Dragi, eben Sie, hier in Benares und in der Nähe des Bungalow antreffen würde. Ich ahnte, daß Sie die Juwelen für den Sohn und Erben hüteten. Sie haben den Kasten irgendwo in Ihrem Hause jetzt verborgen. Und dieses Versteck wollte Desideria Breeg ermitteln. Geduldig hat sie alle diese Jahre als Ihre Mieterin dieses Ziel im Auge gehabt. Dann erkannte sie heute früh im Hotel in unserem Diener Karl den jungen Lord. Sogleich faßte sie den Entschluß, ihn verschwinden zu lassen, denn sie wußte ja, daß Sie ihm die Juwelen aushändigen würden. – So, Ghori Nawab, – nun erzählen Sie uns von dem heutigen Ränkespiel dieses Weibes.“
5. Kapitel.
Die Juwelen.
„Ich will nicht viele Worte machen, Mr. Harst. Sie werden sich das selbst ergänzen können, was ich nur andeute,“ sprach der Yogi. „Die Zeit drängt. Wir müssen Horace suchen. Ich bange um sein Leben. – Das Weib kehrte heute heim, war sehr erregt, berichtete mir, sie hätte im Hotel morgens zwei Detektive belauscht, die sich darüber unterhielten, daß sie die verschwundenen Juwelen Lord Percy Wiclaytours hier in Benares bei einem Inder namens Ghori Nawab wiederzufinden hofften und daß sie im Auftrage eines gewissen Thomas Bollingray handelten. – Ich verriet mich dem Weibe gegenüber nicht, blieb scheinbar ruhig. Aber eine gewisse Angst ließ mich doch noch einige Fragen an Desideria Breeg richten. – Sie spielte die um meine Sicherheit Besorgte, sagte plötzlich: „Ghori Nawab, mir ist seit langem bekannt, daß ihre Arme nur künstlich sind, daß die Handschuhe nur die Wachshände verbergen sollen. Sie sind armlos – Sie sind jener Fakir Shara Dragi, der damals von der Polizei gesucht wurde. Haben Sie Vertrauen zu mir. Ich will Ihnen helfen, die beiden Detektive unschädlich zu machen. Wir werden die beiden zu einem Schwur zwingen, daß sie Indien wieder verlassen.“ – So betrog und belog dieses Weib mich! Ich glaubte ihr. Vorher waren ja tatsächlich zwei Europäer bei mir gewesen, die angeblich den Bungalow kaufen wollten – eben Sie beide! – Meine Diener mußten das Hotel bewachen. Einer hörte, wie Sie dem Chauffeur befahlen, nach der Flußmündung zu fahren. Wir erreichten das andere Ufer auf einem kürzeren Wege mit einem Wagen. Miß Breegs Diener Matana, der dabei war, schlug vor, Sie durch das Motorboot – daß Sie dieses suchten, mußte ich wohl annehmen – hier nach dem verlassenen Tempel zu locken. – So, Mr. Harst, nun wissen Sie alles; nun wollen wir Horace Wiclaytour suchen.“ – Er war aufgestanden. – Wie sehr mußte dieser Greis den jungen Lord lieben! Wie dankbar mußte er noch heute dem einstigen Knaben für das Vertrauen sein, das dieser ihm geschenkt hatte!
„Geduld, Ghori Nawab,“ meinte Harald. „Zunächst ein paar Fragen. – Wo befindet sich Desideria Breeg jetzt? Und – was hatten Sie mit ihr für den Fall vereinbart, daß Sie uns in Ihre Gewalt bekämen?“
„Sie ist im Bungalow. Ich sollte ihr dorthin den Bescheid bringen.“
„Gut. Dann kehren Sie mit Ihren Dienern dorthin zurück. – Ist auf Ihre Leute Verlaß? – So – vollständig. – Nun, dann berichten Sie dem Weibe, daß alles geglückt ist und daß Matana uns beide im Motorkutter nach einer der Gangesinseln östlich von Benares geschafft hat und uns dort bewacht. – Hören Sie weiter, Ghori Nawab. Das Weib hofft, daß Sie in der kommenden Nacht die Juwelen aus dem Versteck hervorholen und anderswo außerhalb des Bungalow verbergen werden. Nur um Sie hierzu zu bewegen, erzählte sie Ihnen von den beiden Beauftragten Bollingrays. Sie will Ihnen eben die Juwelen rauben, sobald Sie in der Nacht damit aus dem Bungalow schleichen. Glauben Sie mir – es ist so! – Wir aber werden – denn Sie müssen tatsächlich zum Schein die Juwelen wegschaffen – das Weib in demselben Augenblick ergreifen, wo sie schon am Ziele ihrer heimtückischen Wünsche zu sein hofft.“
Der Fakir nickte. „Ich werde tun, was Sie vorgeschlagen haben. Ich weiß jetzt auch, daß Sie Horace Wiclaytour auch ohne meine Hilfe befreien werden.“ –
Gleich darauf ruderten des Yogi Diener ihren Herrn ans Ufer. – Wir kehrten in die Tempelhalle zu Matana zurück.
„Matana,“ sagte Harst, „ich will Dir die Freiheit schenken, wenn Du mir verrätst, wo Deine Mem Sahib den Mann verborgen hält. Besinne Dich! Hat sie nicht irgend eine Äußerung getan, aus der Du schließen kannst, was sie mit dem Manne beabsichtigte? – Ich werde Dir dann hundert Rupien schenken, damit Du Benares sofort verlassen kannst.“
„Sahib,“ meinte der Diener ängstlich, „die Mem Sahib sprach nur davon, daß sie den Mann dorthin bringen würde, wo er schon einmal gewesen und wo niemand ihn dann befreien könnte.“
Harald stieß ein leises: „Ah – diese Teufelin!“ aus, nahm Matana die Fesseln ab, gab ihm das Geld und sagte: „Flieh’, bevor die Polizei Dich greift! Rudere über den Fluß und betritt Benares nie wieder!“
Matana stammelte ein paar Worte des Dankes und eilte davon, sprang in die trübe Flut und schwamm zu einem Anlegesteg, kettete ein Boot los und ruderte von dannen.
„Zu Worbler!“ rief Harald. „Frage nicht! Hinein in den Kutter.“ –
Wir fuhren im Auto vor dem Polizeigebäude vor. Als wir uns bei Worbler melden ließen, kam er uns in den Flur entgegen.
„Denken Sie, bester Harst, – Lord Horace Wiclaytour ist verhaftet worden! Vor drei Stunden rief mich jemand telephonisch an und meldete, daß Wiclaytour, der Totgeglaubte, in einem Boote am Flußufer gefesselt liege. – Ich zweifelte erst, schickte aber doch drei Beamte hin. Und – sie fanden einen Europäer, der dann hier beim Verhör zugab, der junge Lord zu sein!“ – Er öffnete die Tür seines Dienstzimmers. – Und wir sahen dort Horace Wiclaytour, von zwei Beamten bewacht, am Tische des Detektivinspektors stehen.
Harald trat schnell ein. „Mylord,“ sagte er herzlich, „Ihre Schuldlosigkeit ist erwiesen! Wir haben Ihren Freund Shara Dragi gefunden!“ Dann zu Worbler: „Schicken Sie die beiden Beamten hinaus! Verpflichten Sie sie zum Stillschweigen. Ich will Ihnen die Beweise nennen, daß Horace unschuldig ist.“
Wir drei waren mit dem jungen Lord allein. Harald berichtete, was wir vorhin erlebt hatten. –
„Sie sind frei, Mylord,“ erklärte Worbler dann und streckte ihm die Hand hin.
Horace Wiclaytour übersah die Hand, schüttelte den Kopf, sagte laut:
„Mr. Worbler – gut, der Lord ist frei! Aber nicht der Mann, der als Menschenhasser und -verächter seit Jahren –“
Er wollte sich offenbar selbst als der vielgesuchte Vincent Saalborg den Behörden ausliefern.
„Halt!“ rief Harst da. „Was Sie über Ihren Menschenhaß Worbler angeben wollten, Mylord, geht nur mich etwas an! Über diesen Abschnitt Ihres Lebens rechne ich mit Ihnen ab! – Worbler wird Sie jetzt zum Schein wieder in eine Zelle führen lassen. Die Brüder Bollingray sind tot. Auch das Weib, das mithalf, Ihre Jugend zu vergiften, soll in der kommenden Nacht unschädlich gemacht werden. – Auf Wiedersehen, Mylord! Die Juwelen Ihres Vaters, Ihr rechtmäßiges Erbe, werden Ihnen die Möglichkeit geben, die zu entschädigen, die Sie vielleicht entschädigen wollen!“
Worbler fragte nichts mehr. Er ahnte wohl, daß Horace noch anderes zu sühnen hatte. Aber er mischte sich nicht ein.
Der Lord wurde nach einer Zelle gebracht. Harald verabredete dann mit Worbler, wie nachts mit Hilfe der Polizei Desideria Breeg als Juwelendiebin entlarvt werden sollte. –
Und die Nacht brach herein. – Kurz nach halb zwölf kletterten wir über die Gartenmauer des Bungalow Ghori Nawabs.
Da lagen wir drei – Harst, Worbler und ich – im Schutze einiger Büsche dicht an der Verandatreppe.
Kein Fenster des Bungalow war erleuchtet. Alles war still und ruhig, als ob die Bewohner schliefen. Links von uns in einer Baumkrone schnatterten halb im Schlaf ein paar Affen. Über die Stufen der breiten Verandatreppe huschten ab und zu ein paar große indische Ratten. – Jeder hätte angenommen, daß dort in dem dunkeln Hause unmöglich verbrecherische Pläne der Ausführung harrten.
Die Zeit wurde uns lang. Worbler hatte schon zum vierten Male uns das Leuchtzifferblatt seiner Taschenuhr hingehalten. Es war bereits ein halb eins.
„Wenn das Weib uns nur keinen Streich spielt,“ flüsterte Worbler. „Oder – Sie haben sie gar im falschen Verdacht, und sie –“
„Abwarten!“ beruhigte Harald ihn. „Der Bungalow ist ja nach den Seiten und hinten durch Ihre Leute unter ständiger Beobachtung. Und mein Verdacht –“
„Still – der Alte!“ hauchte Worbler erregt.
Auf der Veranda war Ghori Nawab erschienen. Die helle Tropennacht ließ uns deutlich erkennen, wie er, den Gelähmten spielend, mühsam mit den schlenkernden künstlichen Armen die Treppe herabkam. Auf dem Rücken trug er eine Art Rucksack, in dem sich ein kantiger Gegenstand abzeichnete. – So humpelte er an uns vorüber, blickte nicht rechts, nicht links, er ging tief gebückt, die Augen auf den Boden gerichtet.
Er erreichte die Pforte, stand einen Moment still. – Die Pforte konnte nur angelehnt gewesen sein. Er schien sie mit dem Fuße aufzuschieben. – Wir waren ihm gefolgt, mußten aber, um nicht gesehen zu werden, einen Umweg machen. Als wir nun in der Nähe der Pforte angelangt waren, hatte er bereits die Straße betreten. Harst lachte plötzlich leise auf.
„Da – im Schloß der Pforte steckt noch der Schlüssel von innen,“ meinte er leise. „Das genügt!“
Er war mit ein paar Sprüngen schon hinaus. Wir folgten ihm. Wir ahnten wohl beide dunkel, daß hier etwas Unvorhergesehenes geschehen war.
Harst trat Ghori Nawab in den Weg. Wir hörten seine scharfe, ironische Stimme: „Kehren Sie um – die Geschichte ist mißglückt –“ Und als er das letzte Wort aussprach, umschlang er die Brust des Alten, rief uns zu: „Es ist Miß Desideria Breeg! – Miß Breeg, Ihre Verkleidung verdient Anerkennung! Sie haben nur einen Fehler gemacht: Sie schlossen die Pforte auf und ließen, um schnell wegzukommen, den Schlüssel stecken. Außerdem hätten Sie nicht so gebückt gehen sollen! Auf die Weise verdeckt man nicht, daß man gut einen halben Kopf kleiner als das Original ist!“
Wir hielten das Weib fest. Ihre richtigen Arme hatte sie sehr geschickt unter dem losen Mantel verborgen gehabt. Und als wir den Mantel aufknöpften, fiel ein langer indischer Dolch klirrend zu Boden. –
Wir führten sie in den Bungalow. Sie zitterte vor ohnmächtigem Grimm. Aber sie schwieg. –
In Ghori Nawabs Schlafzimmer fanden wir den Fakir bewußtlos auf. Desideria Breeg hatte ihm, wie sich nachher herausstellte, ein Betäubungsmittel sehr raffiniert beigebracht.
Der Ebenholzkasten in dem Rucksack enthielt die Juwelen des alten Lords. Wir nahmen ihn mit nach der Polizeidirektion, wo Horace Wiclaytour nun seine Zelle verlassen konnte. Die Juwelen beachtete er nicht. Wir eilten zu Ghori Nawabs Bungalow zurück. Horace hatte nur einen Wunsch, – den treuen Fakir wiederzusehen, den ein Arzt inzwischen wieder ins Bewußtsein zurückgerufen hatte. Bei der Wiedersehensszene zwischen den beiden waren wir nicht zugegen. – Als wir dann mit Wiclaytour durch den herandämmernden Morgen dem Hotel zuschritten, sagte Harald zu dem einstigen Gentleman-Hochstapler:
„Mylord, unsere Wette ist nun gegenstandslos geworden. Ich weiß, daß Sie in Zukunft ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft sein werden. Vergessen Sie die Vergangenheit – Ihre Vergangenheit! Ich habe sie bereits vergessen! Ich habe nie einen Vincent Saalborg gekannt!“
Der junge Lord reichte Harald die Hand. Seine Erwiderung jedoch wurde durch einen gellenden Hilferuf übertönt.
Wir befanden uns noch im Europäerviertel. Und wir sahen in einem Fenster eines großen, dicht an der Straße liegenden Bungalow einen Mann im Nachthemd sprungbereit auf dem Fensterkopf stehen. –
So begann für uns unser nächstes Abenteuer: Lord Ralleys Schreckensnächte!
Nächster Band:
Lord Ralleys Schreckensnächte.
Verlagswerbung:
|
Der Detektiv Eine Reihe höchst spannender Detektivabenteuer. Bisher sind folgende Bände erschienen: |
|||||
|
Band |
108: |
Die Motorjacht ohne Namen. |
|||
|
– Preis pro Band 20 Pf. – Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin SO 26, Elisabeth-Ufer 44. |
|||||
Anmerkungen:
- ↑ In der Vorlage steht: „nicht“.
- ↑ In der Vorlage steht: „Tische“.
- ↑ In der Vorlage steht: „Scotland York“.
- ↑ In der Vorlage steht: „meinem“.
- ↑ „Roudlandstraße“ / „Roudland-Straße“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Roudlandstraße“ geändert.
- ↑ In der Vorlage steht: „jeder“.
