Hauptmenü
Sie sind hier
Das Erbbegräbnis
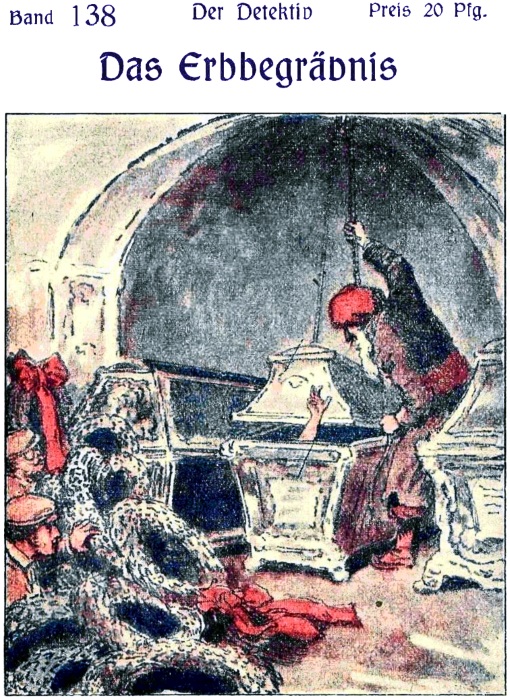
Der Detektiv
Kriminalerzählungen
von
Walther Kabel.
Band 138:
Das Erbbegräbnis.
Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.
Berlin 26, Elisabeth-Ufer 44
Nachdruck verboten. – Alle Rechte, einschl. das Verfilmungsrecht, vorbehalten. – Copyright 1925 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.
Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.
1. Kapitel.
Graf Antonio Rapsoldi und der Likör.
Graf Rapsoldi, der Gouverneur der portugiesisch-indischen Kolonie Goa, führte uns nach dem Abendessen in das Rauchzimmer und schickte den aufwartenden Diener hinaus.
Rapsoldi war ein älterer vornehm aussehender Herr, dessen kleine schlanke Gestalt sich die straffe Haltung des früheren Militärs bewahrt.
Wir als seine Gäste wußten bereits, daß der Graf ursprünglich Oberst eines Kavallerieregiments in seiner Heimat gewesen und daß nur besondere Umstände ihn bewogen hatten, zur Kolonialverwaltung überzugehen. Welcher Art diese Umstände jedoch gewesen, hatte er nicht näher erklärt.
Harald Harst und ich hatten neben einem kleinen Rauchtischchen in bequemen weichen Klubsesseln Platz genommen.
Der Graf brachte Likör, Zigarren und Zigaretten herbei und baute all die Herrlichkeiten mit einer liebenswürdigen Bemerkung vor uns auf.
Und doch lag auf seinem tiefgebräunten Gesicht ein sinnender Ausdruck, etwas wie Geistesabwesenheit, die er nicht ganz zu verhehlen vermochte.
Er setzte sich nun gleichfalls, füllte die geschliffenen Likörkelche und hob sein Glas gegen uns.
„Ihre Gesundheit und langes Leben, Sennores!“ sagte er mit leicht erzwungener Heiterkeit.
Wir tranken.
„Ein vorzüglicher Likör,“ meinte Harald anerkennend und nahm die betreffende Flasche, um das Firmenschild zu prüfen.
Auch ich schaute hin. Der Likör hatte einen ganz eigentümlich aromatischen Geschmack.
Da sagte Rapsoldi schon:
„Für einen Likör ein sonderbarer Name, dieses … Erbbegräbnis … – Nicht wahr?“
„Allerdings,“ nickte Harald.
„Der Likör ist auch ein – Familiengeheimnis,“ erklärte der Graf merkwürdig ernst. „Ich beziehe ihn von dem Verwalter unseres Schlosses am Fuße des Dodabetta, von dem alten Guiseppe …“
„Freilich, das Schildchen ist mit Rundschrift geschrieben,“ meinte Harst. „Und die Aufschrift ist eigenartig genug:
Erbbegräbnis.
Dodabetta, den 15. Juni.
Weshalb dieses Datum, Exzellenz?“
Rapsoldi nahm eine Zigarre, schnitt umständlich die Spitze ab …
„Es ist der Todestag meines Vaters, Sennor Harst!“
„So?! Und – wie hängt dieser Tag mit dem Likör zusammen?“
„Sehr eng: mein Vater verschwand am 15. Juni spurlos, als er aus den Weinkellern der alten indischen Burg eine Flasche dieses Likörs hatte holen wollen …“
Unwillkürlich blickten Harald und ich den Grafen fragend an. Seine Sätze waren denn doch zu widerspruchsvoll gewesen.
Er fuhr bereits fort:
„Ich hatte ohnedies die Absicht, Ihnen beiden, Sennores – gerade Ihnen beiden diesen Teil unserer Familiengeschichte zu erzählen. Ich glaube, diese Vorfälle damals dürften Sie interessieren, zumal seinerzeit die berühmtesten Londoner Detektive, die damals für unerreicht galten, sich mit dem „Fall des Grafen Antonio Rapsoldi“, und das war mein Vater, beschäftigt haben.“
Er rückte seinen Sessel näher an das Tischchen heran, rauchte ein paar Züge und begann:
„Ihnen ist bekannt, Sennores, daß Portugal einst hier in Indien weite Kolonialgebiete besaß. Im Jahre 1712 erwarb einer meiner Vorväter, damals Generalgouverneur von Indien, von der Rani von Dodabetta die alte Fürstenburg auf den Westabhängen dieses höchsten Berges Südvorderindiens. Der Berg, das Fürstentum und die Burg führten denselben Namen: Dodabetta. – Das uralte Schloß und der Berg heißen noch heute so. Das Fürstentum ist von den Engländern eingezogen worden. Im Jahre 1832 mußte die letzte Rani von Dodabetta nach einem vergeblichen blutigen Aufstand gegen die Engländer fliehen. Sie ist verschollen – samt ihren Kindern …“
Harald beugte sich vor …
„Verzeihung, Exzellenz, – ich habe einmal in einem sehr umfangreichen Werk über Indien von dem tragischen Geschick dieser letzten Rani von Dodabetta einiges gelesen. Sie hieß Balatavi, und sie war mit einem Europäer vermählt, einem – Portugiesen …“
„Ganz recht, mit einem Landsmann von mir, der schon vor der Flucht seiner Gattin starb. Im übrigen sind diese Einzelheiten für meine Geschichte nicht von Belang. – Jedenfalls: seit 1712 ist die Dodabetta-Burg, die kaum den Namen Schloß verdient, Familienbesitz, bis heute, samt großen Ländereien. Wir haben stets von diesem Besitz erhebliche Einkünfte gehabt, da auch zwei Zinngruben dazu gehören. – Ich will mich nun kürzer fassen, weil wir uns sonst zu sehr in nebensächlichen Dingen verlieren …“
Er stand auf und holte aus einem Schranke ein kleines Buch, blätterte darin und erklärte:
„Ich habe hier die wichtigsten Vorgänge und Daten zusammengestellt. Ich will Ihnen vorlesen, was ich dergestalt übersichtlich geordnet habe. – Mein Vater, der nach meiner Geburt Witwer wurde – ich bin das einzige Kind –, wollte im Jahre 1890 sich einmal persönlich um seine indischen Besitzungen kümmern und reiste nach Dodabetta. Ich war damals 27 Jahre alt und Offizier in Lissabon. Die Verwaltung Dodabettas hatte zu jener Zeit der alte Guiseppe Vandoni unter sich, der Vater des jetzigen, nun ebenfalls schon „alten“ Guiseppe. Dieser erste Guiseppe war ein harmloser Giftmischer, das heißt er braute Liköre. So hatte er denn auch diesen Prachtlikör hier „erfunden“, hielt das Rezept aber streng geheim und vererbte es nur auf seinen Sohn, den jetzigen Verwalter. – Als mein Vater Antonio etwa vierzehn Tage in der Burg weilte und als er eines Nachts, erschöpft von der Durchsicht der Rechnungen und sonstigen Papiere der ausgedehnten Ländereien und der beiden Zinngruben, Durst nach einem „Erbbegräbnis“ verspürte, da –“
„Eine Zwischenfrage, Exzellenz … Wer hatte dem Likör denn diesen eigentümlichen Namen gegeben?“
„Der erste Guiseppe, der Erfinder … Und zwar deshalb, weil er dadurch zum Ausdruck bringen wollte, daß das Rezept gerade dieses Likörs in seinem Hirn für alle Zeiten begraben sein sollte. – Es war ein schnurriger Kauz, dieser Giftmischer … Wenn er nachher dennoch seinem Sohne das Rezept hinterließ, so mag er lediglich aus Anhänglichkeit gegen seinen Herrn – und das war ich inzwischen geworden – so gehandelt haben. – Also mein Vater wollte zur Auffrischung einen Likör trinken, fand die Flasche aber leer und läutete nach seinem Kammerdiener, der ebenfalls Portugiese war. Der Diener erschien, und mein Vater befahl ihm, in den Weinkeller hinabzugehen. Seltsamerweise machte der Diener Ausflüchte. Nachher hat er zugegeben, daß er von den anderen eingeborenen Dienern allerlei Spukgeschichten über die Kellergewölbe gehört und sich – gefürchtet habe. Mein Vater merkte, daß der Diener Angst hatte, ließ sich eine Laterne bringen und stieg selbst die steinernen Treppen hinab …“
Harald war jetzt weit lebhafter geworden. Seine Augen ruhten gespannt auf des Grafen vornehmem Gesicht.
„Und von diesem Gang in den Weinkeller kehrte Ihr Vater nicht zurück?“ fragte er leise.
Der Gouverneur nickte.
„Niemand hat ihn seitdem gesehen … Der Diener war der letzte, der ihn sah. Auch er ist längst tot. Und von jenem Tage an, es war der 15. Juni 1890, rechne ich meinen Vater nicht mehr zu den Lebenden …“
„Der Diener schlug also Lärm, als sein Herr nicht wiederkehrte?“
„Ja. Er weckte den alten Guiseppe. Und der wieder weckte den Sekretär meines Vaters. Sie gingen in die Gewölbe hinab und fanden nichts – nichts! – Am nächsten Tage depeschierten sie mir nach Lissabon den Sachverhalt, hatten auch schon die Polizei in der nächsten größeren Stadt, in Bangalore, benachrichtigt. Auf meine Veranlassung begleiteten mich zwei Londoner Detektive nach Indien. Auch sie hatten keinen Erfolg. Nach einem halben Jahr reiste ich wieder nach Lissabon und nahm meinen Dienst als Offizier wieder auf. Zehn Jahre verstrichen. Ich war inzwischen rasch avanciert und Oberst geworden. Da erhielt ich aus Indien einen anonymen Brief des Inhalts, daß mein Vater lebe und unweit der Burg Dodabetta in einem verlassenen Bergwerk gefangengehalten würde. – Weiter stand nichts in diesem merkwürdigen Schreiben. Ich schenkte ihm zunächst keinerlei Beachtung. Dann aber träumte ich fast jede Nacht von meinem Vater. Meine Nerven litten darunter. Eine beständige innere Unruhe quälte mich. Ich nahm meinen Abschied und bat um Anstellung im Kolonialdienst. So schickte mich die Regierung nach Kolombo auf Ceylon als Generalkonsul. Bevor ich dort meinen Dienst antrat, fuhr ich nach Dodabetta. Der alte Guiseppe Vandoni war seit Jahren verstorben. Sein Sohn verwaltete meine Besitzungen. Ich zeigte ihm den anonymen Brief, und wir beide haben in aller Stille das verlassene Bergwerk durchsucht und …“
„… natürlich nichts gefunden,“ ergänzte Harald.
„Nein, nichts. Man hatte mich eben genarrt. – Ich begab mich nach Kolombo, und von dort kam ich vor drei Jahren hierher nach Goa als Gouverneur.“
„Sie möchten das Verschwinden Ihres Vaters gern aufgeklärt haben, Exzellenz …“
„Sehr gern. Und wenn ich Sie beide bitten dürfte, mich übermorgen nach Dodabetta zu begleiten, so würden Sie mich sehr zu Dank verpflichten. Ich werde eben das Gefühl nicht los, daß mein Vater einem heimtückischen Verbrechen zum Opfer gefallen ist …“
„Wie urteilten denn damals die Londoner Detektive über den Fall?“
„Sie – urteilten gar nicht. Die Sache war eben so vollkommen dunkel, daß eine Vermutung nur leeres Gerede gewesen wäre …“
„Und weshalb fügt Guiseppe jetzt auf diesen Flaschenetiketten noch das Datum jener Unglücksnacht hinzu?“
„Auch aus Anhänglichkeit an uns Rapsoldis. Der Likör hat meinen Vater gleichsam in den Tod geschickt. – Ich wollte Guiseppe dies einmal verbieten. Mir kam dieses Datum auf einer Likörflasche pietätlos vor. Guiseppe blieb dabei: Zu dem „Erbbegräbnis“ gehöre auch das Unglücksdatum!“
Der Gouverneur klappte jetzt das Büchlein zu …
„Übrigens, Sennor Harst: wir Rapsoldis haben in Dodabetta tatsächlich ein Erbbegräbnis, sogar ein sehr eigenartiges … Dort ruhen drei meiner Vorfahren in mächtigen Zinksärgen …“
Harald fragte hastig:
„Und wo befindet sich dies Erbbegräbnis, Exzellenz?“
„Auf der Insel des Sees, der unweit des Schlosses liegt. Nur ein Inselchen, ein Felswürfel, der aus dem Wasser ragt. Der Felsen ist hohl, war ursprünglich ein dem Gotte Indra geweihter Tempel. Mein Ahn, der die Burg kaufte, bestimmte ihn zum Erbbegräbnis und liegt dort ebenfalls begraben.“
Eine längere Pause folgte …
Dann erhob Harald sich …
„Exzellenz, wir begleiten Sie … Glauben Sie, daß die Nachricht von den Ereignissen hier in Goa bereits bis Dodabetta gelangt sein kann?“
„Sie meinen, daß Sie beide hier in Goa weilen und leider, leider tagelang als Sträflinge …“
„Oh – das ist doch erledigt, Exzellenz … Die Schaukel des Barons Tissander ist jetzt außer Betrieb …“ (Vgl. den vorigen Band „Die Schaukel des Barons Tissander“.)
Der Gouverneur streckte Harald die Hand hin.
„Ich weiß, Sie haben mir verziehen. – Nein, bis eine Neuigkeit nach Dodabetta gelangt, vergehen Wochen. Die alte Burg liegt ja inmitten einer Bergwildnis, deren meilenweite Dickichte noch manchen Tiger und eine Unmenge Giftschlangen beherbergen. – Wenn Sie also nicht als Harst und Schraut mit mir nach Dodabetta reisen wollen, steht dem nichts im Wege …“
„Gut – also als Bergbauingenieure werden wir dort auftreten. Und wir reisen getrennt, Exzellenz. Wir beide schon morgen früh … Geben Sie uns bitte ein Schreiben für Guiseppe Vandoni mit … Sie selbst folgen uns in zwei Tagen …“ –
Es geschah, wie Harst es wünschte.
2. Kapitel.
Die anderen Gäste.
Ein Küstendampfer brachte uns nach der weit südlicher gelegenen Hafenstadt Kalikut. Von dort fuhren wir mit der Eisenbahn über Palghat und Potamur nach Utakamand, einer kleinen Bergstadt, wo wir zwei Pferde käuflich erstanden. Der Ritt durch die einsamen Schluchten und Täler, auf recht beschwerlichen Wegen war für uns immerhin eine Erfrischungskur. Harald war bei bester Laune. Über das Verschwinden des Grafen Antonio äußerte er sich nicht weiter. – „Die Sache ist noch nicht spruchreif,“ meinte er nur.
Die indische Regierung hatte es auch hier in dieser Wildnis wie überall den Reisenden recht bequem gemacht. Es gab viele kleine Rasthäuser, die unter öffentlicher Verwaltung stehen und die selbst dem Europäer genügen.
Bis Dodabetta rechnete man zwei Tagereisen. Wir schafften die Strecke in anderthalb Tagen. Gerade um die Mittagszeit bogen wir auf dem steinigen Fahrweg in ein sehr breites Seitental ein, und mit einem Male hatten wir so ganz unerwartet die Burg, den See, die kleine Insel und dahinter die bewaldeten Abhänge vor uns …
Greller Sonnenschein bestrahlte diese wundervolle Szenerie.
Wir hatten unsere kleinen struppigen Bergponys angehalten und genossen schweigend diesen in seiner Art einzigen Anblick.
Die Burg war aus rötlichem Sandstein errichtet, hatte zwei plumpe Ecktürme und in der Mitte eine hohe Kuppel. Links davon erkannte man einige neuere Gebäude, und rechts, durch eine schmale Waldkulisse getrennt, den langgestreckten See, der wie flüssiges Silber schimmerte …
Der Hintergrund dieses Gemäldes wurde durch den Dodabetta-Gipfel gebildet, durch dunkle Wälder, phantastische Felspartien und einige schlanke Bergkegel, um die wie dunkle Punkte indische Riesenadler ihre Kreise zogen.
Die Straße lief von hier fast gradlinig auf die Burg zu. Einen Park oder dergleichen gab es nicht. Nur riesige Zypressen[1] und schwarzgrüne Morca-Büsche umrahmten den mächtigen Bau.
Noch weiter nach links, wo dieses Tal in ein Quertal überging, sahen wir weiße niedere Baracken und zwei Holztürme: es mußten die beiden Zinnbergwerke sein.
Während wir hier noch hielten und schauten, kamen von den weißen Baracken fünf Lastautos daher, die das gewonnene Zinn nach der nächsten Bahnstation schafften.
Die Fahrer waren Inder. Sie musterten uns neugierig, und ohne Gruß ratterten sie vorüber.
„Weiße scheinen hier nicht sehr beliebt zu sein,“ meinte Harald. „Die Kerle sahen finster und fanatisch aus. Freilich: wir sind hier auch in einer Gegend, wo die Hindureligion sich in ihrer ursprünglichsten Form noch bewahrt hat.“
Wir ritten weiter.
Diese sonnige Landschaft gefiel mir. Ich pfiff vergnügt vor mich hin …
Harald räusperte sich …
„Vögel, die mittags singen, frißt abends die Katz, mein Alter!“
„Oho – wer soll uns hier fressen?!“ lachte ich.
„Bitte – hörtest Du nicht in der vergangenen Nacht vom letzten Rasthaus im Dschungel die Tiger heulen?! Lag nicht vor einer Stunde mitten im Wege eine riesige Kobra, deren Giftzähne rasche Arbeit verrichtet hätten?! Wir sind in Indien und nicht in Deutschland. Hier kannst Du im Salonwagen eines Zuges sitzen und zehn Minuten drauf von einem Tiger zerrissen werden. Ich denke, Du kennst Indien …!“
Ich pfiff nicht mehr …
Und fragte: „Mit einem Wort, Du witterst Gefahr?“
„Gewiß …“
„Und weshalb?! Wer weiß hier, wer wir sind?!“
Er schwieg … Er schaute scharf nach rechts hinüber.
Und da erkannte auch ich drüben auf der winzigen Felseninsel mitten im See ein helles Gewand – – ein Weib – eine Frau in europäischer Tracht …
Es war zu weit, um Einzelheiten zu unterscheiden. Jedenfalls stand die Frau neben dem niederen Gemäuer des ehemaligen Indra-Tempels[2] und jetzigen Erbbegräbnisses.
Ich wollte mein Fernglas aus dem Lederfutteral nehmen.
„Laß es stecken,“ meinte Harald.
„Weshalb?“
„Weil – wir beobachtet werden – vom linken Turme aus … – Bitte, glotze nicht hin … Da ist ein Mann mit einem Fernrohr – ja, Fernrohr …“
Und er ließ seinen Pony im Trab die letzte Strecke bis zur steinernen Treppe der Burg zurücklegen.
Nun hatten wir diesen massigen Bau ganz dicht vor uns.
Nun öffnete sich auch schon die kupferbeschlagene Flügeltür, und ein kleiner säbelbeiniger Herr in weißem Leinenanzug trat heraus, gefolgt von zwei indischen Dienern.
Dieses Männchen mit der ungeheuren Hakennase und dem weißen, trübselig um die Mundwinkel herabhängenden Schnurrbart wirkte in der Tat so urkomisch, daß ich mir das Lachen kaum verkneifen konnte, als er jetzt seinen Tropenhelm grüßend abnahm und so einen spitz zulaufenden absolut kahlen Schädel enthüllte …
Tänzelnd kam er die Treppe herab …
„Was steht zu Diensten, Sennores?“ fragte er mit einer quäkenden Stimme, die nur zu sehr an das unausgebildete Organ eines ganz jungen Ferkels erinnerte.
Harald reichte ihm das Schreiben des Grafen.
„Wir sind Bergingenieure und sollen die Umgegend nach neuen …“
Der Kleine quäkte dazwischen:
„Mein Name ist Guiseppe Vandoni, Sennores … Wollen Sie bitte absteigen … Wollen Sie sich bitte ins Haus bemühen … Ich werde es an nichts fehlen lassen, Sennores …“ –
Und zehn Minuten drauf hatte er uns bereits zwei Räume im ersten Stock des Mittelbaus angewiesen.
Räume – nicht Zimmer …
Zimmer gab es hier nicht …
Nur Säle, breite Galerien, breite Treppen, breite Korridore …
Alles war hier unglaublich weitläufig. In unserem Wohnsalon hätte eine Einfamilienvilla bequem Platz gehabt.
Wir hatten an Gepäck nur das Allernotwendigste mitgebracht. Unsere Koffer wollte Graf Rapsoldi mitnehmen. Nachdem wir uns gründlich gesäubert hatten, erschien auch schon ein Diener mit dem Frühstück. Die Hauptmahlzeit, so hatte uns der alte Guiseppe mitgeteilt, wurde erst abends halb sieben eingenommen, und dann würden wir auch die beiden anderen Burggäste, den amerikanischen Maler Thomas Buccley nebst Gattin kennenlernen.
Beim Frühstück bedienten wir uns lediglich der deutschen Sprache, um nicht etwa belauscht zu werden. Harald meinte, Guiseppe sei ein Clown – nichts weiter …
Und ich meinte, Frau Buccley müsse die Dame gewesen sein, die wir auf der Mausoleumsinsel bemerkt hatten.
Worauf Harald wieder erklärte, er sei auf diese Amerikaner sehr neugierig, die nach Guiseppes Angaben seit einer Woche hier Landschaftsskizzen für ein Reisewerk über Indien anfertigten.
Das Frühstück war erstklassig. Man merkte nicht, daß man sich hier in der Wildnis zwischen Tigern und Brillenschlangen befand.
Dann erschien Sennor Guiseppe und erkundigte sich, wie es uns geschmeckt habe …
Der kleine Kerl war wirklich ein Clown. Sein Gesicht zeigte eine Lebendigkeit des Ausdrucks, die fast verblüffte.
Er strahlte, als Harald alles lobte.
„Nur – haben Sie nicht andere Räume für uns, Sennor Vandoni? – Diese Reitställe sind höchst ungemütlich …“
Guiseppe verzog sein Gesicht zu jämmerlichster Trostlosigkeit …
„Bedaure … Bedaure unendlich, Sennores. Die beiden bewohnbaren Turmzimmer habe ich dem Ehepaar Buccley überlassen …“
Und er tänzelte wieder davon.
Harald nahm eine Mirakulum aus seinem Etui und rauchte sie an …
„Ich denke, wir gehen ins Freie, mein Alter!“
Wir gingen. Und kamen durch endlose Flure – über wundervolle alte Teppiche – kamen in den linken Seitenflügel, wollten uns die Burg doch einmal erst flüchtig ansehen …
Keiner Menschenseele begegneten wir …
Hörten mit einem Male Stimmen, sahen, daß hier eine uralte Tür aus getriebenem Kupfer in den Turm führte.
Die Tür war nur angelehnt …
Und im Turme erklangen die Stimmen … Eine helle – eine tiefe …
Englische Worte … Mit jenem Akzent, der den Amerikaner verrät …
Also das Ehepaar Buccley …
Wir standen sekundenlang auf demselben Fleck … Wir hatten nicht lauschen wollen … Und taten es doch.
Bis Harald mich rasch mit sich zog …
Flüsterte:
„Das genügt …!! Pech ist’s!“
Ja – auch ich hatte ja deutlich gehört, wie der Maler gesagt hatte:
„Ich habe ihre Bilder noch letztens in einer illustrierten Zeitschrift gesehen …“
Und die helle Stimme hatte erklärt:
„Vielleicht täuschest Du Dich, Tom …“
„Ausgeschlossen! Es sind die beiden Berühmtheiten. Und wenn sie hier als Ingenieure erscheinen, dann haben Sie auch etwas vor …“
Und da hatte Harald mich schnell mit sich genommen.
Nun waren wir unten in der Vorhalle … Er flüsterte wieder:
„Pech – – übles Pech!! Ein Maler hat stets ein gutes Gedächtnis für Gesichter … Und dieser Thomas Buccley war’s, der sich bei unserer Ankunft auf dem Turme mit dem Fernrohr befand!“
Harsts merkwürdiger Ton machte mich stutzig …
Und er legte mir da die Hand schwer auf die Schulter …
„Lieber Alter, dieser Buccley hat unmöglich nach uns ausgeschaut … Ich behaupte, er hat dort oben – Posten gestanden, während seine Frau auf der Insel irgend etwas Verbotenes trieb …“
„Wie willst Du den Verdacht begründen, Harald?!“
„Durch die einfache Tatsache, daß die Frau auf der Insel von dem Manne auf dem Turm ein Zeichen erhielt.“
„Und – welch ein Zeichen?!“
„Er hob das Fernrohr hoch empor … Und dieses lange ausgezogene Messingrohr muß in der Sonne wie ein greller Strich geblitzt haben … Die Sonne stand gerade so, daß …“
Er schwieg …
Neben uns war – Frau Buccley aufgetaucht … lächelte uns liebenswürdig an … rief:
„Ah – die neuen Gäste …!“
Ein reizendes Frauchen!
So machten wir hier in der Vorhalle Grita Buccleys Bekanntschaft.
3. Kapitel.
Der Weinkeller.
Auch Thomas Buccley fand sich ein. Ein Mann mit sehr scharf markierten Zügen und einer ungeheuren Pomadigkeit.
Als wir nun dem Ehepaar gegenüber dieselben Namen nannten, die wir Guiseppe als die unsrigen angegeben hatten und die auch in dem Schreiben des Grafen standen, da lächelte der Maler ein wenig und sagte mit gedämpfter Stimme:
„Verzeihen Sie, Mister Harst: Ihr Gesicht ist doch zu charakteristisch, als daß man es vergessen könnte. Sie sind der deutsche Detektiv Harald Harst … Und dies hier ist Ihr Freund Max Schraut. Von uns haben Sie wirklich keinen Verrat zu fürchten.“
Was half es?! Wir mußten unser Inkognito lüften. Leugnen hätte hier keinen Zweck gehabt.
Die Buccleys versprachen, unser Geheimnis zu wahren.
Wir gingen nun zu vieren ins Freie. Das Ehepaar gefiel mir, besonders Frau Grita. Sie war vergnügt, witzig, schlagfertig. Ihr keckes Bubengesicht, ihre dunklen Augen zu prachtvollem aschblonden Haar verriet Temperament und ungezügelte Lebenslust.
Anderthalb Stunden durchstreiften wir die Umgebung, kamen auch zum steinigen Seeufer, sahen hier ein paar Nachen liegen und ließen uns von Frau Grita erzählen, wie köstlich poetisch drüben die Felseninsel mit dem ehemaligen Indra-Tempel sei …
Tom Buccley lacht da nachsichtig …
„Meine Frau ist in die Insel ganz verliebt … Dreimal hat sie den kleinen Tempel schon gezeichnet …“ –
All das war so überaus harmlos. Ich meinerseits konnte an diesen Leuten wirklich nichts finden, was irgendwie Verdacht erregte. Besonders auch der Umstand, daß sie so ehrlich uns vorgehalten hatten, wer wir in Wahrheit seien, sprach doch durchaus für ihre Ehrlichkeit.
Frau Buccley wollte dann gern wissen, was uns hierher geführt hatte. – Harald erklärte, Graf Rapsoldi wünsche das Verschwinden seines Vaters nochmals untersuchen zu lassen.
„Ah – davon hat der alte Guiseppe uns bereits mancherlei erzählt,“ rief Frau Grita in ihrer quecksilbrigen Art. „Eine recht geheimnisvolle Geschichte, Mister Harst … Wie denken Sie denn darüber?“
„Noch gar nicht,“ lächelte Harald. „Das soll erst kommen. Das wird sich alles finden!“
Hiermit war auch dieses Thema erledigt.
Der Maler meinte dann, ihm sei es etwas peinlich, daß der Graf übermorgen hier nun ebenfalls eintreffen würde, weil doch Guiseppe ihn und seine Frau als völlig Fremde in die Burg aufgenommen habe.
„Wir sind ganz zufällig hier nach Dodabetta gelangt. Und weil es hier doch so viel reizvolle landschaftliche Partien gibt, wollten wir gern ein paar Tage bleiben. Ein Hotel existiert nicht, also mußten wir schon den Schloßverwalter um Unterkunft bitten. Wer weiß, wie der Graf sich dazu stellen wird …“
Harst beruhigte ihn. Rapsoldi sei Gentleman und sehr liebenswürdig. Und Frau Grita meinte darauf kokett: „Oh, ich werde Seine Exzellenz schon für uns einnehmen …“
Wir hatten inzwischen den See umrundet und näherten uns wieder der Burg. Bisher hatte ein frischer Wind die Tageshitze angenehm gemildert. Jetzt war der Wind eingeschlafen. Eine wahre Backofenglut lagerte über dem Tale. Wir waren froh, als wir die kühle Vorhalle wieder erreicht hatten, verabschiedeten uns hier von dem Ehepaar, da wir ein wenig ruhen wollten.
In unseren Räumen kaum angelangt, begann Harald eine ganz genaue Untersuchung der beiden Säle, die wie alle anderen Gemächer hier in der Burg mit einem seltsam anmutenden Gemisch uralter indischer und ganz moderner Möbel ausgestattet waren.
Er hatte die beiden Türen nach dem Flur verriegelt – wortlos …
Ebenso wortlos durchstöberte er jetzt unseren Wohnsalon.
Ich sah es seinem Gesicht an, daß die Bekanntschaft mit Buccleys seinen Argwohn eher noch vergrößert hatte.
Ich war ein wenig ärgerlich über sein Schweigen … Schaute ihm zu und meinte schließlich:
„Was soll das, Harald?!“
Er hatte gerade einen der halb in die Wand eingelassenen Riesenschränke geöffnet. Ich war dicht hinter ihn getreten.
„Guiseppe hat uns belogen,“ flüsterte er. „Frau Buccley verplapperte sich. Es sind noch verschiedene kleinere Zimmer vorhanden. Weshalb hat er uns gerade in diesen Reitställen untergebracht?!“
„Du traust ihm nicht?! Dem – Clown?!“
„Wenn ich einen Menschen als Clown bezeichne, mein Alter, dann weise ich gleichzeitig dadurch auf seine schauspielerischen Fähigkeiten hin. Dieser Guiseppe ist ein ganz gefährlicher Bursche …“
Ich – – war platt …
„Guiseppe – – gefährlich?! Soll das ein Witz sein?!“
Ein merkwürdiger Blick traf mich …
„Du – wirst hier noch Dein Wunder erleben, lieber Alter!“ Und das kam in einem Tone heraus, daß ich fast eine Gänsehaut spürte.
„Geh in den Flur und gib acht, daß niemand mich beobachtet,“ fügte Harst hinzu. „Die alten Türen haben überall Risse, und ein paar dieser natürlichen Gucklöcher sind künstlich erweitert worden.“
In meinem Innern hatte sich jäh eine Wandlung vollzogen. Harst warnt nie ohne Grund.
Etwas beklommen patrouillierte ich also im Flur auf und ab. Totenstill war’s in dem riesigen Bau. Unheimlich still … Ganz so, als ob hier niemand hauste, als ob’s ein verwunschenes Schloß wäre.
Nach einer Stunde rief Harald mich in den Wohnsalon.
„Ich habe nichts gefunden,“ erklärte er. „Ich erwartete bestimmt, daß es hier versteckte Türen geben würde. Nichts von alledem! Und das – beunruhigt mich noch mehr!“
Er setzte sich. Seine Zigarette schickte einen feinen Qualmfaden zur getäfelten Decke empor. Sein schmales braunes Gesicht war geradezu düster und wie umwölkt.
Ich lehnte neben ihm am Tisch. Die Sonne fiel in farbigen Streifen durch die bunten Fenster auf die kostbaren Teppiche. Von den Steinfliesen des Fußbodens waren nur Teile zu sehen, so dicht lagen die Teppiche nebeneinander.
„Du steckst mich mit Deinen Unkenrufen direkt an!“ meinte ich ein wenig gereizt. „Du weißt nun doch, daß hier nichts …“
Er blickte auf. „Ich weiß, daß die beiden Buccleys uns nur als Harst und Schraut ansprachen, weil sie gemerkt haben, daß wir vor ihrer Turmtür gewesen …“
„So?!“
„Du bist eben blind … – Hast Du Dir die wunderhübschen Bastläufer im Flur genauer angesehen? Sie haben so matte Farben, … weil sie nämlich ganz, ganz fein mit einem grauweißen Pulver bestreut sind …“
„Nicht möglich!“
„Jeder Fußtritt zeichnet sich in dieser harmlosen … Staubschicht ab – jeder … Man muß allerdings scharf hinschauen. Mit einem Wort: wir können hier in der Burg kaum einen Schritt tun, der nicht nachkontrolliert werden kann … Und die Fliesen neben den Bastläufern sind ähnlich präpariert, wenn auch nur stellenweise … – Falls zum Beispiel diese beiden Amerikaner mit Guiseppe unter einer Decke stecken, dann – gebe ich für unser Leben keinen Pfifferling. Genau weiß ich’s freilich nicht. Auch die Buccleys können das grauweise Pulver gestreut haben – ohne Wissen des alten Verwalters.“
Ich ging rasch zur Tür. Ich wollte mich davon überzeugen, ob Harald wirklich mit dieser seltsamen Behauptung recht hatte …
Öffnete die Tür …
Und bückte mich, sah nun schräg auf die Bastläufer, sah so jeden meiner Schritte von vorhin – jeden!
Und kam zu Harald zurück …
„Es stimmt leider,“ sagte ich kleinlaut …
Und er:
„Ja – es stimmt manches … Es stimmt zum Beispiel auch, daß Graf Antonio Rapsoldi gerade in der Nacht des 15. Juni die Abrechnungen über die Einkünfte und Ausgaben dieses seines indischen Besitzes prüfte. Dann holte er die Flasche „Erbbegräbnis“ – wollte sie holen – kehrte aus den Gewölben nicht zurück … Wenn nun zum Beispiel der Vater des jetzigen Verwalters ein Betrüger war und in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte, wenn jener erste Guiseppe Vandoni die Aufdeckung von Unterschlagungen fürchtete, dann – dann mußte Antonio Rapsoldi verschwinden …“
Ich verstand … Und meine Gedanken prüften rasch nochmals alles, was der Gouverneur uns mitgeteilt hatte.
So stieß ich denn auf etwas, das mich nun zu der Frage bewog:
„Wer mag jenen Brief an den Sohn des Verschwundenen geschrieben haben – jenen Brief, in dem ein Ungenannter behauptete, der Besitzer von Dodabetta würde in dem verlassenen Bergwerk gefangengehalten?!“
„Ich denke, der jetzige Guiseppe hat’s getan … Es mögen hier Gerüchte entstanden sein … Und da wollte er denen zuvorkommen, die ihn vielleicht angeschwärzt hätten …“
„Hm – nicht ausgeschlossen …“
Harald rauchte drei Züge.
„Wir werden uns hier sehr in acht nehmen. Nachts wird nur immer einer von uns schlafen … Und deshalb wollen wir uns jetzt niederlegen und Vorrat schlafen …“
Es kam nicht dazu.
Es klopfte …
Guiseppe, der Clown, war’s …
Katzbuckelnd, lächelnd entschuldigte er sich, daß er uns zu stören wage. Dann tat er mit einem Male sehr geheimnisvoll …
Begann von – dem Vater seines jetzigen Herrn zu sprechen …
„Sennores, Sie als Ingenieure sind doch gebildete Herren, werden besser als unsereiner diese Dinge überschauen.“
Und er berichtete, was sich damals in der Nacht des 15. Juni zugetragen.
„Falls die Sennores sich einmal die Keller ansehen wollen … Die Gewölbe sind in die Felsen eingemeißelt … Man staunt, was die Inder vor Jahrhunderten an Arbeit geleistet haben …“
Harald erhob sich …
„Natürlich interessiert uns als Ingenieure schon allein die Anlage der Keller, Guiseppe … Gehen wir also!“
Und als der Verwalter nun uns voran die Treppe zur Vorhalle hinabstieg, stieß Harald mich an, klopfte auf seine Jackentasche …
Ich nickte …
Auch ich hatte die Neunschüssige schon griffbereit.
Aus der Vorhalle kamen wir durch einen Bogengang in eine zweite Halle, und von hier ging eine breite Treppe, die mit einer runden Marmorbrüstung oben eingefaßt war, in die Gewölbe hinab.
Ich habe schon viele Felsenkeller gesehen … Dies hier waren keine Keller, es waren acht Meter hohe Dome, verbunden durch Kreuzgänge.
Sauber war das Gestein poliert, ebenso sauber allerlei Reliefs eingehauen.
Das Licht der großen Karbidlaterne Guiseppes fiel auf Szenen aus der indischen Göttergeschichte, Szenen, die in merkwürdig primitiver und drastischer Art das Liebesleben behandelten.
Die vorderen Gewölbe waren leer. Dann eine Treppe. Und nun der sogenannte Weinkeller …
Die Regale an den Wänden waren bis auf ein einziges leer …
Hier machte Guiseppe halt – hier vor diesem Regal voller Likörflaschen …
„Alles „Erbbegräbnis“,“ erklärte er … „Neunzig Flaschen!“
Und er nahm eine, entkorkte sie, nahm aus einem Kasten des Regals drei Gläschen und füllte sie. Goldgelb und dick floß der Likör … Der aromatische Duft stieg uns in die Nase …
„Ihr Wohl, Sennores …“
Und Guiseppe trank – mit wahrer Andacht …
Wir hielten unsere Gläschen noch in den Händen … Ich traute dem Frieden nicht …
Guiseppe schaute uns an …
„Kosten Sie nur, Sennores …“
Harald reichte ihm da sein Gläschen …
„Trinken Sie!“ befahl er. Und seine Stimme war drohend und hart.
Der kleine Kerl grinste … „Wie Sie wünschen …“ Und er faßte nach dem Glase, war ungeschickt … Es fiel zu Boden, zerschellte auf dem Felsboden …
„Oh …!“ rief Guiseppe. Bückte sich – war mit einem Satz zur Seite …
Und – unter unseren Füßen klappte gleichzeitig ein Quadrat dieses scheinbar so festen Gesteins herab – blitzschnell – und so überraschend, daß wir abwärts schossen – metertief … hinein in kühles aufspritzendes Wasser …
4. Kapitel.
Ratten im Wassertopf.
Ratten im Wassertopf …
Etwa so war’s … Nur ein recht großer Topf, ein Kanal mit glatten Wänden.
Kaum hatte ich mir das Wasser aus den Augen geschüttelt, kaum zu schwimmen begonnen, als auch schon Haralds Taschenlampe aufleuchtete …
Ich sah, er hatte sie zwischen den Zähnen, schwamm langsam im Kreise, beleuchtete die Wände …
Ein Kanal … Kaum anderthalb Meter über uns die grauschwarze Felsdecke … Ein Kanal, ausgehauen aus dem Gestein wie die Gewölbe …
Meine Augen suchen – suchten …
Irgendwo mußte es doch einen Halt für die Hände geben. Sonst – mußten wir hier ertrinken – wie die Ratten im Wassertopf, die immer mehr ermüden, die angstvoll an den platten Wänden entlangschwimmen, die nirgends Halt finden, schließlich untersinken und mit letzter Kraft nochmals emporkommen, um dann endgültig unterzutauchen …
So würde es uns ergehen …
Ein langgestrecktes Viereck war dieser Wasserbehälter hier. Drei Meter breit, vielleicht zwanzig lang …
Einmal hatten wir ihn nun umrundet …
Da nahm Harald die Taschenlampe in die Linke …
Ich war neben ihm. Wir schwammen in ruhigen Stößen.
„Hier muß es eine Verbindung mit dem See geben,“ sagte er leise. „Da – das Wasser ist klar … Es erneuert sich … Dort nach Süden zu liegt der See … Schwimmen wir nochmals zu jener Schmalseite …“
Wir schwammen …
Und als wir nun die schmale Felswand vor uns hatten, gab Harst mir die Taschenlampe.
„Ich werde tauchen … Hier muß sich unter Wasser ein Loch befinden …“
Und ehe ich ihn noch ermahnen konnte, doch ja recht vorsichtig zu sein, war er schon verschwunden.
Das Wasser warf kleine Wellen …
Angst preßte mir jäh das Herz zusammen … Todesangst … Ich fühlte, daß meine Kleider schwerer und schwerer wurden … Meine braunen Sportschuhe wogen wie Blei …
Ich schwamm hin und her …
Harald erschien nicht wieder …
Meine Angst wurde zu sinnlosem Entsetzen …
Ertrinken müssen – – hier … wie eine armselige Ratte! Durch die Schurkerei Guiseppe Vandonis …!!
Meine Kleider wogen Zentner …
Meine Armmuskeln versagten fast …
Nur Ruhe – – Ruhe!!
Harald … erschien nicht …
Minuten waren verstrichen …
Ich begann zu zählen, nur um mich abzulenken …
Zählte bis hundert – hundertfünfzig …
Oder – waren’s schon zweihundertfünfzig gewesen?!
Ich wußte es nicht …
Der kalte Schweiß lief mir beizend in die Augen …
Ich versuchte mit den Füßen Grund zu finden, ließ mich bis zum Kinn hinabsinken …
Nichts – kein Halt!
Und schwamm von neuem …
Ratte im Topf …
Harald – – Harald?! Vielleicht schon tot … Vielleicht schon erstickt … Vielleicht hatte er das Letzte schon hinter sich …
Muskelkrampf lähmte mir den rechten Arm …
Ich fühlte: es war das Ende …
Wadenkrämpfe meldeten sich mit wütenden Schmerzen.
Meine Gedanken flatterten … Ich schluckte Wasser. Kam wieder hoch … Sank abermals …
Und spürte plötzlich unter den Stiefelspitzen etwas Rundes, Hartes … Fand einen Stützpunkt, reckte mich hoch, – gerade noch mit dem Munde über die Wasseroberfläche.
Ruhe – Ruhe …!!
Siedendheiß schoß mir das Glücksgefühl der Hoffnung zum Herzen …
Ruhe – Ruhe …!!
Und ich stand still – regungslos …
Merkte, daß ich auf etwas Rundem stand – vielleicht einem Stein von Schädelgröße …
Meine Nerven zuckten nicht mehr. Ich hoffte … Erholte mich, atmete gleichmäßig …
Längst war mir die Taschenlampe entglitten … Brannte nun dort vor mir als matter Schein auf dem Grunde des Kanals …
Meine Augen stierten durch die klare Flut, lernten dort unten Einzelheiten unterscheiden …
Einzelheiten …
Gerippe – menschliche Gerippe …
Auf einem Totenschädel stand ich …
Auf einem Haufen Gebeine …
Mir war’s gleichgültig … Ich konnte atmen. Die Toten retteten einen Lebenden …
Minuten schlichen …
Ich kam zu Kräften … Neue Gedanken … Neue Angst und Sorge: Harald – – Harald?!
Ich – schämte mich plötzlich … Hatte ich den Freund nicht eigentlich treulos im Stiche gelassen?! Hätte ich ihm nicht folgen sollen?! Er mußte ja ein Loch gefunden haben, eine Fortsetzung des Kanals!
Und dann – ein Entschluß …
Herunter mit Jacke und Weste … Die Pistole in die Hosentasche …
Einen Fuß vorsichtig gehoben … Den Schuh wollte ich abstreifen, verlor den Halt – und tauchte nach der Lampe, packte sie, schoß hoch, atmete tief ein, tauchte wieder – dicht an der Schmalwand …
Und meine Augen sahen beim trüben verschwommenen Schimmer eine bogenförmige Öffnung …
Hinein …
Vorwärts … Mit den Füßen mich abstoßend.
Vorwärts …!
Und wieder die Angst …
Denn dieser Kanal hatte kein Ende, war bis oben gefüllt …
Kein Ende …
Weiter – weiter …
Das Blut brauste mir in den Ohren …
Die Brust wollte mir springen …
Weiter – weiter …
Und dann – mit einem Male flog ich empor …
Luft – Luft …
Zwei taumelnde Schritte … Und die Füße noch im Wasser brach ich auf hartem Gestein zusammen …
Nicht bewußtlos – nur vollkommen erschöpft …
Sah dicht neben mir eine andere Gestalt: Harst …! – Auch keuchend – nach Luft ringend …
Seine Hand tastete hinüber, fand die meine …
„Gott sei Dank …!“
Und Hand in Hand erholten wir uns, setzten uns aufrecht …
„Ich war mit dem Kopf gegen eine Felskante gestoßen,“ flüsterte er. „Ich – konnte Dich nicht holen. Ich habe hier Folterqualen ausgestanden …“
Die Taschenlampe drohte zu erlöschen. Die Batterie war verbraucht.
Ich zog die meine hervor.
„Nicht einschalten,“ meinte Harald. „Bis wir wieder bei Kräften sind …“
Wir warteten – warteten …
Saßen im Dunkeln …
Ich erzählte … Von den Skeletten, von dem Totenschädel …
„Hier ist auch Graf Antonio umgekommen,“ sagte Harald dann. „Ich wußte es ja: der alte Guiseppe hatte ihn betrogen, und sein Sohn Guiseppe ist Mitschuldiger …“
Dann befahl er: „Licht!“
Und wir sahen, wo wir uns befanden: in einer engen, langen Höhle, in deren Mitte eine Rinne für das Wasser ausgehauen war.
Wir schritten nach Süden zu …
Harald voran … Am linken Ufer des Wassers …
Die Höhle hatte hie und da Ausbuchtungen. Verengerte sich auch wieder.
Harst sagte nach einer Weile: „Meiner Berechnung nach befinden wir uns schon unter dem See … Gib acht: diese Grotte endet im Gestein der Felseninsel …“
Noch hundert Meter. Mit einem Male vor uns ein runder See von vielleicht fünfzig Meter Durchmesser. Rechts und links breite Öffnungen, fast bis oben von Wasser bespült. Und ganz oben nur schmale helle Streifen: Tageslicht!
„Die Insel!“ meinte Harald wieder.
Ich hob die Lampe höher …
Mitten im See etwas wie ein Gerüst – bis zur Felsdecke emporreichend … Starke Balken, die eine Zickzacktreppe umgaben.
Harst watete schon ins Wasser …
Schwamm … und ich hinterdrein …
Bis zu dem dicken Balken, der Treppe, deren Holzstufen unten nur wenig angefault waren …
„Batna-Holz,“ erklärte Harald. „Die indische Eiche – unverwüstlich …“
Er kletterte höher …
Und dann eine Plattform, darüber der Fels, in dem sich ein großes Oval abzeichnete: ein Loch, das mit einer Platte verschlossen war.
„Indische Tempelgeheimnisse,“ sagte Harst wieder.
Und stemmte die Hände flach gegen den Deckel, hob ihn empor, schob ihn zur Seite …
Ich bückte mich … Von meinen Schultern schwang er sich in das ovale Loch hinein, zog die Beine nach, ließ sich die Taschenlampe geben …
Half mir dann empor …
Wir standen in einem quadratischen Felsgemach …
Nicht allein …
Da waren drei Götzenbilder, überlebensgroß – Statuen des Indra, die wie Gold funkelten …
Drei Statuen mit wundervoll ausgeführten Köpfen … Nur daß überall breite Schrammen die Außenschicht durchzogen und flache kleine Löcher mit zackigen Rändern klafften.
„Vergoldet, mein Alter …“ sagte Harald. „Schau Dir die Augenhöhlen an, die anderen Löcher … Da waren überall Edelsteine eingelassen – waren! Die Krater sind frisch … Diebe waren hier am Werk …“
Und nach kurzer Pause:
„Die Amerikaner – die Buccleys!“
Das war wieder einer jener Lichtblitze, die das Dunkel grell durchleuchteten …
„Ja – die Buccleys!“ meinte ich. „Also deshalb sind sie nach Dodabetta gekommen!“
„Deshalb war Frau Grita hier, und deshalb paßte Tom auf dem Turme auf …“
„Nette Maler …!!“
„Gauner!“
Und er nahm mir die Taschenlampe ab … Suchte oben an der Decke nach dem Ausgang, der nicht schwer zu finden war … Denn auch dort ein Oval in dem Gestein, auch dort ein Deckel, ebenfalls eine Steinplatte – gerade über dem Kopfe des einen Götzen.
Wir turnten nacheinander an der Statue empor …
Nacheinander kletterten wir durch das Loch … Waren nun im – Erbbegräbnis der Grafen Rapsoldi …
5. Kapitel.
Der mittlere Sarg.
Drei Zinksärge … An den Fußenden Metallplatten mit Inschriften … An der Hinterwand ein großes Kruzifix. Die linke Mauer mit vertrockneten Riesenkränzen behängt, an denen noch die vergilbten Schleifen zerschlissen bis zum Steinplattenboden hinabreichten … Dem Kruzifix gegenüber eine Steintreppe, oben in der Decke die Umrisse einer sehr großen Falltür …
Und das Merkwürdigste: über dem mittleren Sarge an der Decke ein Flaschenzug mit dicken Tauen, an deren Ende eiserne Haken eingeknotet waren …
Wir beide hier nun in stillem Schauen. Zunächst wortlos. Dann fügte Harald den Deckel der Fußbodenöffnung wieder ein. Dieser Deckel paßte so genau, daß von diesem Zugang zu dem Götzengemach und dem Kanal nichts mehr zu bemerken war.
Harst sagte leise: „Die Buccleys müssen irgendwie in Erfahrung gebracht haben, daß die Indra-Statuen[3] sich dort unten befinden … Und diese wertvollen uralten Statuen dürften aus diesem ehemaligen Tempel in jenem Jahre verschwunden sein, als die letzte Fürstin von Dodabetta fliehen mußte. Du besinnst Dich, daß der Gouverneur erwähnte, daß der See und die Insel ursprünglich von seinem Ahn nicht mit erworben worden waren …“
Ein Geräusch über uns ließ uns beide leicht zusammenfahren …
„Schritte …!!“ flüsterte Harald.
„Schritte!!“ bestätigte ich.
Und Harst sah sich nach einem Versteck um …
„Dort – die Kränze … schnell!!“
Schon bewegte sich über uns die große Falltür …
Die Kränze knisterten, zerfielen zum Teil. Aber sie deckten uns. Eng an die Wand gedrückt standen wir regungslos.
Die Taschenlampe hatte ich ausgeschaltet.
Wir warteten …
Von oben Lichtschein … Jemand kam die Treppe herab, ließ die Klappe der Falltür wieder zurückgleiten …
Ein helles Leinenkleid, zierliche Schuhe: Grita Buccley, die Frau des angeblichen Malers!
In der Linken trug sie eine kleine Laterne, die wie eine photographische Momentkamera aussah. Sehr sicher kam sie die Treppe herab. Man merkte, daß sie hier nicht zum ersten Male weilte und daß sie sich auch ganz sicher wähnte.
Ich war gespannt, ob sie etwa noch ein Stockwerk tiefer in den Götzenraum hinabsteigen würde. Freilich: die Edelsteine aus den Statuen waren längst entfernt, und die Götzen selbst nur vergoldet und doch kaum wegzuschleppen! – Was wollte sie also hier?!
Sie stellte ihre Laterne jetzt auf eine der Treppenstufen. Dann ging sie zwischen den Zinksärgen hindurch und reckte die Arme empor: sie langte nach den Tauen des Flaschenzuges!
Ich begriff nicht recht, was sie damit wollte. Etwa einen der Deckel der Särge emporheben?! Und überhaupt: wozu der Flaschenzug, der hier so ganz öffentlich angebracht war?!
Meine Vermutung stimmte: am Rande des Deckels des mittleren Sarges mußten sich Ösen befinden, in die die Haken der Taue hineinpaßten …
Die reizende Frau Buccley packte nun mit ihren schmalen ringgeschmückten Händen das Zugtau des Flaschenzuges und brachte so den Deckel in die Höhe. Er schwebte leicht über dem Unterteil des Sarges.
Sie nahm ihre Laterne und beugte sich tief über den offenen Sarg … –
Bis dahin war nichts geschehen, was irgendwie aufregend oder rätselhaft gewesen …
Harald und ich standen hinter den Kränzen in voller Sicherheit. Frau Buccley hatte nicht einmal flüchtig dorthin geschaut.
Jetzt aber, wo wir beide fraglos dasselbe annahmen, nämlich, daß die Amerikanerin aus dem Sarge einen Beutel mit Diamanten herausnehmen würde (was sollte sonst wohl dort verborgen sein?!), daß sie also die ganze Beute an Edelsteinen oder doch einen Teil davon mit nach der Burg nehmen würde, – jetzt geschah etwas so Unglaubliches, daß wir uns alle Mühe geben mußten, weiter regungslos in unserem Versteck zu verharren …
Grita Buccley stieß plötzlich einen gellenden Schrei aus. Dieser Schrei erstickte schnell in einem dumpfen Röcheln – ganz so, als würde der Amerikanerin die Kehle zugedrückt.
Leider konnten wir aber von unserem Platze aus jetzt nur noch wenig von dem erkennen, was dort vor sich ging, da die Laterne offenbar schräg in den Sarg gefallen war und ihre Strahlen nicht nach außen leuchteten.
Immerhin: eine für uns unsichtbare Gewalt zerrte den Körper der Frau in den Unterteil des Sarges hinein, und ebenso schnell senkte sich dann der Deckel wieder herab: eine Hand, die für uns im Dunkel unbemerkt blieb, mußte das an einem der Metallgriffe des Unterteils geknotete Tau gelöst haben!
In demselben Moment, als der Sargdeckel mit leise hallendem metallischen Ton sich auf den Unterteil legte, – in diesem Moment, als auch die letzte Spur von Lichtschein erlosch, wollte Harald mit einem mir hastig zugeflüsterten „Vorwärts …!“ unser Versteck verlassen …
Und – blieb doch ohne jede Bewegung neben mir, gleichsam gebannt durch den grellen Schimmer, der jäh vor den Särgen aus dem Steinplattenboden aufflammte – aus der nach unten führenden Öffnung, deren Deckel sich lautlos gehoben haben mußte …
Eine große Laterne ward sichtbar – ein hagerer brauner Arm – der Kopf eines greisen weißbärtigen Inders mit dunklem Turban …
Ein Gesicht, von Falten durchfurcht … Aber ein Paar Augen, die in unheimlichem Glanze funkelten … –
Der greise Inder stieg vollends aus der Öffnung … Richtete sich auf, ließ den Lichtschein der Laterne über die Särge gleiten …
Wir sahen genau, wie er plötzlich ruckartig den Kopf vorschob, auf den mittleren Sarg stierte …
Er hatte bemerkt, daß die Taue in den Ösen befestigt waren …
Und da – – wie aus der Unterwelt ein dumpfer Schrei …
Ein Hilferuf …
Aus dem Sarge – von Grita Buccleys Lippen …
Ein zweiter Schrei …
Heller, gellender … Wahnsinnige Todesangst verrieten diese furchtbaren Laute …
Da stellte der Greis rasch seine Laterne auf eine der oberen Treppenstufen, sprang zu, packte das Tau des Flaschenzuges …
Der Deckel hob sich …
Und aus dem sich schnell verbreiternden Zwischenraum reckte sich der Amerikanerin schlanker Arm hervor …
Und Arm und Hand – diese schmale Hand mit den blitzenden Ringen – bewegten sich in angstvoller, flehender Geste …
Bis nun auch die Frau selbst sichtbar wurde … Tief zusammengeduckt kniete sie in dem Sarge … Ihr Kleid war über und über beschmutzt … Ihr Gesicht verzerrt. Und kaum hatte sie jetzt den Greis erblickt, als ein wimmerndes „Gnade – – Erbarmen!“ sich zitternd über ihre Lippen drängte …
Dann hatte der Inder bereits das Tau befestigt, half ihr heraus …
Sie taumelte, sank auf der Treppe zusammen …
Schluchzte, wimmerte …
Vor ihr stand der Alte …
„Wo – sind die Diamanten der Statuen?“ fragte er in geläufigem Englisch.
Sie weinte … Ihre Nerven rebellierten noch … – Er wiederholte die Frage – lauter, eindringlicher …
Und da antwortete sie – sinnlos noch vor Entsetzen:
„Fort – verschwunden – nicht mehr da!“
Neues Schluchzen …
„Lagen die Edelsteine in dem Sarge des ersten Rapsoldi, der hier beigesetzt wurde?“ fragte der Greis wieder. „Im Sarge des Grafen Manuel Rapsoldi, der früher seine letzte Ruhestätte in den Gewölben der Burg hatte, bis auch diese Insel Eigentum der Rapsoldis wurde?“
„Ja – ja …!“ – Grita Buccley ward ruhiger.
„Und – wer stahl sie?“
„Ich weiß es nicht … Der Mann wahrscheinlich, der mich – würgte, der mich in den Sarg hineingezogen hatte.“
„Wie?!“ Und der Inder beugte sich zu ihr herab. „Wie?! Ein Mann – – im Sarge …?! – Sie lügen!“
„Bei der heiligen Madonna …! Ich lüge nicht …!“ Ihr Gesicht bekam Farbe … Sie schaute den Inder an. „Ich wollte den Beutel mit den Steinen holen … Wir wollten die Burg verlassen, weil jetzt dort zwei neue Gäste eingekehrt sind … Und als ich mich vorhin über den Sarg beugte, umkrallten zwei Hände meinen Hals, – Hände, die unter den vermoderten Decken hervorschossen … – Mehr weiß ich nicht … Ich habe dann um Hilfe geschrien … Mehr weiß ich nicht …“
Der greise Inder schüttelte den Kopf …
„Das – begreife ich nicht …“ – Er sprach wie zu sich selbst. – Und lauter: „Ich fühle, daß Sie nicht lügen … Mag auch mein Hirn leer sein … Ich fühle es: Sie lügen nicht! Gehen Sie … gehen Sie – – und schweigen Sie, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist …“
Er stützte sie – führte sie die Treppe empor …
Oben knarrte die große Falltür… Schloß sich wieder.
Der Alte kam langsam herab …
Wir waren mit ihm allein – im Erbbegräbnis der Rapsoldis …
Der Greis ohne Hirn.
1. Kapitel.
Der Weg zu Brahma.
Also allein mit dem Greise, der soeben gesagt hatte: „Wenn auch mein Hirn leer ist …“
Über diese seltsame Äußerung nachzugrübeln, hatte ich keine Zeit.
Der Inder stand schon wieder vor dem mittleren Sarge und zog nun mit Hilfe des Flaschenzuges den Deckel noch höher.
Dann griff er hinein in den Unterteil, hob die zerschlissenen Decken und Fetzen empor, an denen noch Reste breiter Goldstickereien zu erkennen waren …
Der, dem einst dieser Sarg letztes Lager gewesen, war längst zu Staub zerfallen …
Und dieser Staub hatte Grita Buccleys Kleider beschmutzt, wirbelte jetzt auf, senkte sich wieder … –
Der Alte holte seine Laterne …
Leuchtete in den Unterteil hinein …
Bückte sich tiefer … Stellte die Laterne auf den breiten Zinkrand …
Längst war mir klar geworden, daß dieser mittlere Sarg noch einen Eingang zu einem uns unbekannten Raume des früheren Indra-Tempels enthalten müsse. Mithin mußten sich in dem Boden des Unterteils eine Klappe und unter dieser eine zweite in den Steinfliesen befinden. Anders war Grita Buccleys grauenvolles Abenteuer nicht zu erklären.
Der greise Inder suchte jetzt nach dieser Klappe im Zinkboden, beugte sich noch tiefer hinab …
Und – – prallte zurück …
Ein leiser tönender Knall wurde vernehmbar …
Der Greis schüttelte wieder den Kopf … Sein hagerer Arm streckte sich nach der Laterne aus. Dann stieg er – in den Sarg hinein … Tauchte darin unter – allmählich …
Langsam nahm das Licht der Laterne ab, wurde schwächer und schwächer …
Dunkelheit wieder …
Neben mir Haralds Stimme:
„Der Greis ohne Hirn ist ein neuer Mitspieler in diesem Drama – ein alter Mitspieler …“
Ich achtete nicht viel auf diese Sätze … Meine Aufmerksamkeit galt dem, was wir nun tun würden: dem Inder folgen! – So nahm ich an …
Und sprach es auch aus …
Harst flüsterte abermals:
„Wir warten noch … fünf Minuten … Kehrt der Inder bis dahin nicht zurück, greifen wir ein!“
Und er zog vorsichtig seine Taschenuhr. Die kleine runde Scheibe des Zifferblattes leuchtete gelb-grün …
Es war genau halb drei – halb drei nachmittags …
„Sie hat das Bad gut überstanden,“ raunte Harald. „Sie geht noch … Und wenn der –“
Mitten im Satz brach er ab.
Ein dumpfer Schlag aus der Finsternis metallisch klingend …
Dasselbe Geräusch wie vorhin, als der Sargdeckel auf den Unterteil sich legte …
Und hastig nun Harsts gehauchte Worte:
„Der Deckel!! – Licht …!!“
Ich ließ die Taschenlampe aufblitzen … Der weiße Kegel traf die drei Särge … Der mittlere war ebenfalls geschlossen. Der Deckel lag auf dem Unterteil …
Die vertrockneten Kränze knisterten. Harst trat aus dem Versteck hervor …
War zwischen den Särgen, packte das Tau des Flaschenzuges …
Und – zog mit aller Kraft …
Was vorhin noch Grita Buccleys Arme geschafft hatten, gelang nicht den trainierten Muskeln meines Freundes … Der Sargdeckel rührte sich nicht!
Auch ich griff mit zu …
Wir zerrten, zogen …
Nichts … nichts …
„Genug!“ meinte Harald … „Der Deckel ist von innen festgehakt worden … Leuchte die Sargfüße ab …“
Und so fanden wir zweierlei: daß nur dieser Sarg mit eisernen Bolzen an den Fußbodenplatten befestigt war und daß nur er unter dem Boden durch ein Viereck von dunklen Balken, die auf den Steinplatten auflagen, gestützt wurde – scheinbar gestützt wurde! Die Balken waren nichts als die Umrahmung des Loches, das nach unten führte.
Harst überlegte …
Und sagte sinnend: „Der greise Inder kannte diesen Weg durch den Sarg in die Tiefe noch nicht. Ihm war er etwas Neues. Stellen wir fest, ob unten im Götzenraum die Wände mit diesen hier oben übereinstimmen oder ob das untere Gemach nicht genau unter diesem hier liegt. Ist es nicht der Fall, so gibt es eben noch einen zweiten verborgenen Raum neben dem Aufbewahrungsort der Statuen …“
Schon wenige Minuten später wußten wir, daß in der Tat ein solcher zweiter Raum vorhanden sein mußte.
Und wie wir so noch neben dem einen vergoldeten Indra standen – leider genau unter der offenen Luke –, ließ ein leises Geräusch uns emporblicken …
Etwas wie eine Riesenfledermaus schwebte herab …
Schnell …
Fiel uns auf die Köpfe …
Eine – schwarze schwere Decke …
Eine noch schwerere Last warf mich nieder: ein Mann mußte mir ins Genick gesprungen sein!
Und betäubender Dunst entströmte dem Gewebe …
So betäubend, daß meine Gedanken sich verwirrten …
Mit einem Male nichts mehr …
Ich wurde bewußtlos … – –
Ich blinzelte in farbige Lichtstreifen hinein …
Gähnte – gähnte wieder …
Das – war doch unser Wohngemach im Schlosse Dodabetta …
Das war doch die Sonne, die durch die bunten Fenster hineinschien – auf farbige prächtige Teppiche …
Und immer mehr erwachte ich …
Lag im Sessel neben dem Tisch, die Beine weit ausgestreckt …
Im – Sessel …
In – unserem Wohngemach …
Träumte ich?! Wo war ich doch zuletzt in wachem Zustand gewesen? Im – Erbbegräbnis …, nein, im Raume der Statuen …
Und – dort … dort waren wir doch … betäubt worden … –
Träumte ich …?!
Ich drehte den Knopf – nach rechts …
Im anderen Sessel Harald – schlafend, den Kopf auf die Brust gesunken … –
Und mit aller Anspannung meines leidlich klar arbeitenden Hirns suchte ich mir Gewißheit zu verschaffen, ob ich wirklich wach sei …
Richtete mich auf … War noch etwas schlaftrunken …
Jedenfalls: dies hier war kein Traum! Ich hörte Harald tief atmen – ganz ruhig. Ich hörte draußen irgendwo das schwerfällige Arbeiten des Motors eines Lastautomobils …
Ich war wach – vollständig …
Und schaute an meinem Anzug hinab, betastete ihn …
Trocken der Stoff – völlig trocken …
Ja – hatte ich denn nicht als Ratte irgendwo um mein Leben im Wasser wie ein Verzweifelter gekämpft?! Hatte ich nicht Jacke und Weste abgeworfen?! Hatte ich nicht …
Und – da gähnte Harald, riß die Augen auf …
Ich beobachtete ihn …
Sein Blick wurde geradezu stier …
Ich las ihm die Gedanken von der Stirn ab … Diese Gedanken prüften fraglos dasselbe, was auch mir so unglaublich erschienen …
Dann schaute er mich an – lange – unsicher …
„Begreifst Du das?“
„Nein …“
Er setzte sich mit einem Ruck aufrecht …
Faßte in die Westentasche … Nahm die Uhr hervor.
„Halb sieben –,“ meinte er. „Und als wir –“
„Ja, halb drei war’s da,“ fiel ich ihm ins Wort.
„Halb drei –“
„Also vier Stunden seitdem verstrichen …!“
Er befühlte seine Jacke, wie ich’s getan hatte …
„Trocken!“
„Allerdings …“
„Sollten wir – geträumt haben?“
„Hm – ob zwei das gleiche träumten?! Ob zwei im Traum in einen unterirdischen Kanal fallen, ob zwei …“
Er sprang auf …
„Eine Frechheit, mein Alter! Gib acht: Guiseppe wird versuchen, all dies als Träume hinzustellen …“
„Das wäre ja …“
„… unmöglich, glaubst Du?! – Nun, verschaffen wir uns Gewißheit … Das ist nicht schwer …“
Er trat vor mich hin, befühlte seine Stirne …
„Hier verletzte ich mich … Hier ist auch eine Schramme. Und – schau Dir unsere Stiefel an! Gewiß, sie sind trocken. Und doch sind sie pitschnaß gewesen … Man hat sie getrocknet, frisch mit Creme eingerieben, – man – man: Guiseppe Vandoni!“
Ich schwieg …
Zweifel kamen mir …
Wir waren ja in Indien … Wir hatten hier früher Dinge erlebt, die über alles menschliche Begriffsvermögen hinausgingen … Wir hatten in Benares, der heiligen Stadt, einen Fakir gesehen, der sich auf ein freistehendes Tischchen hockte, unter dem eine Steinschale mit qualmendem Räucherwerk schwarze Wolken um den Fakir wirbelte. Und dieser Fakir hatte sich scheinbar ebenfalls in Rauch aufgelöst, verschwand – – vollständig … Mit einem Male war der Tisch leer gewesen, und dann hatte der zerlumpte Zauberer sich durch den Kreis der Zuschauer gedrängt, hatte sich so wieder gezeigt …
Noch anderes kannten wir, was nur in Indien möglich ist …
Sollte deshalb nicht auch hier vielleicht irgendein …
Ich zuckte zusammen … Es hatte geklopft. Harst rief „Herein!“
Guiseppe – der Clown …
Grinsend, sich die Hände reibend, katzbuckelnd …
„Die Sennores verzeihen … Ich habe mir erlaubt, Ihnen einen Einblick in indische Geheimnisse zu gewähren.“
Er stand noch an der Tür, hatte sie offen gelassen …
Und in der Tür erschien nun ein abschreckend magerer Inder, unglaublich zerlumpt und schmierig … auf dem Rücken einen Ledersack …
„Sadwitala, der Yogi …“ stellte Guiseppe vor. „Er hat den Sennores etwas von seinen Fakirkünsten gezeigt. Er bittet um eine kleine Gabe …“
Harst winkte dem Yogi … Der trat zögernd näher.
„Du warst hier im Zimmer, Sadwitala?“ fragte Harald.
„Nein, Sahib … Im Keller … Sahib Guiseppe hatte mich dorthin bestellt …“
Der Inder sprach leidlich Englisch. Stolz und aufrecht ließ er das Verhör über sich ergehen. In seinem dunklen Gesicht lag jener Ausdruck von Hochmut und verächtlicher Abweisung, den man bei so vielen Indern findet.
„Du hast uns träumen lassen, Sadwitala?“ fragte Harst weiter. „Von welchem Augenblick an?“
„Als Sahib Guiseppe das Glas fallen ließ … Ich war hinter dem Regal der Flaschen … Mein Wille bezwang Euch. Ihr glaubtet zu fallen, und in Wahrheit gingt Ihr in dieses Gemach zurück und schlieft und träumtet, was ich wünschte. Wir Yogis der heiligen Kaste nennen dies „Den Weg zu Brahma“ – den Weg des Traumes: Wagar ill Brahma.“
„Du weißt, was wir geträumt haben?“
„Sahib, es waren meine Gedanken, die Euch ins Hirn krochen …“
„So gibt es also keine Falltür im Weinkeller, die uns in den Kanal hinabbeförderte?“
„Nein – nur den Kanal gibt es, Sahib … Ich bin ein Kind dieses Landes, Sahib. Mein Vater, meine Väter waren Untertanen der Rani von Dodabetta. Meine Jugend habe ich hier verlebt, hatte im Inseltempel wochenlang gefastet und im Gebet vor Indras blitzenden Statuen auf spitzen Steinen gekniet … – Es gibt nur einen Kanal, Sahib …“
Harst lachte auf …
„Das wird sich ja alles nachprüfen lassen, wenn Seine Exzellenz der Graf hier ist …“
Guiseppe dienerte …
„Sennor, mein Herr trifft in einer Stunde ein … Er hat einen Boten vorausgeschickt …“
„Ah – das ist sehr angenehm, Guiseppe … Diese Stunde werden Sie und der Fakir dort auf den beiden Stühlen zubringen –“
„Wie Sie wünschen, Sennor … Wie Sie wünschen! Hätte ich ahnen können, Sennor, daß Sie durch Sadwitalas Künste derart gegen mich eingenommen werden würden, dann …“
„Setzen Sie sich …“
Guiseppe gehorchte. Der Fakir aber kauerte neben der Tür auf dem Teppich. Seinen Ledersack hatte er neben sich gelegt.
2. Kapitel.
Wir finden nichts …
Harald hatte seine Clement aus der Tasche genommen, besichtigte sie …
„Hm – tadellos gesäubert und geölt, lieber Guiseppe!“
Der Clown grinste …
„Waffen muß man sauber halten, Sennor …“
Harst ließ den Patronenrahmen herausschnellen und prüfte die Patronen …
„Scheinen in Ordnung zu sein …“
Er drückte den Rahmen wieder hinein …
Spannte die Waffe, öffnete ein Fenster und – feuerte einen Schuß in die Luft ab …
„So …“ meinte er, „nun können wir uns weiter unterhalten, bis die Stunde um ist – und Ihr Schwindel aufgedeckt wird, Guiseppe …“
Das Gesicht des Kleinen zuckte …
„Sennor, Sie tun mir Unrecht …“
„Wissen Sie, wer wir sind, Guiseppe?“
„Sennor Buccley erzählte es mir vor seiner Abreise … Die Sennores sind zwei deutsche Detektive …“
„Buccleys sind fort?“
„Vor einer Stunde etwa … mit ihren Pferden – nach Patana, dem nächsten größeren Dorfe. Sie lassen die deutschen Sennores noch grüßen …“
„Sehr liebenswürdig … – Und Sie glauben, Guiseppe, daß Harald Harst und Max Schraut an diesen Wagar ill Brahma glauben?! – Daß es Derartiges gibt, weiß ich. Nur hier handelt es sich um – eine freche Lüge, Guiseppe. Sadwitala wird irgendein bestochener Bettler sein …“ –
Ich saß noch in meinem Sessel …
Ich hatte den angeblichen Yogi vier Schritt vor mir, und ich sah, daß in dem Ledersack etwas sich bewegte – irgendein Tier …
Der kleine Verwalter erwiderte höflich:
„Sennor, auch mein Herr kennt den Fakir sehr genau!“
Harst drehte sich halb um, wandte sich an den Inder.
„Was befindet sich in dem Ledersack?“
„Ein Räucherbecken und zwei Beutel, Sahib,“ erklärte der Yogi gelassen und hochmütig.
„Schnüre den Sack auf …!“ Und zu mir: „Du könntest ebenfalls die Clement bereithalten!!“
Der Fakir gehorchte …
Die schmutzige Schnur legte er zur Seite, öffnete dann den schmierigen Sack … faßte hinein …
Ein Kohlenbecken, zwei Beutel …
Und er kehrte den Sack um, drückte ihn zusammen …
„Bist Du zufrieden, Sahib?!“ Unendlicher Hohn war’s.
Und Harst biß sich auf die Lippen …
Und mir – wurde ungemütlich … Der Sack hatte die Größe eines prall gefüllten Rucksacks gehabt. Räucherbecken und Beutel konnten kaum ein Viertel des Raumes eingenommen haben. Und doch war der Ledersack rund und wie gefüllt gewesen, hatte sich dauernd bewegt … – Jetzt lag er schlaff auf den Knien des Yogi … –
Harald setzte sich. Sein Gesicht war finster und verärgert.
Der Fakir packte das kleine Becken und die beiden Beutel wieder ein …
Und – der Ledersack schwoll an – wurde prall …
Als der Yogi nun die Schnur oben herumwickelte, waren die Bewegungen so stark, daß man geradezu glauben mußte, in dem Beutel jagten sich zwei Katzen …
Harst starrte hin …
Seine rechte Hand lag auf der Sessellehne …
Hob sich …
Peng – peng – peng …
Drei Schüsse …
Guiseppe schrie auf …
Und gleichzeitig auch aus dem Sack ein jämmerliches Kreischen, das rasch wieder verstummte …
Ich war blaß geworden …
Harst hatte drei Kugeln durch den Sack geschickt … Und in dem Sack mußte sich ein lebendes Wesen befinden.
Ich stierte den Fakir an …
In den schwarzen Augen glühte ein fanatischer Haß …
Die Augen funkelten Harald an …
„Mörder!“ sagte der Fakir laut … „Mörder!!“
Harst war aufgestanden …
Auch er hatte sich verfärbt …
Der Yogi schnürte den Sack wieder auf …
Die Lederränder glitten nach unten …
Und – ich sah flüchtig das braune Gesicht eines indischen Knaben von vielleicht einem Jahr – sah einen zusammengekrümmten Leib … Und auf der Brust – drei rote Stellen …
Mein Herzschlag stockte …
Harst stand – weit vorgebeugt …
Der Yogi hatte den Sack rasch wieder hochgezogen und verschnürt …
Noch immer verhielten wir uns regungslos …
Bis Harald gezwungen auflachte …
„Nicht schlecht, Sadwitala!! Der Trick ist neu!“
„Es ist nur wieder der „Weg zu Brahma“, Sahib,“ erklärte der Fakir ernst. „Du hast gezweifelt, Sahib … Du hast ein Kind erschossen und doch nur geträumt … – da …!!“
Und er riß die Schnur weg …
Kehrte den Sack wieder um …
Das Becken und zwei Beutel fielen auf den Teppich …
Ich leckte mir die trockenen Lippen … Ich – betupfte mir die Stirn … Kalter Schweiß bedeckte selbst meine Wangen.
Harst sank etwas matt in den Sessel zurück …
Guiseppe sagte bescheiden:
„Sennor Harst, ich höre ein Auto … Es wird mein Herr sein …“
Wir lauschten. Harald ging rasch ans Fenster, riß es auf …
Das Auto kam näher …
„Rapsoldi – wirklich!“ rief Harst mir zu …
Und zu Guiseppe: „Gehen Sie … Bitten Sie Ihren Herrn hier nach oben. Der Fakir bleibt!“ –
Der Gouverneur trat ein, begrüßte uns …
„Mein alter Guiseppe hat mir bereits alles erzählt, meine Herren …“ Er drückte uns die Hand. Nickte dann dem Yogi zu.
„Sadwitala ist kein Schwindler, Sennor Harst …“ Und er lächelte fein. „Guiseppe hätte jedoch diesen Scherz mit Ihnen sich nicht erlauben dürfen … – Es gibt keine Falltür vor dem Flaschenregal, wirklich nicht …“
Harsts Gesicht war geradezu steinern.
„Exzellenz, ich habe hier eine Wunde an der Stirn … Als ich den Kanal durch den schmäleren verlassen wollte, stieß ich gegen den Felsen … Und als ich …“
Rapsoldi wehrte ab. „Lieber Sennor Harst, was Sie Kanal nennen, ist das Bad, das frühere Bad, das zum Schlosse gehört. Ich kenne es. Es führt eine Treppe dort hinab – aus einem Seitengewölbe der Keller. Die Steintür dort unten habe ich durch Bretter verrammeln lassen!“
Aber Haralds eisige Miene verwirrte ihn.
Er fügte hastig hinzu: „Gut, gehen wir denn sofort in den Weinkeller hinab …“
„Wenn ich darum bitten dürfte, Exzellenz … Der Fakir mag uns begleiten …“
Und eine Viertelstunde später mußte Harst sich geschlagen erklären: es gab keine Falltür dort! Der Felsboden bewies es. Da war keine Rille, keine Spalte, nur zusammenhängendes Gestein …
Harald wandte sich an Guiseppe …
„Entschuldigen Sie …“ Und er zuckte die Achseln. „Man lernt eben nie aus, nie … Ich habe doch schon so manches erlebt …“
Und er reichte dem Clown die Hand …
„Irren ist eben menschlich, Guiseppe …“
Der Graf führte uns dann noch zu dem versperrten Zugang, der einst für das Badebassin vorhanden gewesen.
„Hinter dieser Steintür gab es bis ins Wasser hinab eine Marmortreppe,“ sagte Rapsoldi leise. „Ich ließ sie entfernen, da ich einmal feststellte, daß auf dem Grunde des Bassins eine Menge Skelette liegen …“
Guiseppe und der Fakir standen abseits.
Bisher waren die drei Indra-Statuen nicht erwähnt worden …
Jetzt fragte Harst gedämpft:
„Kennen Sie den Raum unter dem Erbbegräbnis, Exzellenz?“
Rapsoldi verneinte. „Sie werden auch den nur im Traum geschaut haben, lieber Harst …“
„Und Sie wissen auch nichts von drei vergoldeten Indra-Statuen, Exzellenz?“
Der Graf lächelte schon wieder …
„Streichen Sie das alles doch aus Ihrer Erinnerung!“
„Das ist unmöglich! Die Statuen existieren, und auch durch den mittleren Sarg geht ein Weg in …“
Rapsoldi nahm Haralds Arm … „Kommen Sie, kommen Sie …! Wir rudern zur Insel hinüber. Sie geben ja doch eher keine Ruhe!“
Der Gouverneur war ein wenig gereizt. Aber er beherrschte sich, ward schon im Boot wieder die Liebenswürdigkeit selbst und meinte:
„Wir drei sind nun allein, Sennores. Ein Mann von Ihrer Berühmtheit, bester Harst, weiß, was er will … – Sie zweifeln noch immer?“
„Ich zweifle nicht mehr …“ Pause … „Wir haben nicht geträumt … Daran zweifle ich nicht …“ Pause. „Guiseppe hatte uns beide vor ein anderes Flaschenregal und in einen anderen Keller geführt. Das war’s!“
Es hatte den Anschein, als wollte der Graf ob solcher Hartnäckigkeit zunächst ärgerlich werden. Er beherrschte sich jedoch und fragte ein wenig verwundert:
„Ein anderer Weinkeller?! – Das ist unmöglich. Es gibt nur einen.“
„Ihres Wissens. Ich behaupte: es gibt zwei. Und beide gleichen einander vollkommen, bis auf den Zugang eben und bis auf die Falltür!“
Der Graf schwieg – aus Höflichkeit.
Wir hatten die Insel erreicht und landeten am Fuße der in die westliche Felswand eingehauenen Treppe.
3. Kapitel.
Die kleine Kammer.
Der kleine uralte Indra-Tempel nahm fast die ganze Oberfläche des Inselchens ein. In seiner schmucklosen massigen Schlichtheit wirkte er tatsächlich wie einer jener modernen Mausoleumsbauten, bei denen die Architekten dem Gedanken menschlicher irdischer Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit menschlichen Schaffens durch einen recht eindrucksvollen einfachen und kraftvollen Bauentwurf gegenüberstellen wollen.
Die aus Schmiedeeisen gearbeiteten reich verzierten Türen hatten nur einen künstlerischen Hebelverschluß.
Wir traten ein. Die kleine Halle enthielt einen Altar, zwei große versilberte Leuchter auf schwarzen Marmorsäulen und als Erinnerungsstücke an die einstige heidnische Bestimmung zahlreiche Wandskulpturen von jener geradezu unanständigen Art, wie man sie in Indien an den heiligsten Orten so häufig antrifft.
In der Mitte hob sich deutlich im Plattenboden die große Falltür ab. Sie war leicht zu öffnen, und mit unseren rasch angezündeten Laternen stiegen wir nun in das Erbbegräbnis hinab.
Graf Rapsoldi verharrte vor den Särgen eine Weile in stillem Gebet, bekreuzigte sich und wandte sich dann an Harald.
Der hatte sich inzwischen schon genau wie ich überall umgeschaut und festgestellt, daß die Taue des Flaschenzuges nach oben zu aufgewickelt und nicht mehr am Deckel des mittleren Sarges befestigt waren. Er hatte sich auch gebückt und unter diesen Sarg geleuchtet, erklärte jetzt auf Rapsoldis Frage, ob die Örtlichkeit hier der von uns im Traum gesehenen in allem entspreche:
„Ich muß mit einem Nein antworten, Exzellenz … Die Taue des Flaschenzuges dort sind jetzt alt und mürbe, faserig und kaum haltbar. Außerdem fehlen unter dem mittleren Sarge die Balkenstücke, die ein Viereck bildeten und …“
Der Graf hatte schon den Arm hochgereckt und eins der Taue herabgezogen.
„Sie halten noch …“ unterbrach er Harald. „Gehen wir den Dingen auf den Grund und heben wir den Sargdeckel empor …“
Ich erlaubte mir jetzt eine Bemerkung …
„Dieser Sarg war durch Bolzen an den Steinplatten befestigt … Jetzt sind die Bolzen verschwunden, auch Löcher in den Zinkfüßen sind nicht mehr zu sehen …“
Harsts Gesicht, das ich flüchtig musterte, blieb unbewegt.
Rapsoldi sagte nur: „Ich wußte es …“
Ich war verwirrt und unsicher. Ich fand mich in all dem Unerklärlichen nicht mehr zurecht.
Harald blieb stumm.
Wir befestigten die Taue am Sargdeckel. Sie hielten. Wir zogen den Deckel empor. Im Sarge lag ein zur Mumie eingetrockneter Toter in reicher Uniform.
Ich starrte auf diese Mumie wie auf ein Gespenst …
„Nun?!“ fragte der Graf. „Und Sie beide sahen hier nur Staub, der hochwirbelte. – Stören wir die Ruhe meines Urgroßvaters nicht weiter …“
Der Deckel senkte sich …
Ich war völlig benommen …
Sollten wir wirklich nur geträumt haben?! –
Harst kniete am Rande der Öffnung, die von hier in den Statuen-Raum hinabging. – Der Graf meinte gleichgültig:
„Ich kenne die Kammer da unten … Sie ist leer. Ich habe mich nie dafür interessiert, nur einmal hinabgeleuchtet.“
„Und die Höhle mit dem Balkengerüst und der Treppe?“ fragte Harald und hob den Deckel der Öffnung empor.
„Gehört habe ich wohl davon, lieber Harst … Ich bin jedoch in keiner Weise romantisch veranlagt. Derartige alte Geheimnisse trifft man hier zu häufig an …“
Harald leuchtete hinab …
„Leer!“ sagte er achselzuckend.
Rapsoldi schwieg aus Höflichkeit.
„Wir können gehen,“ fügte mein Freund hinzu. „Guiseppes Charakter ist nun geklärt … Gehen wir …“
Erst im Boot meinte Rapsoldi:
„Sie haben also auch den Gedanken an den zweifachen Keller aufgegeben, lieber Harst?“
„Auch ich bin zu bekehren, Exzellenz …“ Und er ruderte uns ans Ufer.
Ich aber wußte nun ganz genau: Harst war bekehrt – aber in anderem Sinne! Rapsoldi hatte sich nur durch die doppelsinnigen Antworten täuschen lassen.
Und als wir jetzt der Dodabetta-Burg wieder zuschritten, kam Rapsoldi auf das Ehepaar Buccley zu sprechen …
„Der Maler hat mir als Dank für die hier genossene gastliche Aufnahme eine Aquarellskizze der Burg gewidmet. Guiseppe zeigte sie mir flüchtig … Ein kleines Kunstwerk …“
Da Harald nur mit ein paar Worten auf dieses Thema eingeht, die völlig nichtssagend sind, halte ich mich für verpflichtet, Frau Gritas Lob zu singen: charmantes Frauchen, elegante Erscheinung – und so weiter.
Rapsoldi bedauert daher, das Ehepaar nicht mehr kennengelernt zu haben.
So langen wir wieder in der Burg an und besichtigen die Aquarellskizze.
Ein kleines Kunstwerk – tatsächlich. Unten rechts steht mit feinen Pinselstrichen:
Unseren Dank!
Thomas Buccley.
Harst tritt mit dem Bilde an ein Fenster … Erklärt ebenfalls: „Ein Kunstwerk!“
Dann gehen wir zu Tisch …
Im Speisesaal ist nur für uns drei gedeckt …
Feierliche Inder bedienen. Guiseppe schenkt den Wein ein …
Wir sprechen über den verschwundenen Grafen. Harst meint, in dieser Sache würden wohl alle Nachforschungen zwecklos sein.
Rapsoldi liebt einen guten Tropfen. Nach Tisch sitzen wir auf dem schmalen Altan, der über der Vorhalle liegt. Dunkelheit deckt das Tal … Der Mond kommt über den Randbergen hoch. Eine träumerische Stimmung befällt uns. Der schwere Wein macht müde … Der Graf gähnt verstohlen. Und um Mitternacht trennen wir uns.
Wie sehnsüchtig hatte ich auf diese erste Minute des Alleinseins mit Harald gewartet! Wieviel[4] zahllose Fragen lagen mir auf der Zunge …!
Wir sind in unserem Wohngemach – in dem Reitstall, der trotz aller exotischen Pracht so ungemütlich ist …
Harald versperrt die Tür, geht in den zweiten Saal, wo unsere Betten stehen, schließt auch hier die Tür ab …
Die elektrische Beleuchtung der beiden Räume ist verschwenderisch. Die Burg erhält den elektrischen Strom durch eine oberirdische Leitung von den Minen her.
Taghell beide Säle …
Und als ich mich nun vor Harald aufpflanze und – beginnen will, sagt er laut und kräftig gähnend:
„War der Wein nur schwer! Ich werde wie ein Toter schlafen … Gehen wir zu Bett …“
Ich verstehe: ich soll nichts fragen!
Und ich ahne: von Schlaf wird in dieser Nacht keine Rede sein!
Unter gleichgültigen Bemerkungen entkleiden wir uns. Harst schaltet das Licht aus.
Trotzdem bleibt geheimnisvolle Dämmerung in unserem Schlafgemach … Der Mond stiehlt sich durch bunte Fenster. Weiche farbige Flecke zeichnet er auf die Teppiche …
Ich liege eine Weile still … Und als ich mich drehe, sitzt Harst aufrecht in seinem breiten Bett und hat den Kopf in die Hand gestützt …
Regungslos sitzt er … Wie einer, der angestrengt nachdenkt …
In meinen Nerven fiebert die Erwartung. Ich weiß: es wird etwas geschehen! Es muß etwas geschehen! Harst glaubt nicht an den „Weg Brahmas“, der uns im Traume Frau Grita im Sarge und uns als Ratten im Badebassin gezeigt haben soll.
Was – – soll ich glauben?! Was?!
Der Mond zieht seine Bahn, erreicht nicht mehr unsere Fenster …
Im weiten Gemach wird’s dunkler. Haralds Gestalt verschwindet …
Und mit einem Male ist er neben mir …
„In die Kleider …! Leise …!!“
Fünf Minuten drauf stehen wir am linken Fenster des Wohnsaales … Harst hat es geöffnet. Zwei Meter entfernt die Steinbrüstung des Altans … Harald klettert auf das Fensterbrett … Ein Sprung – ist drüben … Ich folge …
Er schlingt an der anderen Seite des Altans die Strickleiter um die Brüstung. Der Mond verbirgt sich hinter dem östlichen Turme …
Wir klettern hinab, ducken uns zusammen, kriechen in den Schatten der nächsten Zypresse, huschen weiter – zum Seeufer …
Hier flimmert das stille Gewässer im Glanz des Nachtgestirns … Hier könnte man uns bemerken … Wir ketten das eine Boot von dem Pfahle los, und Harst schwingt sich hinein – tief gebückt, duckt sich wieder zusammen … Auch ich schiebe mich über den Bootsrand … Und der Nachtwind schaukelt den Kahn endlos langsam weiter … Wir liegen zusammengekauert … Wir warten …
Bis endlich das Boot an der Insel vorübergleitet – in den Schatten hinein. Da erst nehmen wir die Ruder …
Wir sind hier auf der dem Treppenzugang des Tempels abgekehrten Seite …
Ein paar leise Ruderschläge bringen uns in die Nähe der Steilwand des Inselchens. Harst flüstert: „Stopp!! – Suchen wir die schmalen Öffnungen, durch die ein Schimmer von Tageslicht in die Höhle hineinfiel …“
Wir halten uns an den Zacken und Rissen des Gesteins fest. Niemand kann uns hier erspähen, der etwa von der Burg her argwöhnisch die Insel beobachtet. Auch nur einen leeren Nachen kann dieser Mann gesehen haben, – – dieser Mann mit dem schlechten Gewissen: Guiseppe Vandoni!
Unser Boot schrammt an Gestein entlang. Harald betastet den Fels …
Und wieder: „Stopp!!“
Der Nachen liegt still. Harst arbeitet mit beiden Händen, zerrt Felsstücke aus einer Öffnung, legt sie leise ins Boot.
Das dunkle Loch wird breiter, höher …
Dann kriecht er hinein. Der Nachen schwankt …
Ich sehe Licht aufflammen. Harald hängt in der Öffnung, den Oberkörper nach unten …
Dumpf klingt sein Zuruf:
„Löse die Bootskette!“
Die Kette klirrt leise. Sie ist nur mit Draht an der Krampe befestigt.
Ich reiche sie Harald.
„Genügt!“ sagt er. „Her mit dem einen Ruder!“
Das Ruder befestigt er als Verlängerung an einem[5] Kettenende. Das andere schlingt er um eine dicke Zacke, keilt einen Stein in die Ritze, damit die Kette nicht abgleitet.
Das Boot treibt weiter …
Wir beide sind unten in der Höhle, am Rande des kleinen unterirdischen Sees. Unsere Taschenlampen senden weiße Strahlen hierhin und dorthin …
Das Balkengerüst … Die Treppe …
Wir waten, schwimmen …
Sind an der Treppe …
Aber Harald warnt: „Guiseppe dürfte auch hier – gearbeitet haben … Vielleicht hat er den Balkenturm präpariert …“
Ich begreife: die Balken durchgesägt! Einen Einsturz vorbereitet! –
Harst hat sich getäuscht … Er findet nichts, was bedenklich erschiene.
Wir stehen oben, klettern durch die Falltür …
Stehen in dem Raume der Statuen, der jetzt leer ist …
Leuchten die Wände ab …
„An dieser Wand könnte ein Durchgang sein,“ meint Harst. „Nach dieser Seite hin muß das Gelaß liegen, zu dem man durch den Sarg …“
… Schweigt plötzlich, fährt mit dem Fingernagel in einer feinen Rille des geglätteten Felsens entlang – umschreibt so die unregelmäßigen Umrisse dessen, was wir suchen: ein bewegliches Stück des Gesteins!
Er tastet weiter – stemmt die Knie gegen die Wand …
Mit leisem Kreischen dreht sich die zackige Tür nach innen …
Eine winzige Kammer …
Drei vergoldete Statuen …
Und ein – bekanntes Gesicht: der uralte weißbärtige Inder, der von sich selbst zu Grita Buccley sagte, er habe kein Hirn mehr …
Gefesselt liegt der Greis zwischen den Götzen, einen Knebel im Munde …
Seine Augen sind blutunterlaufen …
Harst reißt ihm den Knebel heraus …
Keuchend atmet der Inder … Seine Lider fallen herab. Eine Ohnmacht läßt ihn matt zurücksinken …
4. Kapitel.
Die Wohnung des Fakirs.
Und doch habe ich kaum einen Blick für den Alten übrig. Mein ganzes Denken gehört den drei Statuen …
Sie funkeln, sprühen … In den Augenhöhlen glühen grüne Smaragde … In den Diademen gleißt es in allen Farben: die Edelsteine sind wieder eingefügt worden …! Die flachen Löcher, die wir leer gesehen, sind gefüllt!
Auch Harsts Gesicht verrät ungläubiges Staunen …
„Das hätte ich nicht erwartet,“ sagt er leise. „Überhaupt – vieles ist mir noch unklar … Zum Beispiel: Haben die Buccleys das Schloß freiwillig verlassen? Hat Guiseppe sie dazu gezwungen?“
Mir schienen diese Fragen nebensächlich …
„Wer mag nun dieser alte Inder sein, der die Geheimnisse des Inselchens zum Teil doch auch kannte?!“ wende ich mich an Harst.
Und der Freund bückt sich über den Bewußtlosen, schiebt ihm das Gewand an der Schulter tief herab …
Ich stutze …
Die braune Haut ist plötzlich hell wie die eines Europäers … Nur die freien Stellen des Leibes hat die Sonne Indiens tief gebräunt …
Eine ungewisse Vermutung kommt mir …
Ich prüfe die Gesichtszüge … Das ist nicht der schmale längliche Schnitt des Inders …
„Graf Antonio Rapsoldi, der Vater unseres Grafen, der … Verschwundene,“ höre ich Harsts gedämpfte Stimme.
Also – doch!!
Antonio Rapsoldi …!! –
Harald kniet und löst ihm die Stricke, fühlt nach dem Puls …
Der Greis regt sich, erwacht … Harst hilft ihm, stützt ihn, bis er aufrecht sitzt.
Und des alten Mannes wieder klare Augen mustern uns lange …
„Wer sind Sie, Sennores?“ fragt er ein wenig matt.
„Zwei deutsche Detektive, Graf Rapsoldi …“
Der Greis schüttelt den weißen Kopf.
„Ich bin nicht Graf Rapsoldi … Ich bin Matarana, der Vater des Yogi Sadwitala, Sennor …“
„Und wer hat Sie hier gefesselt und geknebelt?“
„Ich weiß es nicht … Ich habe den Mann nicht gesehen … Ich beugte mich oben in den Sarg hinein, und plötzlich fiel eine Klappe im Boden herab, zwei Hände zerrten mich am Halse nach unten … Ich kam erst zu mir, als ich hier gebunden im Dunkeln lag …“
„Sie trafen mit einer Frau im Erbbegräbnis zusammen. Wir haben Sie belauscht … – Was wollten Sie oben bei den Särgen?“
„Nichts … Ich bin oft dort, … wenn Sadwitala nicht daheim ist und ich entschlüpfen kann …“
„So läßt Ihr Sohn Sie nicht ungehindert umherwandern?“
„Nein, – weil ich … so leicht alles vergesse, Sennor, weil mein Gedächtnis oft versagt … Dann finde ich nicht zurück nach unserer Hütte, und die Tiger würden mich fressen … Es gibt hier Tiger, Sennor …“
„Wir haben sie nachts gehört … Ich weiß – ich weiß …“
Und nach kurzem Schweigen:
„Würden Sie jetzt zurückfinden, Matarana?“
„Ja … Und ich muß eilen … Mein Sohn wird mich suchen und nachher sehr böse sein …“
„Ist es weit bis zu der Hütte?“
„Eine halbe Stunde, Sennor.“
„Werden Sie schwimmen können, wenn wir Sie stützen?“
„Ich hoffe, Sennor …“ –
Wir richteten den armen Grafen, der hier seit Jahrzehnten in ein solch ungeheuerliches Gewebe von Lüge und Trug verstrickt worden war, vollends auf.
Dann fragte Harald noch:
„Kennen Sie diese Statuen?“
„Ja – lange, lange!“
Dann gingen wir …
Es war überraschend, wie kräftig dieser Greis, der doch annähernd neunzig Jahre alt sein mußte, noch mithalf, an der Kette emporzuklimmen. Harst brauchte ihn nur wenig zu heben, und leichter und schneller, als ich’s gedacht, waren wir dann auch am Seeufer angelangt.
Unsere triefenden Anzüge waren uns nicht weiter unangenehm. Diese Nacht, mild und windig, hätte man daheim in Deutschland als glutheiß bezeichnet. Hier ist man an andere Temperaturen gewöhnt.
Der alte Graf, der seine frühere Existenz so vollkommen vergessen hatte, schlug südliche Richtung ein. Wir klommen nach Durchquerung eines Waldstreifens die Talwand hinan und stiegen abermals in ein bewaldetes Tal hinab.
Die ganzen Umstände rieten zu allergrößter Vorsicht. Wir hielten die Pistolen bereit. Ganz abgesehen von dem Getier der Bergwildnis, das jetzt auf Raub unterwegs war, mußten wir auch mit menschlichen Feinden rechnen. Guiseppe Vandoni hatte ja offenbar die ganze Dienerschaft der Burg, wahrscheinlich auch die farbigen Minenarbeiter, auf seiner Seite. Und dann noch der Fakir, erst recht kein zu verachtender Gegner …! –
Harald begann den Greis von neuem auszufragen …
Und so merkten wir denn, daß der Graf in der Tat nichts mehr von seinem ehemaligen Leben als Europäer wußte und daß er in der Hütte des Fakirs stets schon gehaust zu haben glaubte, wo man ihn zumeist sorgsam einsperrte.
Über diese Hütte machte er uns Angaben, die wir zunächst nicht recht verstanden. Er sprach abwechselnd von „Hütte“ und „Turm“, bis Harald schließlich herausbrachte, daß es sich hier fraglos um einen einzelnen Felskegel handelte, der oben eine flache, eingezäunte Kuppe hatte, wo die Steinhütte des Yogi stand.
Inzwischen waren wir in ein zweites Quertal gelangt. Es war völlig kahl und sehr steinig, hatte schroffe Hänge und sah düster und unheimlich aus.
Der Mond spendete auch hier genügend Licht. So konnten wir denn schon, bevor noch der Greis uns auf den Felskegel aufmerksam machte, den merkwürdigen Wohnort des Fakirs von weitem erkennen.
Harald bog jetzt nach links bis dicht an die schroffe Talwand ab, die im Schatten lag.
Hier blieb er stehen. Und eindringlich und doch gedämpft sagte er nun zu unserem unglücklichen Begleiter:
„Graf Antonio Rapsoldi, wenn auch Ihre Erinnerung an das einst völlig geschwunden ist, wahrscheinlich durch den plötzlichen Sturz in das Wasserbassin, wie ich vermute, Ihr Geist ist im übrigen klar geblieben. Sie sind Graf Antonio Rapsoldi, sind kein Inder. Der Fakir ist niemals Ihr Sohn, sondern Ihr Gefangenwärter. Haben Sie denn noch nie bemerkt, daß Ihre Haut an den durch Ihre Kleidung geschützten Stellen weiß ist?!“
Wir standen hier im Dunkeln …
Ich versprach mir sehr wenig von diesem Versuch Haralds, das Gedächtnis des Grafen wieder zu wecken.
Seltsamerweise aber erwiderte der alte Mann mit eigentümlich sinnendem Tonfall:
„Sennor, daß in meinem Leben vieles sich ereignet hat, was für mich in völliger Finsternis daliegt, weiß ich sehr wohl … Ich finde nur nicht den Weg zurück in dieses Land der Vergangenheit … Zuweilen habe ich wohl geträumt, daß ich einst in den Sälen der Burg Dodabetta dahinwandelte und daß gerade dort etwas geschehen, was – was wie ein schwerer Druck auf meinem Haupte lastet … Und wenn ich zu Sadwitala davon sprach, dann … dann … träumte ich wieder ganz anderes …“
Seine Stimme wurde immer leiser …
„Ich – ich weiß nicht recht, wer ich bin, Sennor …“
„Und – – Guiseppe Vandoni?!“
Harald betonte den Namen scharf …
„Gui…seppe – Vandoni …?“ wiederholte der Greis. „Guiseppe – Guiseppe … Ja … Er kommt zuweilen zu uns … Ich – fürchte ihn …“
Harst gab diese Versuche auf.
„Bleibe mit ihm hier zurück,“ raunte er mir zu …
„Niemals! Ausgerechnet in dieser Nacht – bei diesem Vorhaben! Niemals!“
„Der Greis ist uns nur hinderlich … Was soll mir dort zustoßen?!“
„Oh – die Möglichkeiten sind nicht abzusehen …“
„Gegenüber neun Kugeln einer modernen Repetierpistole schrumpfen die Möglichkeiten arg zusammen, mein Alter … Sei verständig!“
Aber ich blieb fest … Ich war erregt …
„Denke an den Ledersack des Yogi …!! Auch Du hast da die Farbe gewechselt … Wir sind in Indien …!“
„Nun denn, – – weiter also …“
Und ebenso leise zu unserem Begleiter:
„Wie gelangt man auf den Felskegel hinauf, Graf Rapsoldi?“
„Durch eine breite Spalte, in die viele Stufen eingehauen sind, Sennor. Aber dieser Hohlweg hat Türen aus Balken. Oben und unten eine. Und Sadwitalas zahme Schlangen hausen zwischen den Türen, Brillenschlangen, fünfzig – hundert, nicht zu zählen …“
„Wie sind Sie denn heute vormittag hinabgelangt, Graf Antonio Rapsoldi?“
Merkwürdig genug: der Greis ließ sich diese Anrede jetzt ohne weiteres gefallen!
„Ich habe Sadwitalas Flöte genommen, von oben über das Tor Milch in die Aushöhlung der einen Stufe gegossen und die Flöte geblasen. Die Schlangen kennen die Töne. Sie kommen dann aus ihren Löchern und Ritzen herbei und trinken. Wenn man nun den Saft frischer Mohnkörner in die Ziegenmilch tut, schlafen die Schlangen nachher ein und liegen da, ohne sich rühren zu können, Sennor … Mohn enthält Opium, Sennor …“
Er sprach so klar wie jeder geistig völlig Normale …
„Und Sie glauben, daß man jetzt nicht nach oben könnte, Graf Antonio Rapsoldi, – daß die Kobras jeden beißen würden, der die Stufen hinan wollte?“
„Jeden, Sennor, nur Sadwitala nicht …“
„Gibt es denn so etwas wie eine Glocke, die nach oben hin ein Zeichen …“
Und nach diesem Wort nicht das, was Harald hatte folgen lassen wollen …
Nach diesem Wort von der Höhe des düsteren, nur etwa noch fünfzig Meter entfernten Felsens herab ein heiserer Schrei …
Ein Schuß …
Und dann flog dort oben über die aus Felsstücken aufgeschichtete Randmauer ein menschlicher Körper hinweg …
Flog ins Leere …
Fiel mit dumpfem Krachen unten auf das Geröll …
Wir drei standen – hatten uns an den Händen gepackt – unwillkürlich … Wir drei starrten dorthin, wo sich ein letztes Mal ächzend der zerschmetterte Körper im Todeskampfe hochreckte …
„Sadwitala,“ flüsterte Harst …
Und …: „Sadwitala!“ wiederholte der Greis …
Ich dachte an Guiseppe Vandoni, der so vielleicht seinen Mitwisser beseitigt hatte …
„Guiseppe!“ sagte ich nur …
„Vielleicht!“ kam Haralds Stimme als Antwort.
Und noch anderes kam: von der Höhe des Kegels … Flötentöne … Die Töne der indischen langen Bambusflöte – weich – lockend – eine einfache Melodie …
Ich horchte auf …
Durch die stille Nacht breiteten sich die Klänge dieses Liedes aus, das in aller Welt bekannt ist:
Heimat, süße Heimat …
Ich horchte …
„Die Buccleys!“ sagte Harst da. „Ein englisches Lied. Die Buccleys!“
Wir warteten …
Eine Stunde … Längst war das Lied verklungen, längst der Mond verschwunden …
Dann dort oben Laternenschein …
Und – sie kamen … Wir waren näher herangeschlichen, hockten hinter großen Steinen …
Die Buccleys … Ihre Pferde am Zügel führend …
Harst tritt vor …
„Einen Augenblick, Mister Buccley – oder wie Sie sonst heißen mögen … Lassen Sie Ihre Waffe in der Tasche … Ich würde rascher abdrücken … – Ein paar Fragen … Sie kamen der Statuen wegen nach Dodabetta, der Edelsteine wegen … Guiseppe hat Sie überwältigt und hier zu seinem Freunde geschafft …?“
„Es ist so, Mister Harst …“
„Hatten Sie das grauweiße Pulver gestreut?“
„Ja …“
„Weshalb rechneten Sie so derb mit dem Fakir ab?“
„Weil er Grita gegenüber – frech wurde. Ich hatte meine Stricke zum Glück schon gelockert … – Lassen Sie uns fort, Mister Harst …“
„Verschwinden Sie …! Ihnen wird hier wohl nun der Wunsch nach den Diamanten gründlich vergangen sein.“
„Dank Ihnen, Mister Harst …“
Und sie ritten mit ihrem Packpferd im Trab davon …
5. Kapitel.
Die Indra-Diamanten.
Sadwitala war tot … Wir ließen die Leiche liegen, leuchteten mit unseren Taschenlampen nur flüchtig die Felsentreppe des Kegels ab …
Brillenschlangen – ja, eine Unmenge … Regungslos – nur die schillernden Perlaugen müde bewegend …
„Nach Dodabetta,“ sagte Harald … Und zu dem Greise: „Graf Antonio Rapsoldi, Sie werden Ihren Sohn noch heute wiedersehen … Ihren Sohn, der Sie durch uns suchen ließ …“
Der alte Mann erwiderte wie verzagt:
„Sennor, ich weiß nicht, wer ich bin … Ich weiß nur, daß Sadwitala mich nie allein ins Freie ließ. Und jetzt, wo er tot ist, bleibt mein Herz ungerührt. Ich habe kein Hirn mehr …“
Wir schritten das Tal entlang. Die Nacht verblich. Im Osten dämmerte der neue Tag herauf …
Unsere Kleider waren wieder trocken geworden. Fahles Morgenlicht drang in die Bergtäler ein …
Dann der See – die Burg …
Düstere Zypressen rauschten im Morgenwind …
Unsere Strickleiter hing noch vom Altan herab …
Wir waren oben in unserem Wohnsaal. Graf Antonio Rapsoldi saß in einem Sessel und sog an einer Mirakulum. Sein edles Greisenantlitz zeigte den Ausdruck eines sinnenden Träumers …
Wir beide neben ihm … Harst auf ihn einredend, abermals versuchend, die erstorbene Vergangenheit aufleben zu lassen …
Der Graf hatte den weißen Kopf in die Hand gestützt …
„Es lagert ein Druck auf meinem Hirn,“ sagte er leise. „Und dieser Druck ist wie ein eisernes Tor, das mir die Aussicht in das Einst verschließt … Ich weiß nicht, wer ich bin …“
Es wurde heller und heller …
Die ersten Geräusche im Schlosse erwachten …
Graf Antonio war in seinem Sessel eingeschlummert. Seine Jahre meldeten sich. Der vergangene Tag und diese Nacht hatten zu viel von ihm verlangt …
Wir warteten …
Draußen schien jetzt die Sonne …
Harst erhob sich. „Ich werde einen der Diener herbeirufen …“
Mit drei schnellen Sätzen zur Tür … Riß sie auf … Packte zu: Guiseppe!!
„Ah – gehorcht haben Sie, Guiseppe …“
Er schob ihn vor sich her …
„Schraut – binden!“
Guiseppe zitterte … Sein Gesicht war graugelb. Seine Augen quollen heraus … So stierte er den schlafenden Grafen an.
In hatte ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Er beachtete es nicht … Er hatte für nichts Gedanken als für den Vater seines jetzigen Herrn …
„Wollen Sie nun ein Geständnis ablegen, Guiseppe?“ fragte Harst …
Der Unterkiefer des farblosen Clowns bewegte sich krampfhaft …
„Nun – ich will’s Ihnen erleichtern, Guiseppe … Ihr Vater hat den Grafen Antonio betrogen … Daher ließ er ihn in jener Nacht in – die Grube fahren – in das Bassin … Der Fakir bewachte dann den Ärmsten, der sich aus dem Wasser gerettet hatte … Der Fakir wird … des Grafen Hirn leer gemacht haben, das heißt: er tötete jede Erinnerung in ihm!“
Guiseppe Vandoni sank mit einem Male in die Knie – winselte:
„Sennor Harst, die heilige Jungfrau ist meine Zeugin, daß ich selbst nicht ahnte, daß Graf Antonio noch lebte … Ich …“
„Schweigen Sie!“ Harsts Stirnadern schwollen an. „Ihr Possenspiel ist aus! Im Erbbegräbnis haben Sie die Särge vertauscht, den mittleren nach rechts gestellt und die Löcher der Bolzen in den Füßen mit Zinn ausgefüllt …“
Seine Stimme weckte den bedauernswerten Schläfer … Graf Antonio erwachte, sah den armseligen Guiseppe dort vor Harald knien …
Seine müden Augen flammten auf … Seine Hände umkrampften die Sessellehnen … So beugte er sich vor. In seinem Gesicht ging eine auffallende Veränderung vor sich … Es war, als ob all das Unsichere, Ängstliche, Grüblerische plötzlich weggewischt war …
„Guiseppe …!!“ rief er. „Ah – mein Hirn ist von dem ehernen Druck befreit … Guiseppe, so lag Dein Vater damals vor mir auf den Knien … Damals, als ich ihn entlarvt hatte … Und ich verzieh ihm … Schickte ihn schlafen … Alles sei vergessen – vergeben … – Dann stieg ich in den Keller hinab – eine Stunde später … Stand vor dem Flaschenregal … Und – versank – stürzte ins Wasser – glaubte zu ertrinken …“
Mit einem Ruck war er vollends auf den Füßen …
Die Erinnerung an das, was man ihm angetan hatte, brachte jetzt doch sein Blut in Wallung …
Er reckte sich höher … Seine Stimme wurde hart und unbeugsam …
„Guiseppe Vandoni, Sohn des Mannes, den ich einst aus dem Nichts emporgehoben hatte: Du bist mitschuldig an diesem Frevel! Niemals werde ich Dein höhnisches brutales Grinsen vergessen, wenn Du Deinen Helfershelfer, den Fakir, besuchtest und Dich an meinem geistigen Tode weidetest!“
Guiseppe sah ein, daß er hier nichts mehr zu hoffen hatte. Und auch mit ihm ging da urplötzlich eine Veränderung vor sich, die jetzt die düsteren Abgründe dieses unheimlichen Charakters mit einem Schlage enthüllte. – Er sprang auf. Ein drohendes Lachen verzerrte sein hageres Vogelgesicht …
„Tötet mich doch! Tötet mich doch!“ kreischte er geradezu in einem hemmungslosen Anfall von Haß und Wut. „Ja, Graf Antonio, – ich war’s, der meinem Vater den Gedanken eingab, Euch verschwinden zu lassen – nur ich! Dreißig Jahre war ich damals … Und Ihr, Graf Antonio, fast schon ein Greis … Und doch kamt Ihr her und stahlt mir das einzige, was hier in dieser Einsamkeit mein Dasein mit Glück erfüllte! Denkt an die braune Dienerin, Graf Antonio! Mein war sie! Und Ihr nahmt sie Euch – wie eine Sklavin!“
Der greise Portugiese schüttelte ernst den Kopf. „Unseliger, Wahnwitz ist’s, was Du mir da zum Vorwurf machst! Wahnwitz! So wahr ich bereits am Rande des Grabes stehe: Nichts habe ich mit jener jungen Inderin vorgehabt – nichts!“
Guiseppe stierte den Grafen zweifelnd an. – „Sadwitala behauptete es …“ sagte er zögernd.
Graf Antonio lächelte verächtlich. „Ja – der Fakir, den ich damals aus der Burg jagte! Besinne Dich, Guiseppe: er hatte mir seine Künste zeigen wollen. Er wurde unverschämt …! Und Du – Du hast Dich dann von ihm als Werkzeug benutzen lassen …!“
Guiseppe Vandoni ließ den Kopf sinken. Hilflos, vielleicht gefoltert von schweren Gewissensqualen, stand er da.
Murmelte tonlos: „Sadwitala – hat – mich – belogen … Sadwitala – hat – auch meinen Vater zu – den Betrügereien verführt … Er war – ein Sohn der letzten Rani von Dodabetta … Er haßte alle Europäer. Sein Haß kannte keine Grenzen … Er – war der böse Geist, der auch uns verdarb …“
Und dann – ein neuer Kniefall vor dem Grafen Antonio … Ein klägliches Gestammel – ein reuevolles Geständnis …
Es gab tatsächlich in den Gewölben zwei völlig gleiche Räume mit Flaschenregalen, nur daß der Zugang des einen, dicht neben dem anderen gelegen, durch eine Steinplatte verdeckt werden konnte, die auch vor den ersten eingefügt werden konnte …
Guiseppe war mit seinem Geständnis noch nicht zu Ende, als unversehens nach kurzem Anklopfen der Gouverneur eintrat. Er stutzte … Vater und Sohn standen einen Moment wie erstarrt … Dann lagen die beiden Rapsoldis sich in den Armen …
Wir beide nahmen Guiseppe mit in das Nebengemach. Wir wollten diese Wiedersehensszene nicht stören. –
Und drei Stunden später hatten wir dann bei einem Besuch des Inseltempels festgestellt, daß die Edelsteine aus den Indra-Statuen abermals verschwunden waren. Vor der einen Krone lag ein Zettel: „Wir pflegen unser Ziel stets zu erreichen! – Die Buccleys.“
Dieser kecke Raub bildete für uns die Überleitung zu einem weiteren Abenteuer im Zauberlande Indien. Hier will ich nur noch erwähnen, daß Guiseppe Vandoni, obwohl die Grafen Rapsoldi und auch wir ihm verziehen hatten, noch am selben Tage sich erschoß. Der Brief, den er hinterließ, war so seltsam, daß ich ihn wörtlich als Einleitung im folgenden Band bringen will.
Nächster Band:
Verlagswerbung:
|
Der Detektiv Eine Reihe höchst spannender Detektivabenteuer. Bisher sind folgende Bände erschienen: |
|||||
|
Band |
108: |
Die Motorjacht ohne Namen. |
|||
|
– Preis pro Band 20 Pf. – Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin SO 26, Elisabeth-Ufer 44. |
|||||
Anmerkungen:
- ↑ „Zypressen“ / „Cypresse(n)“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Zypresse(n)“ geändert.
- ↑ „Indra-Tempel(s)“ / „Indratempel“ – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Indra-Tempel(s)“ geändert.
- ↑ „Indrastatuen“ / „Indra-Statuen“ Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Indra-Statuen“ geändert.
- ↑ In der Vorlage steht: „Wie“ – Der Satz macht so keinen Sinn. Daher geändert auf „Wieviel“.
- ↑ In der Vorlage steht: „am einen“.
